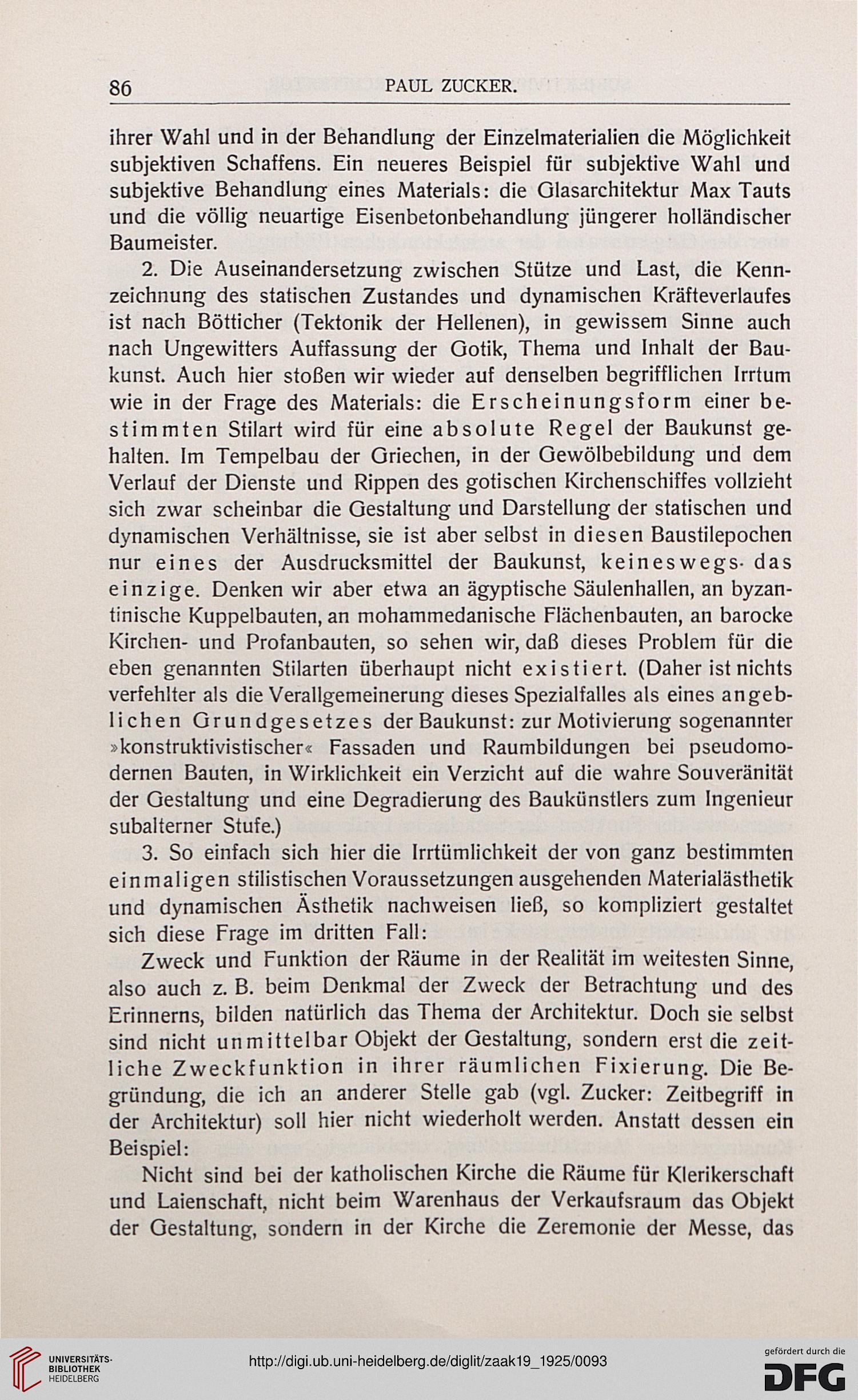86 PAUL ZUCKER.
ihrer Wahl und in der Behandlung der Einzelmaterialien die Möglichkeit
subjektiven Schaffens. Ein neueres Beispiel für subjektive Wahl und
subjektive Behandlung eines Materials: die Glasarchitektur Max Tauts
und die völlig neuartige Eisenbetonbehandlung jüngerer holländischer
Baumeister.
2. Die Auseinandersetzung zwischen Stütze und Last, die Kenn-
zeichnung des statischen Zustandes und dynamischen Kräfteverlaufes
ist nach Bötticher (Tektonik der Hellenen), in gewissem Sinne auch
nach Ungewitters Auffassung der Gotik, Thema und Inhalt der Bau-
kunst. Auch hier stoßen wir wieder auf denselben begrifflichen Irrtum
wie in der Frage des Materials: die Erscheinungsform einer be-
stimmten Stilart wird für eine absolute Regel der Baukunst ge-
halten. Im Tempelbau der Griechen, in der Gewölbebildung und dem
Verlauf der Dienste und Rippen des gotischen Kirchenschiffes vollzieht
sich zwar scheinbar die Gestaltung und Darstellung der statischen und
dynamischen Verhältnisse, sie ist aber selbst in diesen Baustilepochen
nur eines der Ausdrucksmittel der Baukunst, keineswegs- das
einzige. Denken wir aber etwa an ägyptische Säulenhallen, an byzan-
tinische Kuppelbauten, an mohammedanische Flächenbauten, an barocke
Kirchen- und Profanbauten, so sehen wir, daß dieses Problem für die
eben genannten Stilarten überhaupt nicht existiert. (Daher ist nichts
verfehlter als die Verallgemeinerung dieses Spezialfalles als eines angeb-
lichen Grundgesetzes der Baukunst: zur Motivierung sogenannter
»konstruktivistischer« Fassaden und Raumbildungen bei pseudomo-
dernen Bauten, in Wirklichkeit ein Verzicht auf die wahre Souveränität
der Gestaltung und eine Degradierung des Baukünstlers zum Ingenieur
subalterner Stufe.)
3. So einfach sich hier die Irrtümlichkeit der von ganz bestimmten
einmaligen stilistischen Voraussetzungen ausgehenden Materialästhetik
und dynamischen Ästhetik nachweisen ließ, so kompliziert gestaltet
sich diese Frage im dritten Fall:
Zweck und Funktion der Räume in der Realität im weitesten Sinne,
also auch z. B. beim Denkmal der Zweck der Betrachtung und des
Erinnerns, bilden natürlich das Thema der Architektur. Doch sie selbst
sind nicht unmittelbar Objekt der Gestaltung, sondern erst die zeit-
liche Zweckfunktion in ihrer räumlichen Fixierung. Die Be-
gründung, die ich an anderer Stelle gab (vgl. Zucker: Zeitbegriff in
der Architektur) soll hier nicht wiederholt werden. Anstatt dessen ein
Beispiel:
Nicht sind bei der katholischen Kirche die Räume für Klerikerschaft
und Laienschaft, nicht beim Warenhaus der Verkaufsraum das Objekt
der Gestaltung, sondern in der Kirche die Zeremonie der Messe, das
ihrer Wahl und in der Behandlung der Einzelmaterialien die Möglichkeit
subjektiven Schaffens. Ein neueres Beispiel für subjektive Wahl und
subjektive Behandlung eines Materials: die Glasarchitektur Max Tauts
und die völlig neuartige Eisenbetonbehandlung jüngerer holländischer
Baumeister.
2. Die Auseinandersetzung zwischen Stütze und Last, die Kenn-
zeichnung des statischen Zustandes und dynamischen Kräfteverlaufes
ist nach Bötticher (Tektonik der Hellenen), in gewissem Sinne auch
nach Ungewitters Auffassung der Gotik, Thema und Inhalt der Bau-
kunst. Auch hier stoßen wir wieder auf denselben begrifflichen Irrtum
wie in der Frage des Materials: die Erscheinungsform einer be-
stimmten Stilart wird für eine absolute Regel der Baukunst ge-
halten. Im Tempelbau der Griechen, in der Gewölbebildung und dem
Verlauf der Dienste und Rippen des gotischen Kirchenschiffes vollzieht
sich zwar scheinbar die Gestaltung und Darstellung der statischen und
dynamischen Verhältnisse, sie ist aber selbst in diesen Baustilepochen
nur eines der Ausdrucksmittel der Baukunst, keineswegs- das
einzige. Denken wir aber etwa an ägyptische Säulenhallen, an byzan-
tinische Kuppelbauten, an mohammedanische Flächenbauten, an barocke
Kirchen- und Profanbauten, so sehen wir, daß dieses Problem für die
eben genannten Stilarten überhaupt nicht existiert. (Daher ist nichts
verfehlter als die Verallgemeinerung dieses Spezialfalles als eines angeb-
lichen Grundgesetzes der Baukunst: zur Motivierung sogenannter
»konstruktivistischer« Fassaden und Raumbildungen bei pseudomo-
dernen Bauten, in Wirklichkeit ein Verzicht auf die wahre Souveränität
der Gestaltung und eine Degradierung des Baukünstlers zum Ingenieur
subalterner Stufe.)
3. So einfach sich hier die Irrtümlichkeit der von ganz bestimmten
einmaligen stilistischen Voraussetzungen ausgehenden Materialästhetik
und dynamischen Ästhetik nachweisen ließ, so kompliziert gestaltet
sich diese Frage im dritten Fall:
Zweck und Funktion der Räume in der Realität im weitesten Sinne,
also auch z. B. beim Denkmal der Zweck der Betrachtung und des
Erinnerns, bilden natürlich das Thema der Architektur. Doch sie selbst
sind nicht unmittelbar Objekt der Gestaltung, sondern erst die zeit-
liche Zweckfunktion in ihrer räumlichen Fixierung. Die Be-
gründung, die ich an anderer Stelle gab (vgl. Zucker: Zeitbegriff in
der Architektur) soll hier nicht wiederholt werden. Anstatt dessen ein
Beispiel:
Nicht sind bei der katholischen Kirche die Räume für Klerikerschaft
und Laienschaft, nicht beim Warenhaus der Verkaufsraum das Objekt
der Gestaltung, sondern in der Kirche die Zeremonie der Messe, das