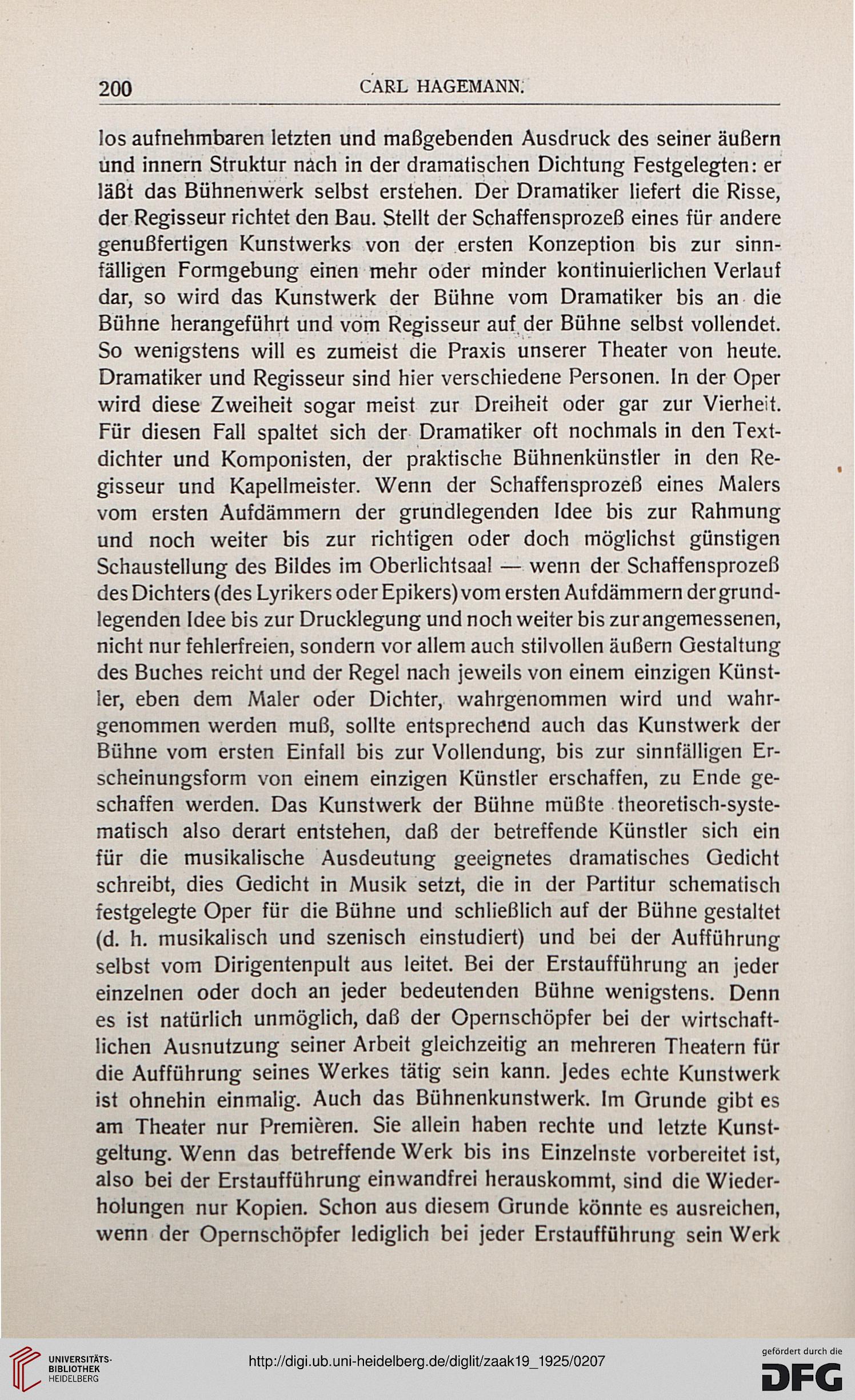200 CARL HAGEMANN;
los aufnehmbaren letzten und maßgebenden Ausdruck des seiner äußern
und innern Struktur nach in der dramatischen Dichtung Festgelegten: er
läßt das Bühnenwerk selbst erstehen. Der Dramatiker liefert die Risse,
der Regisseur richtet den Bau. Stellt der Schaffensprozeß eines für andere
genußfertigen Kunstwerks von der ersten Konzeption bis zur sinn-
fälligen Formgebung einen mehr oder minder kontinuierlichen Verlauf
dar, so wird das Kunstwerk der Bühne vom Dramatiker bis an die
Bühne herangeführt und vom Regisseur auf. der Bühne selbst vollendet.
So wenigstens will es zumeist die Praxis unserer Theater von heute.
Dramatiker und Regisseur sind hier verschiedene Personen. In der Oper
wird diese Zweiheit sogar meist zur Dreiheit oder gar zur Vierheit.
Für diesen Fall spaltet sich der Dramatiker oft nochmals in den Text-
dichter und Komponisten, der praktische Bühnenkünstler in den Re-
gisseur und Kapellmeister. Wenn der Schaffensprozeß eines Malers
vom ersten Aufdämmern der grundlegenden Idee bis zur Rahmung
und noch weiter bis zur richtigen oder doch möglichst günstigen
Schaustellung des Bildes im Oberlichtsaal — wenn der Schaffensprozeß
des Dichters (des Lyrikers oder Epikers) vom ersten Aufdämmern der grund-
legenden Idee bis zur Drucklegung und noch weiter bis zurangemessenen,
nicht nur fehlerfreien, sondern vor allem auch stilvollen äußern Gestaltung
des Buches reicht und der Regel nach jeweils von einem einzigen Künst-
ler, eben dem Maler oder Dichter, wahrgenommen wird und wahr-
genommen werden muß, sollte entsprechend auch das Kunstwerk der
Bühne vom ersten Einfall bis zur Vollendung, bis zur sinnfälligen Er-
scheinungsform von einem einzigen Künstler erschaffen, zu Ende ge-
schaffen werden. Das Kunstwerk der Bühne müßte theoretisch-syste-
matisch also derart entstehen, daß der betreffende Künstler sich ein
für die musikalische Ausdeutung geeignetes dramatisches Gedicht
schreibt, dies Gedicht in Musik setzt, die in der Partitur schematisch
festgelegte Oper für die Bühne und schließlich auf der Bühne gestaltet
(d. h. musikalisch und szenisch einstudiert) und bei der Aufführung
selbst vom Dirigentenpult aus leitet. Bei der Erstaufführung an jeder
einzelnen oder doch an jeder bedeutenden Bühne wenigstens. Denn
es ist natürlich unmöglich, daß der Opernschöpfer bei der wirtschaft-
lichen Ausnutzung seiner Arbeit gleichzeitig an mehreren Theatern für
die Aufführung seines Werkes tätig sein kann. Jedes echte Kunstwerk
ist ohnehin einmalig. Auch das Bühnenkunstwerk. Im Grunde gibt es
am Theater nur Premieren. Sie allein haben rechte und letzte Kunst-
geltung. Wenn das betreffende Werk bis ins Einzelnste vorbereitet ist,
also bei der Erstaufführung einwandfrei herauskommt, sind die Wieder-
holungen nur Kopien. Schon aus diesem Grunde könnte es ausreichen,
wenn der Opernschöpfer lediglich bei jeder Erstaufführung sein Werk
los aufnehmbaren letzten und maßgebenden Ausdruck des seiner äußern
und innern Struktur nach in der dramatischen Dichtung Festgelegten: er
läßt das Bühnenwerk selbst erstehen. Der Dramatiker liefert die Risse,
der Regisseur richtet den Bau. Stellt der Schaffensprozeß eines für andere
genußfertigen Kunstwerks von der ersten Konzeption bis zur sinn-
fälligen Formgebung einen mehr oder minder kontinuierlichen Verlauf
dar, so wird das Kunstwerk der Bühne vom Dramatiker bis an die
Bühne herangeführt und vom Regisseur auf. der Bühne selbst vollendet.
So wenigstens will es zumeist die Praxis unserer Theater von heute.
Dramatiker und Regisseur sind hier verschiedene Personen. In der Oper
wird diese Zweiheit sogar meist zur Dreiheit oder gar zur Vierheit.
Für diesen Fall spaltet sich der Dramatiker oft nochmals in den Text-
dichter und Komponisten, der praktische Bühnenkünstler in den Re-
gisseur und Kapellmeister. Wenn der Schaffensprozeß eines Malers
vom ersten Aufdämmern der grundlegenden Idee bis zur Rahmung
und noch weiter bis zur richtigen oder doch möglichst günstigen
Schaustellung des Bildes im Oberlichtsaal — wenn der Schaffensprozeß
des Dichters (des Lyrikers oder Epikers) vom ersten Aufdämmern der grund-
legenden Idee bis zur Drucklegung und noch weiter bis zurangemessenen,
nicht nur fehlerfreien, sondern vor allem auch stilvollen äußern Gestaltung
des Buches reicht und der Regel nach jeweils von einem einzigen Künst-
ler, eben dem Maler oder Dichter, wahrgenommen wird und wahr-
genommen werden muß, sollte entsprechend auch das Kunstwerk der
Bühne vom ersten Einfall bis zur Vollendung, bis zur sinnfälligen Er-
scheinungsform von einem einzigen Künstler erschaffen, zu Ende ge-
schaffen werden. Das Kunstwerk der Bühne müßte theoretisch-syste-
matisch also derart entstehen, daß der betreffende Künstler sich ein
für die musikalische Ausdeutung geeignetes dramatisches Gedicht
schreibt, dies Gedicht in Musik setzt, die in der Partitur schematisch
festgelegte Oper für die Bühne und schließlich auf der Bühne gestaltet
(d. h. musikalisch und szenisch einstudiert) und bei der Aufführung
selbst vom Dirigentenpult aus leitet. Bei der Erstaufführung an jeder
einzelnen oder doch an jeder bedeutenden Bühne wenigstens. Denn
es ist natürlich unmöglich, daß der Opernschöpfer bei der wirtschaft-
lichen Ausnutzung seiner Arbeit gleichzeitig an mehreren Theatern für
die Aufführung seines Werkes tätig sein kann. Jedes echte Kunstwerk
ist ohnehin einmalig. Auch das Bühnenkunstwerk. Im Grunde gibt es
am Theater nur Premieren. Sie allein haben rechte und letzte Kunst-
geltung. Wenn das betreffende Werk bis ins Einzelnste vorbereitet ist,
also bei der Erstaufführung einwandfrei herauskommt, sind die Wieder-
holungen nur Kopien. Schon aus diesem Grunde könnte es ausreichen,
wenn der Opernschöpfer lediglich bei jeder Erstaufführung sein Werk