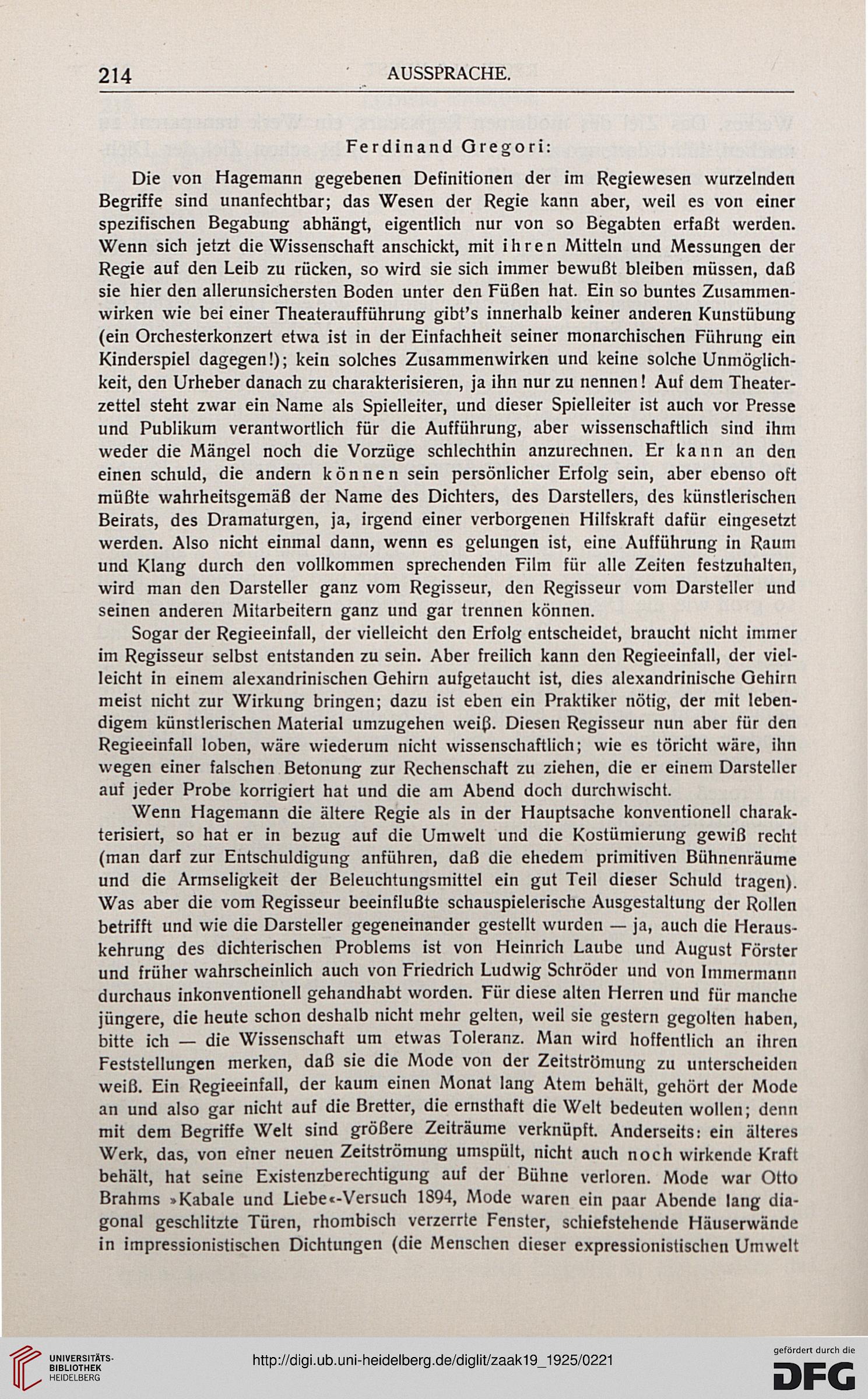214 AUSSPRACHE.
Ferdinand Gregori:
Die von Hagemann gegebenen Definitionen der im Regiewesen wurzelnden
Begriffe sind unanfechtbar; das Wesen der Regie kann aber, weil es von einer
spezifischen Begabung abhängt, eigentlich nur von so Begabten erfaßt werden.
Wenn sich jetzt die Wissenschaft anschickt, mit ihren Mitteln und Messungen der
Regie auf den Leib zu rücken, so wird sie sich immer bewußt bleiben müssen, daß
sie hier den allerunsichersten Boden unter den Füßen hat. Ein so buntes Zusammen-
wirken wie bei einer Theateraufführung gibt's innerhalb keiner anderen Kunstübung
(ein Orchesterkonzert etwa ist in der Einfachheit seiner monarchischen Führung ein
Kinderspiel dagegen!); kein solches Zusammenwirken und keine solche Unmöglich-
keit, den Urheber danach zu charakterisieren, ja ihn nur zu nennen! Auf dem Theater-
zettel steht zwar ein Name als Spielleiter, und dieser Spielleiter ist auch vor Presse
und Publikum verantwortlich für die Aufführung, aber wissenschaftlich sind ihm
weder die Mängel noch die Vorzüge schlechthin anzurechnen. Er kann an den
einen schuld, die andern können sein persönlicher Erfolg sein, aber ebenso oft
müßte wahrheitsgemäß der Name des Dichters, des Darstellers, des künstlerischen
Beirats, des Dramaturgen, ja, irgend einer verborgenen Hilfskraft dafür eingesetzt
werden. Also nicht einmal dann, wenn es gelungen ist, eine Aufführung in Raum
und Klang durch den vollkommen sprechenden Film für alle Zeiten festzuhalten,
wird man den Darsteller ganz vom Regisseur, den Regisseur vom Darsteller und
seinen anderen Mitarbeitern ganz und gar trennen können.
Sogar der Regieeinfall, der vielleicht den Erfolg entscheidet, braucht nicht immer
im Regisseur selbst entstanden zu sein. Aber freilich kann den Regieeinfall, der viel-
leicht in einem alexandrinischen Gehirn aufgetaucht ist, dies alexandrinische Gehirn
meist nicht zur Wirkung bringen; dazu ist eben ein Praktiker nötig, der mit leben-
digem künstlerischen Material umzugehen weiß. Diesen Regisseur nun aber für den
Regieeinfall loben, wäre wiederum nicht wissenschaftlich; wie es töricht wäre, ihn
wegen einer falschen Betonung zur Rechenschaft zu ziehen, die er einem Darsteller
auf jeder Probe korrigiert hat und die am Abend doch durchwischt.
Wenn Hagemann die ältere Regie als in der Hauptsache konventionell charak-
terisiert, so hat er in bezug auf die Umwelt und die Kostümierung gewiß recht
(man darf zur Entschuldigung anführen, daß die ehedem primitiven Bühnenräume
und die Armseligkeit der Beleuchtungsmittel ein gut Teil dieser Schuld tragen).
Was aber die vom Regisseur beeinflußte schauspielerische Ausgestaltung der Rollen
betrifft und wie die Darsteller gegeneinander gestellt wurden — ja, auch die Heraus-
kehrung des dichterischen Problems ist von Heinrich Laube und August Förster
und früher wahrscheinlich auch von Friedrich Ludwig Schröder und von Immermann
durchaus inkonventionell gehandhabt worden. Für diese alten Herren und für manche
jüngere, die heute schon deshalb nicht mehr gelten, weil sie gestern gegolten haben,
bitte ich — die Wissenschaft um etwas Toleranz. Man wird hoffentlich an ihren
Feststellungen merken, daß sie die Mode von der Zeitströmung zu unterscheiden
weiß. Ein Regieeinfall, der kaum einen Monat lang Atem behält, gehört der Mode
an und also gar nicht auf die Bretter, die ernsthaft die Welt bedeuten wollen; denn
mit dem Begriffe Welt sind größere Zeiträume verknüpft. Anderseits: ein älteres
Werk, das, von einer neuen Zeitströmung umspült, nicht auch noch wirkende Kraft
behält, hat seine Existenzberechtigung auf der Bühne verloren. Mode war Otto
Brahms »Kabale und Liebe«-Versuch 1894, Mode waren ein paar Abende lang dia-
gonal geschlitzte Türen, rhombisch verzerrte Fenster, schiefstehende Häuserwände
in impressionistischen Dichtungen (die Menschen dieser expressionistischen Umwelt
Ferdinand Gregori:
Die von Hagemann gegebenen Definitionen der im Regiewesen wurzelnden
Begriffe sind unanfechtbar; das Wesen der Regie kann aber, weil es von einer
spezifischen Begabung abhängt, eigentlich nur von so Begabten erfaßt werden.
Wenn sich jetzt die Wissenschaft anschickt, mit ihren Mitteln und Messungen der
Regie auf den Leib zu rücken, so wird sie sich immer bewußt bleiben müssen, daß
sie hier den allerunsichersten Boden unter den Füßen hat. Ein so buntes Zusammen-
wirken wie bei einer Theateraufführung gibt's innerhalb keiner anderen Kunstübung
(ein Orchesterkonzert etwa ist in der Einfachheit seiner monarchischen Führung ein
Kinderspiel dagegen!); kein solches Zusammenwirken und keine solche Unmöglich-
keit, den Urheber danach zu charakterisieren, ja ihn nur zu nennen! Auf dem Theater-
zettel steht zwar ein Name als Spielleiter, und dieser Spielleiter ist auch vor Presse
und Publikum verantwortlich für die Aufführung, aber wissenschaftlich sind ihm
weder die Mängel noch die Vorzüge schlechthin anzurechnen. Er kann an den
einen schuld, die andern können sein persönlicher Erfolg sein, aber ebenso oft
müßte wahrheitsgemäß der Name des Dichters, des Darstellers, des künstlerischen
Beirats, des Dramaturgen, ja, irgend einer verborgenen Hilfskraft dafür eingesetzt
werden. Also nicht einmal dann, wenn es gelungen ist, eine Aufführung in Raum
und Klang durch den vollkommen sprechenden Film für alle Zeiten festzuhalten,
wird man den Darsteller ganz vom Regisseur, den Regisseur vom Darsteller und
seinen anderen Mitarbeitern ganz und gar trennen können.
Sogar der Regieeinfall, der vielleicht den Erfolg entscheidet, braucht nicht immer
im Regisseur selbst entstanden zu sein. Aber freilich kann den Regieeinfall, der viel-
leicht in einem alexandrinischen Gehirn aufgetaucht ist, dies alexandrinische Gehirn
meist nicht zur Wirkung bringen; dazu ist eben ein Praktiker nötig, der mit leben-
digem künstlerischen Material umzugehen weiß. Diesen Regisseur nun aber für den
Regieeinfall loben, wäre wiederum nicht wissenschaftlich; wie es töricht wäre, ihn
wegen einer falschen Betonung zur Rechenschaft zu ziehen, die er einem Darsteller
auf jeder Probe korrigiert hat und die am Abend doch durchwischt.
Wenn Hagemann die ältere Regie als in der Hauptsache konventionell charak-
terisiert, so hat er in bezug auf die Umwelt und die Kostümierung gewiß recht
(man darf zur Entschuldigung anführen, daß die ehedem primitiven Bühnenräume
und die Armseligkeit der Beleuchtungsmittel ein gut Teil dieser Schuld tragen).
Was aber die vom Regisseur beeinflußte schauspielerische Ausgestaltung der Rollen
betrifft und wie die Darsteller gegeneinander gestellt wurden — ja, auch die Heraus-
kehrung des dichterischen Problems ist von Heinrich Laube und August Förster
und früher wahrscheinlich auch von Friedrich Ludwig Schröder und von Immermann
durchaus inkonventionell gehandhabt worden. Für diese alten Herren und für manche
jüngere, die heute schon deshalb nicht mehr gelten, weil sie gestern gegolten haben,
bitte ich — die Wissenschaft um etwas Toleranz. Man wird hoffentlich an ihren
Feststellungen merken, daß sie die Mode von der Zeitströmung zu unterscheiden
weiß. Ein Regieeinfall, der kaum einen Monat lang Atem behält, gehört der Mode
an und also gar nicht auf die Bretter, die ernsthaft die Welt bedeuten wollen; denn
mit dem Begriffe Welt sind größere Zeiträume verknüpft. Anderseits: ein älteres
Werk, das, von einer neuen Zeitströmung umspült, nicht auch noch wirkende Kraft
behält, hat seine Existenzberechtigung auf der Bühne verloren. Mode war Otto
Brahms »Kabale und Liebe«-Versuch 1894, Mode waren ein paar Abende lang dia-
gonal geschlitzte Türen, rhombisch verzerrte Fenster, schiefstehende Häuserwände
in impressionistischen Dichtungen (die Menschen dieser expressionistischen Umwelt