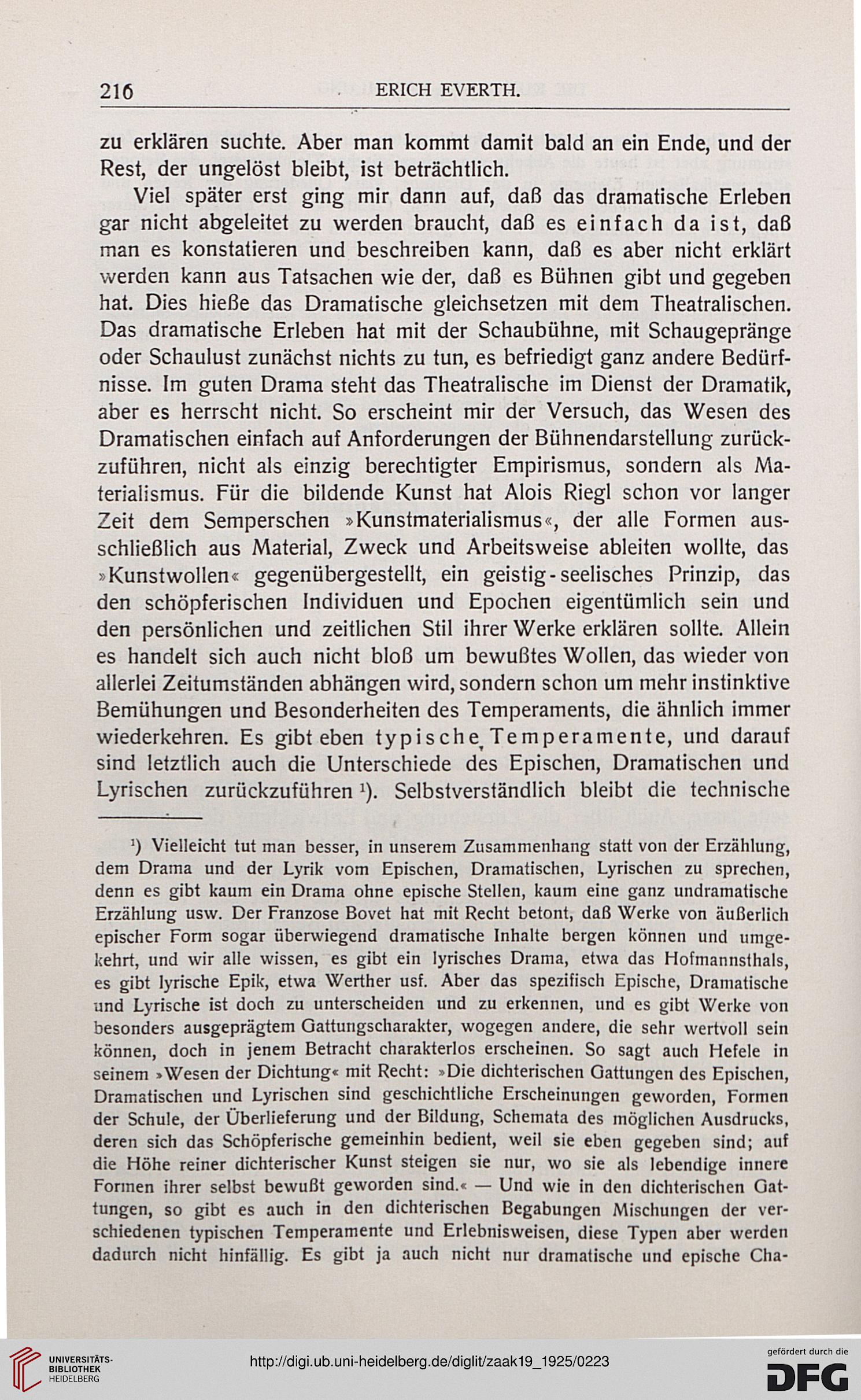216 ERICH EVERTH.
zu erklären suchte. Aber man kommt damit bald an ein Ende, und der
Rest, der ungelöst bleibt, ist beträchtlich.
Viel später erst ging mir dann auf, daß das dramatische Erleben
gar nicht abgeleitet zu werden braucht, daß es einfach da ist, daß
man es konstatieren und beschreiben kann, daß es aber nicht erklärt
werden kann aus Tatsachen wie der, daß es Bühnen gibt und gegeben
hat. Dies hieße das Dramatische gleichsetzen mit dem Theatralischen.
Das dramatische Erleben hat mit der Schaubühne, mit Schaugepränge
oder Schaulust zunächst nichts zu tun, es befriedigt ganz andere Bedürf-
nisse. Im guten Drama steht das Theatralische im Dienst der Dramatik,
aber es herrscht nicht. So erscheint mir der Versuch, das Wesen des
Dramatischen einfach auf Anforderungen der Bühnendarstellung zurück-
zuführen, nicht als einzig berechtigter Empirismus, sondern als Ma-
terialismus. Für die bildende Kunst hat Alois Riegl schon vor langer
Zeit dem Semperschen »Kunstmaterialismus«, der alle Formen aus-
schließlich aus Material, Zweck und Arbeitsweise ableiten wollte, das
»Kunstwollen« gegenübergestellt, ein geistig-seelisches Prinzip, das
den schöpferischen Individuen und Epochen eigentümlich sein und
den persönlichen und zeitlichen Stil ihrer Werke erklären sollte. Allein
es handelt sich auch nicht bloß um bewußtes Wollen, das wieder von
allerlei Zeitumständen abhängen wird, sondern schon um mehr instinktive
Bemühungen und Besonderheiten des Temperaments, die ähnlich immer
wiederkehren. Es gibt eben typische? Temperamente, und darauf
sind letztlich auch die Unterschiede des Epischen, Dramatischen und
Lyrischen zurückzuführen*). Selbstverständlich bleibt die technische
') Vielleicht tut man besser, in unserem Zusammenhang statt von der Erzählung,
dem Drama und der Lyrik vom Epischen, Dramatischen, Lyrischen zu sprechen,
denn es gibt kaum ein Drama ohne epische Stellen, kaum eine ganz undramatische
Erzählung usw. Der Franzose Bovet hat mit Recht betont, daß Werke von äußerlich
epischer Form sogar überwiegend dramatische Inhalte bergen können und umge-
kehrt, und wir alle wissen, es gibt ein lyrisches Drama, etwa das Hofmannsthals,
es gibt lyrische Epik, etwa Werther usf. Aber das spezifisch Epische, Dramatische
und Lyrische ist doch zu unterscheiden und zu erkennen, und es gibt Werke von
besonders ausgeprägtem Gattungscharakter, wogegen andere, die sehr wertvoll sein
können, doch in jenem Betracht charakterlos erscheinen. So sagt auch Hefele in
seinem »Wesen der Dichtung« mit Recht: »Die dichterischen Gattungen des Epischen,
Dramatischen und Lyrischen sind geschichtliche Erscheinungen geworden, Formen
der Schule, der Überlieferung und der Bildung, Schemata des möglichen Ausdrucks,
deren sich das Schöpferische gemeinhin bedient, weil sie eben gegeben sind; auf
die Höhe reiner dichterischer Kunst steigen sie nur, wo sie als lebendige innere
Formen ihrer selbst bewußt geworden sind.« — Und wie in den dichterischen Gat-
tungen, so gibt es auch in den dichterischen Begabungen Mischungen der ver-
schiedenen typischen Temperamente und Erlebnisweisen, diese Typen aber werden
dadurch nicht hinfällig. Es gibt ja auch nicht nur dramatische und epische Cha-
zu erklären suchte. Aber man kommt damit bald an ein Ende, und der
Rest, der ungelöst bleibt, ist beträchtlich.
Viel später erst ging mir dann auf, daß das dramatische Erleben
gar nicht abgeleitet zu werden braucht, daß es einfach da ist, daß
man es konstatieren und beschreiben kann, daß es aber nicht erklärt
werden kann aus Tatsachen wie der, daß es Bühnen gibt und gegeben
hat. Dies hieße das Dramatische gleichsetzen mit dem Theatralischen.
Das dramatische Erleben hat mit der Schaubühne, mit Schaugepränge
oder Schaulust zunächst nichts zu tun, es befriedigt ganz andere Bedürf-
nisse. Im guten Drama steht das Theatralische im Dienst der Dramatik,
aber es herrscht nicht. So erscheint mir der Versuch, das Wesen des
Dramatischen einfach auf Anforderungen der Bühnendarstellung zurück-
zuführen, nicht als einzig berechtigter Empirismus, sondern als Ma-
terialismus. Für die bildende Kunst hat Alois Riegl schon vor langer
Zeit dem Semperschen »Kunstmaterialismus«, der alle Formen aus-
schließlich aus Material, Zweck und Arbeitsweise ableiten wollte, das
»Kunstwollen« gegenübergestellt, ein geistig-seelisches Prinzip, das
den schöpferischen Individuen und Epochen eigentümlich sein und
den persönlichen und zeitlichen Stil ihrer Werke erklären sollte. Allein
es handelt sich auch nicht bloß um bewußtes Wollen, das wieder von
allerlei Zeitumständen abhängen wird, sondern schon um mehr instinktive
Bemühungen und Besonderheiten des Temperaments, die ähnlich immer
wiederkehren. Es gibt eben typische? Temperamente, und darauf
sind letztlich auch die Unterschiede des Epischen, Dramatischen und
Lyrischen zurückzuführen*). Selbstverständlich bleibt die technische
') Vielleicht tut man besser, in unserem Zusammenhang statt von der Erzählung,
dem Drama und der Lyrik vom Epischen, Dramatischen, Lyrischen zu sprechen,
denn es gibt kaum ein Drama ohne epische Stellen, kaum eine ganz undramatische
Erzählung usw. Der Franzose Bovet hat mit Recht betont, daß Werke von äußerlich
epischer Form sogar überwiegend dramatische Inhalte bergen können und umge-
kehrt, und wir alle wissen, es gibt ein lyrisches Drama, etwa das Hofmannsthals,
es gibt lyrische Epik, etwa Werther usf. Aber das spezifisch Epische, Dramatische
und Lyrische ist doch zu unterscheiden und zu erkennen, und es gibt Werke von
besonders ausgeprägtem Gattungscharakter, wogegen andere, die sehr wertvoll sein
können, doch in jenem Betracht charakterlos erscheinen. So sagt auch Hefele in
seinem »Wesen der Dichtung« mit Recht: »Die dichterischen Gattungen des Epischen,
Dramatischen und Lyrischen sind geschichtliche Erscheinungen geworden, Formen
der Schule, der Überlieferung und der Bildung, Schemata des möglichen Ausdrucks,
deren sich das Schöpferische gemeinhin bedient, weil sie eben gegeben sind; auf
die Höhe reiner dichterischer Kunst steigen sie nur, wo sie als lebendige innere
Formen ihrer selbst bewußt geworden sind.« — Und wie in den dichterischen Gat-
tungen, so gibt es auch in den dichterischen Begabungen Mischungen der ver-
schiedenen typischen Temperamente und Erlebnisweisen, diese Typen aber werden
dadurch nicht hinfällig. Es gibt ja auch nicht nur dramatische und epische Cha-