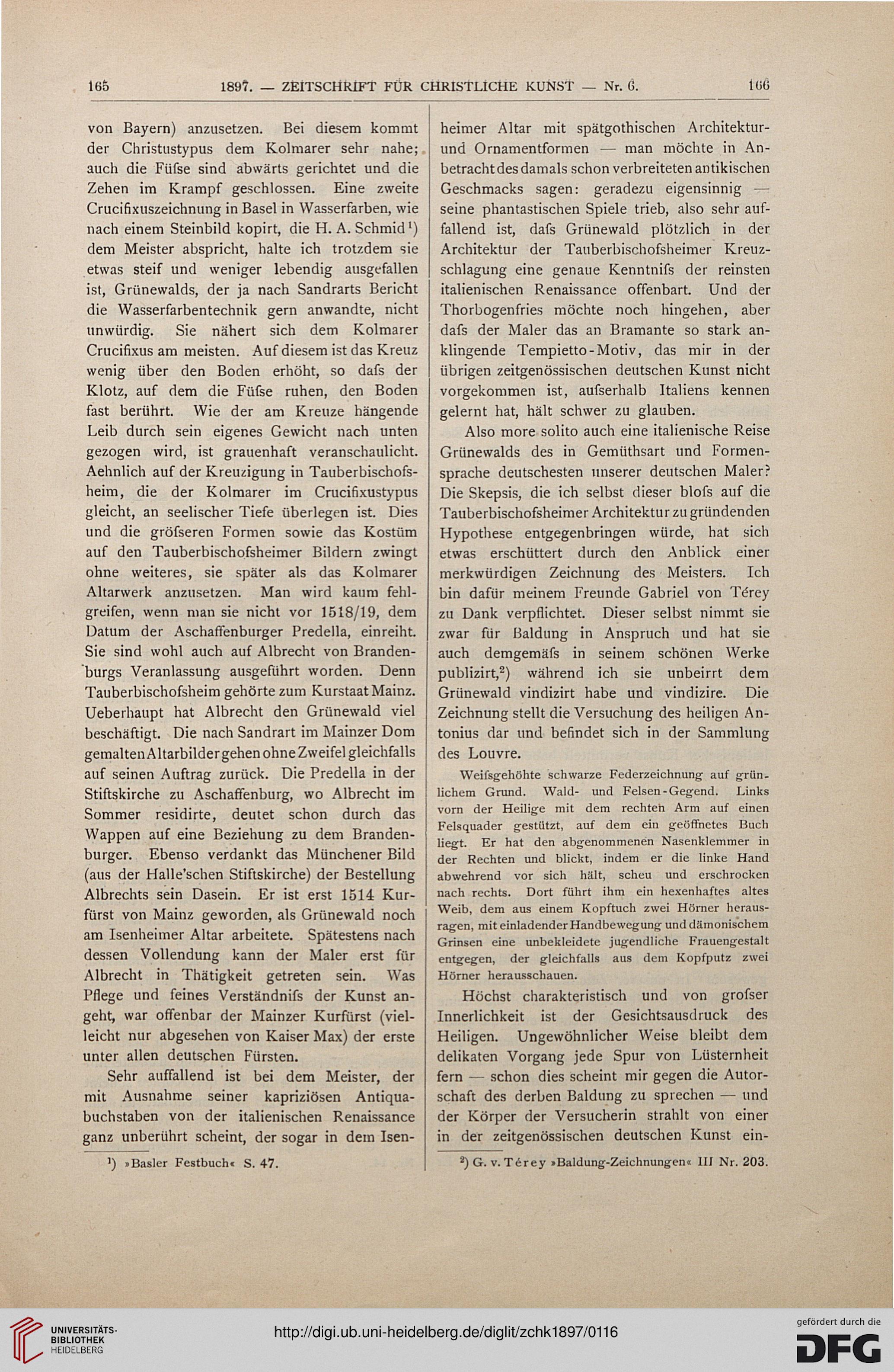16&
1897.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. G.
lue
von Bayern) anzusetzen. Bei diesem kommt
der Christustypus dem Kolmarer sehr nahe;
auch die Füfse sind abwärts gerichtet und die
Zehen im Krampf geschlossen. Eine zweite
Crucifixuszeichnung in Basel in Wasserfarben, wie
nach einem Steinbild kopirt, die H. A. Schmid1)
dem Meister abspricht, halte ich trotzdem sie
etwas steif und weniger lebendig ausgefallen
ist, Grünewalds, der ja nach Sandrarts Bericht
die Wasserfarbentechnik gern anwandte, nicht
unwürdig. Sie nähert sich dem Kolmarer
Crucifixus am meisten. Auf diesem ist das Kreuz
wenig über den Boden erhöht, so dafs der
Klotz, auf dem die Füfse ruhen, den Boden
fast berührt. Wie der am Kreuze hängende
Leib durch sein eigenes Gewicht nach unten
gezogen wird, ist grauenhaft veranschaulicht.
Aehnlich auf der Kreuzigung in Tauberbischofs-
heim, die der Kolmarer im Crucifixustypus
gleicht, an seelischer Tiefe überlegen ist. Dies
und die gröfseren Formen sowie das Kostüm
auf den Tauberbischofsheimer Bildern zwingt
ohne weiteres, sie später als das Kolmarer
Altarwerk anzusetzen. Man wird kaum fehl-
greifen, wenn man sie nicht vor 1518/19, dem
Datum der Aschaffenburger Predella, einreiht.
Sie sind wohl auch auf Albrecht von Branden-
burgs Veranlassung ausgeführt worden. Denn
Tauberbischofsheim gehörte zum Kurstaat Mainz.
Ueberhaupt hat Albrecht den Grünewald viel
beschäftigt. Die nach Sandrart im Mainzer Dom
gemalten Altarbilder gehen ohne Zweifel gleichfalls
auf seinen Auftrag zurück. Die Predella in der
Stiftskirche zu Aschaffenburg, wo Albrecht im
Sommer residirte, deutet schon durch das
Wappen auf eine Beziehung zu dem Branden-
burger. Ebenso verdankt das Münchener Bild
(aus der Halle'schen Stiftskirche) der Bestellung
Albrechts sein Dasein. Er ist erst 1514 Kur-
fürst von Mainz geworden, als Grünewald noch
am Isenheimer Altar arbeitete. Spätestens nach
dessen Vollendung kann der Maler erst für
Albrecht in Thätigkeit getreten sein. Was
Pflege und feines Verständnifs der Kunst an-
geht, war offenbar der Mainzer Kurfürst (viel-
leicht nur abgesehen von Kaiser Max) der erste
unter allen deutschen Fürsten.
Sehr auffallend ist bei dem Meister, der
mit Ausnahme seiner kapriziösen Antiqua-
buchstaben von der italienischen Renaissance
ganz unberührt scheint, der sogar in dem Isen-
]) »Basler Festbuch« S. 47.
heimer Altar mit spätgothischen Architektur-
und Ornamentformen — man möchte in An-
betracht des damals schon verbreiteten antikischen
Geschmacks sagen: geradezu eigensinnig —
seine phantastischen Spiele trieb, also sehr auf-
fallend ist, dafs Grünewald plötzlich in der
Architektur der Tauberbischofsheimer Kreuz-
schlagung eine genaue Kenntnifs der reinsten
italienischen Renaissance offenbart. Und der
Thorbogenfries möchte noch hingehen, aber
dafs der Maler das an Bramante so stark an-
klingende Tempietto-Motiv, das mir in der
übrigen zeitgenössischen deutschen Kunst nicht
vorgekommen ist, aufserhalb Italiens kennen
gelernt hat, hält schwer zu glauben.
Also more solito auch eine italienische Reise
Grünewalds des in Gemüthsart und Formen-
sprache deutschesten unserer deutschen Maler?
Die Skepsis, die ich selbst dieser blofs auf die
Tauberbischofsheimer Architektur zu gründenden
Hypothese entgegenbringen würde, hat sich
etwas erschüttert durch den Anblick einer
merkwürdigen Zeichnung des Meisters. Ich
bin dafür meinem Freunde Gabriel von Te"rey
zu Dank verpflichtet. Dieser selbst nimmt sie
zwar für Baidung in Anspruch und hat sie
auch demgemäfs in seinem schönen Werke
publizirt,2) während ich sie unbeirrt dem
Grunewald vindizirt habe und vindizire. Die
Zeichnung stellt die Versuchung des heiligen An-
tonius dar und befindet sich in der Sammlung
des Louvre.
Weifsgehöhte schwarze Federzeichnung auf grün,
lichem Grund. Wald- und Felsen-Gegend. Links
vorn der Heilige mit dem rechten Arm auf einen
Felsquader gestützt, auf dem ein geöffnetes Buch
liegt. Er hat den abgenommenen Nasenklemmer in
der Rechten und blickt, indem er die linke Hand
abwehrend vor sich hält, scheu und erschrocken
nach rechts. Dort führt ihm ein hexenhaftes altes
Weib, dem aus einem Kopftuch zwei Hörner heraus-
ragen, mit einladender Hand bewegung und dämonischem
Grinsen eine unbekleidete jugendliche Frauengestalt
entgegen, der gleichfalls aus dem Kopfputz zwei
Hörner herausschauen.
Höchst charakteristisch und von grofser
Innerlichkeit ist der Gesichtsausdruck des
Heiligen. Ungewöhnlicher Weise bleibt dem
delikaten Vorgang jede Spur von Lüsternheit
fern — schon dies scheint mir gegen die Autor-
schaft des derben Baidung zu sprechen — und
der Körper der Versucherin strahlt von einer
in der zeitgenössischen deutschen Kunst ein-
*)G. v.Terey »Baldung-Zeichnungen« III Nr. 203.
1897.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. G.
lue
von Bayern) anzusetzen. Bei diesem kommt
der Christustypus dem Kolmarer sehr nahe;
auch die Füfse sind abwärts gerichtet und die
Zehen im Krampf geschlossen. Eine zweite
Crucifixuszeichnung in Basel in Wasserfarben, wie
nach einem Steinbild kopirt, die H. A. Schmid1)
dem Meister abspricht, halte ich trotzdem sie
etwas steif und weniger lebendig ausgefallen
ist, Grünewalds, der ja nach Sandrarts Bericht
die Wasserfarbentechnik gern anwandte, nicht
unwürdig. Sie nähert sich dem Kolmarer
Crucifixus am meisten. Auf diesem ist das Kreuz
wenig über den Boden erhöht, so dafs der
Klotz, auf dem die Füfse ruhen, den Boden
fast berührt. Wie der am Kreuze hängende
Leib durch sein eigenes Gewicht nach unten
gezogen wird, ist grauenhaft veranschaulicht.
Aehnlich auf der Kreuzigung in Tauberbischofs-
heim, die der Kolmarer im Crucifixustypus
gleicht, an seelischer Tiefe überlegen ist. Dies
und die gröfseren Formen sowie das Kostüm
auf den Tauberbischofsheimer Bildern zwingt
ohne weiteres, sie später als das Kolmarer
Altarwerk anzusetzen. Man wird kaum fehl-
greifen, wenn man sie nicht vor 1518/19, dem
Datum der Aschaffenburger Predella, einreiht.
Sie sind wohl auch auf Albrecht von Branden-
burgs Veranlassung ausgeführt worden. Denn
Tauberbischofsheim gehörte zum Kurstaat Mainz.
Ueberhaupt hat Albrecht den Grünewald viel
beschäftigt. Die nach Sandrart im Mainzer Dom
gemalten Altarbilder gehen ohne Zweifel gleichfalls
auf seinen Auftrag zurück. Die Predella in der
Stiftskirche zu Aschaffenburg, wo Albrecht im
Sommer residirte, deutet schon durch das
Wappen auf eine Beziehung zu dem Branden-
burger. Ebenso verdankt das Münchener Bild
(aus der Halle'schen Stiftskirche) der Bestellung
Albrechts sein Dasein. Er ist erst 1514 Kur-
fürst von Mainz geworden, als Grünewald noch
am Isenheimer Altar arbeitete. Spätestens nach
dessen Vollendung kann der Maler erst für
Albrecht in Thätigkeit getreten sein. Was
Pflege und feines Verständnifs der Kunst an-
geht, war offenbar der Mainzer Kurfürst (viel-
leicht nur abgesehen von Kaiser Max) der erste
unter allen deutschen Fürsten.
Sehr auffallend ist bei dem Meister, der
mit Ausnahme seiner kapriziösen Antiqua-
buchstaben von der italienischen Renaissance
ganz unberührt scheint, der sogar in dem Isen-
]) »Basler Festbuch« S. 47.
heimer Altar mit spätgothischen Architektur-
und Ornamentformen — man möchte in An-
betracht des damals schon verbreiteten antikischen
Geschmacks sagen: geradezu eigensinnig —
seine phantastischen Spiele trieb, also sehr auf-
fallend ist, dafs Grünewald plötzlich in der
Architektur der Tauberbischofsheimer Kreuz-
schlagung eine genaue Kenntnifs der reinsten
italienischen Renaissance offenbart. Und der
Thorbogenfries möchte noch hingehen, aber
dafs der Maler das an Bramante so stark an-
klingende Tempietto-Motiv, das mir in der
übrigen zeitgenössischen deutschen Kunst nicht
vorgekommen ist, aufserhalb Italiens kennen
gelernt hat, hält schwer zu glauben.
Also more solito auch eine italienische Reise
Grünewalds des in Gemüthsart und Formen-
sprache deutschesten unserer deutschen Maler?
Die Skepsis, die ich selbst dieser blofs auf die
Tauberbischofsheimer Architektur zu gründenden
Hypothese entgegenbringen würde, hat sich
etwas erschüttert durch den Anblick einer
merkwürdigen Zeichnung des Meisters. Ich
bin dafür meinem Freunde Gabriel von Te"rey
zu Dank verpflichtet. Dieser selbst nimmt sie
zwar für Baidung in Anspruch und hat sie
auch demgemäfs in seinem schönen Werke
publizirt,2) während ich sie unbeirrt dem
Grunewald vindizirt habe und vindizire. Die
Zeichnung stellt die Versuchung des heiligen An-
tonius dar und befindet sich in der Sammlung
des Louvre.
Weifsgehöhte schwarze Federzeichnung auf grün,
lichem Grund. Wald- und Felsen-Gegend. Links
vorn der Heilige mit dem rechten Arm auf einen
Felsquader gestützt, auf dem ein geöffnetes Buch
liegt. Er hat den abgenommenen Nasenklemmer in
der Rechten und blickt, indem er die linke Hand
abwehrend vor sich hält, scheu und erschrocken
nach rechts. Dort führt ihm ein hexenhaftes altes
Weib, dem aus einem Kopftuch zwei Hörner heraus-
ragen, mit einladender Hand bewegung und dämonischem
Grinsen eine unbekleidete jugendliche Frauengestalt
entgegen, der gleichfalls aus dem Kopfputz zwei
Hörner herausschauen.
Höchst charakteristisch und von grofser
Innerlichkeit ist der Gesichtsausdruck des
Heiligen. Ungewöhnlicher Weise bleibt dem
delikaten Vorgang jede Spur von Lüsternheit
fern — schon dies scheint mir gegen die Autor-
schaft des derben Baidung zu sprechen — und
der Körper der Versucherin strahlt von einer
in der zeitgenössischen deutschen Kunst ein-
*)G. v.Terey »Baldung-Zeichnungen« III Nr. 203.