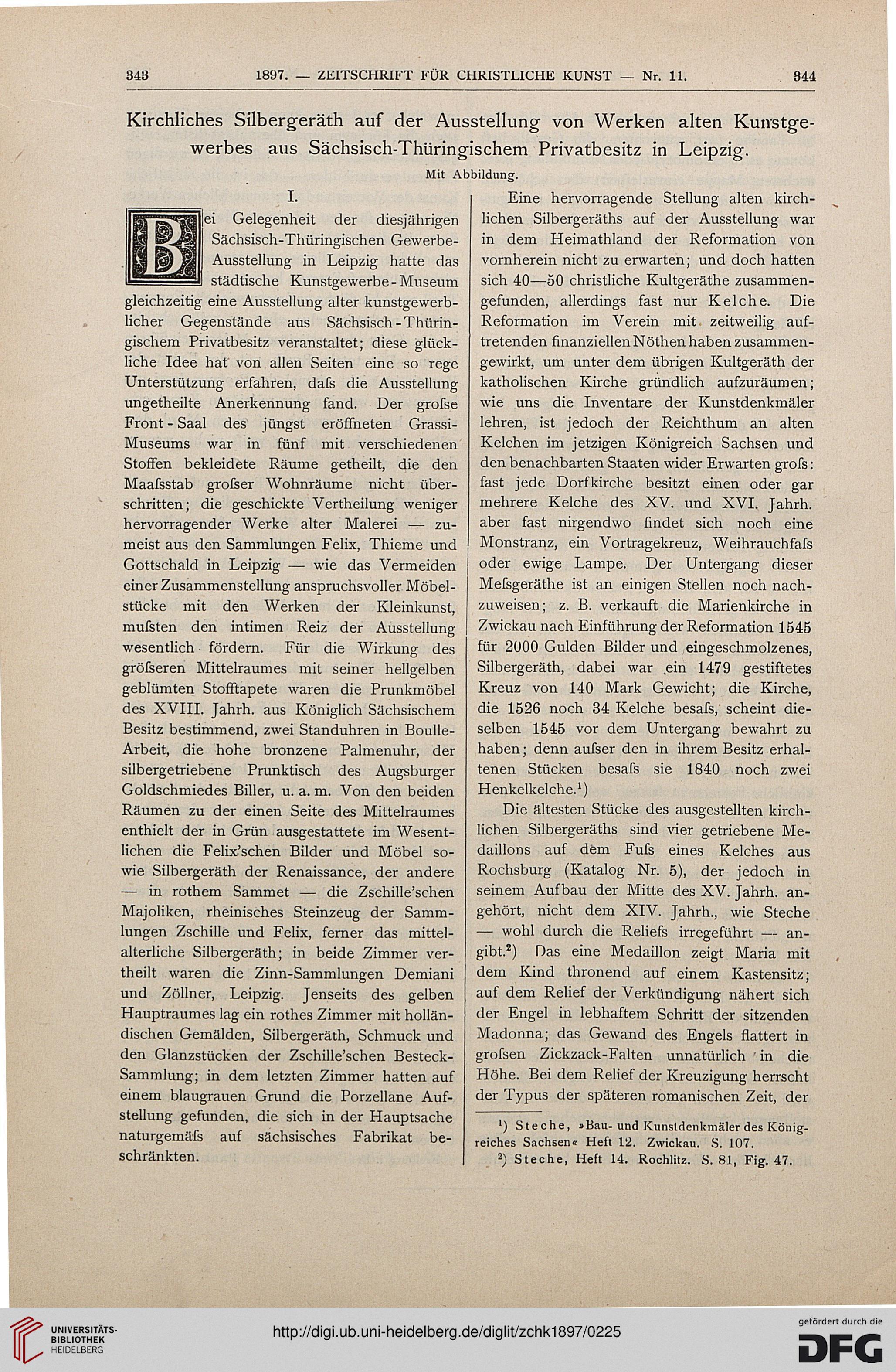843
1897.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
844
ei Gelegenheit der diesjährigen
Sächsisch-Thüringischen Gewerbe-
Ausstellung in Leipzig hatte das
städtische Kunstgewerbe - Museum
gleichzeitig eine Ausstellung alter kunstgewerb-
licher Gegenstände aus Sächsisch - Thürin-
gischem Privatbesitz veranstaltet; diese glück-
liche Idee hat von allen Seiten eine so rege
Unterstützung erfahren, dafs die Ausstellung
ungetheilte Anerkennung fand. Der grofse
Front - Saal des jüngst eröffneten Grassi-
Museums war in fünf mit verschiedenen
Stoffen bekleidete Räume getheilt, die den
Maafsstab grofser Wohnräume nicht über-
schritten; die geschickte Vertheilung weniger
hervorragender Werke alter Malerei — zu-
meist aus den Sammlungen Felix, Thieme und
Gottschald in Leipzig — wie das Vermeiden
einer Zusammenstellung anspruchsvoller Möbel-
stücke mit den Werken der Kleinkunst,
mufsten den intimen Reiz der Ausstellung
wesentlich fördern. Für die Wirkung des
gröfseren Mittelraumes mit seiner hellgelben
geblümten Stofftapete waren die Prunkmöbel
des XVIII. Jahrh. aus Königlich Sächsischem
Besitz bestimmend, zwei Standuhren in Boulle-
Arbeit, die hohe bronzene Palmenuhr, der
silbergetriebene Prunktisch des Augsburger
Goldschmiedes Biller, u. a. m. Von den beiden
Räumen zu der einen Seite des Mittelraumes
enthielt der in Grün ausgestattete im Wesent-
lichen die Felix'schen Bilder und Möbel so-
wie Silbergeräth der Renaissance, der andere
— in rothem Sammet — die Zschille'schen
Majoliken, rheinisches Steinzeug der Samm-
lungen Zschille und Felix, ferner das mittel-
alterliche Silbergeräth; in beide Zimmer ver-
theilt waren die Zinn-Sammlungen Demiani
und Zöllner, Leipzig. Jenseits des gelben
Hauptraumes lag ein rothes Zimmer mit hollän-
dischen Gemälden, Silbergeräth, Schmuck und
den Glanzstücken der Zschille'schen Besteck-
Sammlung; in dem letzten Zimmer hatten auf
einem blaugrauen Grund die Porzellane Auf-
stellung gefunden, die sich in der Hauptsache
naturgemäfs auf sächsisches Fabrikat be-
schränkten.
Kirchliches Silbergeräth auf der Ausstellung von Werken alten Kunstge-
werbes aus Sächsisch-Thüringischem Privatbesitz in Leipzig.
Mit Abbildung.
Eine hervorragende Stellung alten kirch-
lichen Silbergeräths auf der Ausstellung war
in dem Heimathland der Reformation von
vornherein nicht zu erwarten; und doch hatten
sich 40—50 christliche Kultgeräthe zusammen-
gefunden, allerdings fast nur Kelche. Die
Reformation im Verein mit. zeitweilig auf-
tretenden finanziellen Nöthen haben zusammen-
gewirkt, um unter dem übrigen Kultgeräth der
katholischen Kirche gründlich aufzuräumen;
wie uns die Inventare der Kunstdenkmäler
lehren, ist jedoch der Reichthum an alten
Kelchen im jetzigen Königreich Sachsen und
den benachbarten Staaten wider Erwarten grofs:
fast jede Dorfkirche besitzt einen oder gar
mehrere Kelche des XV. und XVI. Jahrh.
aber fast nirgendwo findet sich noch eine
Monstranz, ein Vortragekreuz, Weihrauchfafs
oder ewige Lampe. Der Untergang dieser
Mefsgeräthe ist an einigen Stellen noch nach-
zuweisen; z. B. verkauft die Marienkirche in
Zwickau nach Einführung der Reformation 1545
für 2000 Gulden Bilder und eingeschmolzenes,
Silbergeräth, dabei war .ein 1479 gestiftetes
Kreuz von 140 Mark Gewicht; die Kirche,
die 1526 noch 34 Kelche besafs,' scheint die-
selben 1545 vor dem Untergang bewahrt zu
haben; denn aufser den in ihrem Besitz erhal-
tenen Stücken besafs sie 1840 noch zwei
Henkelkelche.1)
Die ältesten Stücke des ausgestellten kirch-
lichen Silbergeräths sind vier getriebene Me-
daillons auf dem Fufs eines Kelches aus
Rochsburg (Katalog Nr. 5), der jedoch in
seinem Aufbau der Mitte des XV. Jahrh. an-
gehört, nicht dem XIV. Jahrh., wie Steche
— wohl durch die Reliefs irregeführt — an-
gibt.2) Das eine Medaillon zeigt Maria mit
dem Kind thronend auf einem Kastensitz;
auf dem Relief der Verkündigung nähert sich
der Engel in lebhaftem Schritt der sitzenden
Madonna; das Gewand des Engels flattert in
grofsen Zickzack-Falten unnatürlich ' in die
Höhe. Bei dem Relief der Kreuzigung herrscht
der Typus der späteren romanischen Zeit, der
') Steche, »Bau- und Kunsldenkmäler des König-
reiches Sachsen« Heft 1'2. Zwickau. S. 107.
2) Steche, Heft 14. Rochlitz. S. 81, Fig. 47.
1897.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
844
ei Gelegenheit der diesjährigen
Sächsisch-Thüringischen Gewerbe-
Ausstellung in Leipzig hatte das
städtische Kunstgewerbe - Museum
gleichzeitig eine Ausstellung alter kunstgewerb-
licher Gegenstände aus Sächsisch - Thürin-
gischem Privatbesitz veranstaltet; diese glück-
liche Idee hat von allen Seiten eine so rege
Unterstützung erfahren, dafs die Ausstellung
ungetheilte Anerkennung fand. Der grofse
Front - Saal des jüngst eröffneten Grassi-
Museums war in fünf mit verschiedenen
Stoffen bekleidete Räume getheilt, die den
Maafsstab grofser Wohnräume nicht über-
schritten; die geschickte Vertheilung weniger
hervorragender Werke alter Malerei — zu-
meist aus den Sammlungen Felix, Thieme und
Gottschald in Leipzig — wie das Vermeiden
einer Zusammenstellung anspruchsvoller Möbel-
stücke mit den Werken der Kleinkunst,
mufsten den intimen Reiz der Ausstellung
wesentlich fördern. Für die Wirkung des
gröfseren Mittelraumes mit seiner hellgelben
geblümten Stofftapete waren die Prunkmöbel
des XVIII. Jahrh. aus Königlich Sächsischem
Besitz bestimmend, zwei Standuhren in Boulle-
Arbeit, die hohe bronzene Palmenuhr, der
silbergetriebene Prunktisch des Augsburger
Goldschmiedes Biller, u. a. m. Von den beiden
Räumen zu der einen Seite des Mittelraumes
enthielt der in Grün ausgestattete im Wesent-
lichen die Felix'schen Bilder und Möbel so-
wie Silbergeräth der Renaissance, der andere
— in rothem Sammet — die Zschille'schen
Majoliken, rheinisches Steinzeug der Samm-
lungen Zschille und Felix, ferner das mittel-
alterliche Silbergeräth; in beide Zimmer ver-
theilt waren die Zinn-Sammlungen Demiani
und Zöllner, Leipzig. Jenseits des gelben
Hauptraumes lag ein rothes Zimmer mit hollän-
dischen Gemälden, Silbergeräth, Schmuck und
den Glanzstücken der Zschille'schen Besteck-
Sammlung; in dem letzten Zimmer hatten auf
einem blaugrauen Grund die Porzellane Auf-
stellung gefunden, die sich in der Hauptsache
naturgemäfs auf sächsisches Fabrikat be-
schränkten.
Kirchliches Silbergeräth auf der Ausstellung von Werken alten Kunstge-
werbes aus Sächsisch-Thüringischem Privatbesitz in Leipzig.
Mit Abbildung.
Eine hervorragende Stellung alten kirch-
lichen Silbergeräths auf der Ausstellung war
in dem Heimathland der Reformation von
vornherein nicht zu erwarten; und doch hatten
sich 40—50 christliche Kultgeräthe zusammen-
gefunden, allerdings fast nur Kelche. Die
Reformation im Verein mit. zeitweilig auf-
tretenden finanziellen Nöthen haben zusammen-
gewirkt, um unter dem übrigen Kultgeräth der
katholischen Kirche gründlich aufzuräumen;
wie uns die Inventare der Kunstdenkmäler
lehren, ist jedoch der Reichthum an alten
Kelchen im jetzigen Königreich Sachsen und
den benachbarten Staaten wider Erwarten grofs:
fast jede Dorfkirche besitzt einen oder gar
mehrere Kelche des XV. und XVI. Jahrh.
aber fast nirgendwo findet sich noch eine
Monstranz, ein Vortragekreuz, Weihrauchfafs
oder ewige Lampe. Der Untergang dieser
Mefsgeräthe ist an einigen Stellen noch nach-
zuweisen; z. B. verkauft die Marienkirche in
Zwickau nach Einführung der Reformation 1545
für 2000 Gulden Bilder und eingeschmolzenes,
Silbergeräth, dabei war .ein 1479 gestiftetes
Kreuz von 140 Mark Gewicht; die Kirche,
die 1526 noch 34 Kelche besafs,' scheint die-
selben 1545 vor dem Untergang bewahrt zu
haben; denn aufser den in ihrem Besitz erhal-
tenen Stücken besafs sie 1840 noch zwei
Henkelkelche.1)
Die ältesten Stücke des ausgestellten kirch-
lichen Silbergeräths sind vier getriebene Me-
daillons auf dem Fufs eines Kelches aus
Rochsburg (Katalog Nr. 5), der jedoch in
seinem Aufbau der Mitte des XV. Jahrh. an-
gehört, nicht dem XIV. Jahrh., wie Steche
— wohl durch die Reliefs irregeführt — an-
gibt.2) Das eine Medaillon zeigt Maria mit
dem Kind thronend auf einem Kastensitz;
auf dem Relief der Verkündigung nähert sich
der Engel in lebhaftem Schritt der sitzenden
Madonna; das Gewand des Engels flattert in
grofsen Zickzack-Falten unnatürlich ' in die
Höhe. Bei dem Relief der Kreuzigung herrscht
der Typus der späteren romanischen Zeit, der
') Steche, »Bau- und Kunsldenkmäler des König-
reiches Sachsen« Heft 1'2. Zwickau. S. 107.
2) Steche, Heft 14. Rochlitz. S. 81, Fig. 47.