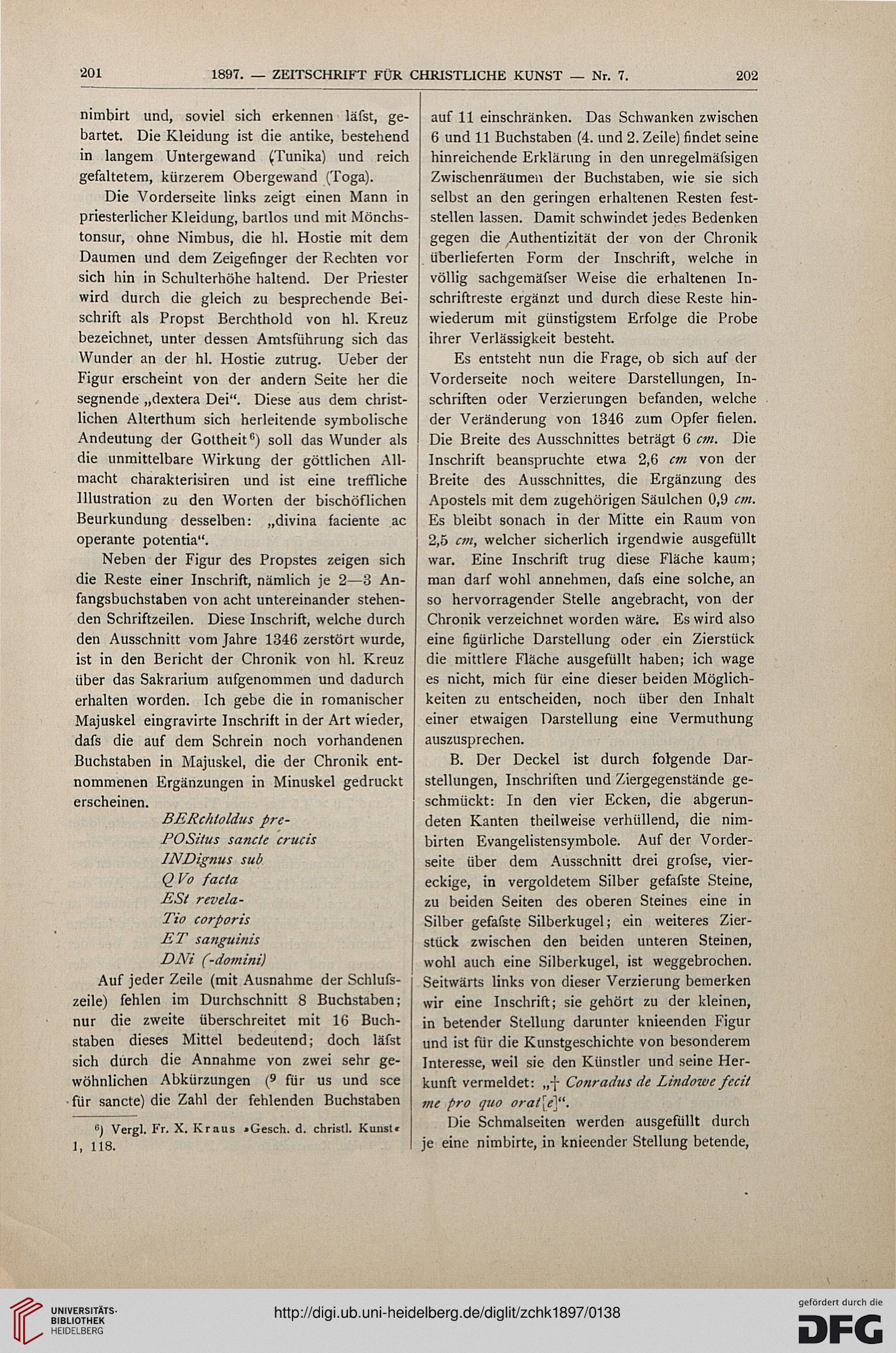201
1897. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
202
nimbirt und, soviel sich erkennen läfst, ge-
bartet. Die Kleidung ist die antike, bestehend
in langem Untergewand (Tunika) und reich
gefaltetem, kürzerem Obergewand (Toga).
Die Vorderseite links zeigt einen Mann in
priesterlicher Kleidung, bartlos und mit Mönchs-
tonsur, ohne Nimbus, die hl. Hostie mit dem
Daumen und dem Zeigefinger der Rechten vor
sich hin in Schulterhöhe haltend. Der Priester
wird durch die gleich zu besprechende Bei-
schrift als Propst Berchthold von hl. Kreuz
bezeichnet, unter dessen Amtsführung sich das
Wunder an der hl. Hostie zutrug. Ueber der
Figur erscheint von der andern Seite her die
segnende „dextera Dei". Diese aus dem christ-
lichen Alterthum sich herleitende symbolische
Andeutung der Gottheit6) soll das Wunder als
die unmittelbare Wirkung der göttlichen All-
macht charakterisiren und ist eine treffliche
Illustration zu den Worten der bischöflichen
Beurkundung desselben: „divina faciente ac
operante potentia".
Neben der Figur des Propstes zeigen sich
die Reste einer Inschrift, nämlich je 2—3 An-
fangsbuchstaben von acht untereinander stehen-
den Schriftzeilen. Diese Inschrift, welche durch
den Ausschnitt vom Jahre 1346 zerstört wurde,
ist in den Bericht der Chronik von hl. Kreuz
über das Sakrarium aufgenommen und dadurch
erhalten worden. Ich gebe die in romanischer
Majuskel eingravirte Inschrift in der Art wieder,
dafs die auf dem Schrein noch vorhandenen
Buchstaben in Majuskel, die der Chronik ent-
nommenen Ergänzungen in Minuskel gedruckt
erscheinen.
BERchtoldus pre-
POSitus sancte crucis
INDignus sub.
QVo facta
ESl revela-
Tio corporis
ET sanguinis
DNi (-domini)
Auf jeder Zeile (mit Ausnahme der Schlufs-
zeile) fehlen im Durchschnitt 8 Buchstaben;
nur die zweite überschreitet mit 16 Buch-
staben dieses Mittel bedeutend; doch läfst
sich durch die Annahme von zwei sehr ge-
wöhnlichen Abkürzungen (9 für us und sce
für sancte) die Zahl der fehlenden Buchstaben
6) Vergl. Fr. X. Kraus »Gesch. d. christl. Kunst«
I, 118.
auf 11 einschränken. Das Schwanken zwischen
6 und 11 Buchstaben (4. und 2. Zeile) findet seine
hinreichende Erklärung in den unregelmäfsigen
Zwischenräumen der Buchstaben, wie sie sich
selbst an den geringen erhaltenen Resten fest-
stellen lassen. Damit schwindet jedes Bedenken
gegen die Authentizität der von der Chronik
überlieferten Form der Inschrift, welche in
völlig sachgemäfser Weise die erhaltenen In-
schriftreste ergänzt und durch diese Reste hin-
wiederum mit günstigstem Erfolge die Probe
ihrer Verlässigkeit besteht.
Es entsteht nun die Frage, ob sich auf der
Vorderseite noch weitere Darstellungen, In-
schriften oder Verzierungen befanden, welche
der Veränderung von 1346 zum Opfer fielen.
Die Breite des Ausschnittes beträgt 6 cm. Die
Inschrift beanspruchte etwa 2,6 cm von der
Breite des Ausschnittes, die Ergänzung des
Apostels mit dem zugehörigen Säulchen 0,9 cm.
Es bleibt sonach in der Mitte ein Raum von
2,5 cm, welcher sicherlich irgendwie ausgefüllt
war. Eine Inschrift trug diese Fläche kaum;
man darf wohl annehmen, dafs eine solche, an
so hervorragender Stelle angebracht, von der
Chronik verzeichnet worden wäre. Es wird also
eine figürliche Darstellung oder ein Zierstück
die mittlere Fläche ausgefüllt haben; ich wage
es nicht, mich für eine dieser beiden Möglich-
keiten zu entscheiden, noch über den Inhalt
einer etwaigen Darstellung eine Vermuthung
auszusprechen.
B. Der Deckel ist durch folgende Dar-
stellungen, Inschriften und Ziergegenstände ge-
schmückt: In den vier Ecken, die abgerun-
deten Kanten theilweise verhüllend, die nim-
birten Evangelistensymbole. Auf der Vorder-
seite über dem Ausschnitt drei grofse, vier-
eckige, in vergoldetem Silber gefafste Steine,
zu beiden Seiten des oberen Steines eine in
Silber gefafste Silberkugel; ein weiteres Zier-
stück zwischen den beiden unteren Steinen,
wohl auch eine Silberkugel, ist weggebrochen.
Seitwärts links von dieser Verzierung bemerken
wir eine Inschrift; sie gehört zu der kleinen,
in betender Stellung darunter knieenden Figur
und ist für die Kunstgeschichte von besonderem
Interesse, weil sie den Künstler und seine Her-
kunft vermeldet: „f Conradtis de Lindowe fecit
me pro quo orat\e}".
Die Schmalseiten werden ausgefüllt durch
je eine nimbirte, in knieender Stellung betende,
1897. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
202
nimbirt und, soviel sich erkennen läfst, ge-
bartet. Die Kleidung ist die antike, bestehend
in langem Untergewand (Tunika) und reich
gefaltetem, kürzerem Obergewand (Toga).
Die Vorderseite links zeigt einen Mann in
priesterlicher Kleidung, bartlos und mit Mönchs-
tonsur, ohne Nimbus, die hl. Hostie mit dem
Daumen und dem Zeigefinger der Rechten vor
sich hin in Schulterhöhe haltend. Der Priester
wird durch die gleich zu besprechende Bei-
schrift als Propst Berchthold von hl. Kreuz
bezeichnet, unter dessen Amtsführung sich das
Wunder an der hl. Hostie zutrug. Ueber der
Figur erscheint von der andern Seite her die
segnende „dextera Dei". Diese aus dem christ-
lichen Alterthum sich herleitende symbolische
Andeutung der Gottheit6) soll das Wunder als
die unmittelbare Wirkung der göttlichen All-
macht charakterisiren und ist eine treffliche
Illustration zu den Worten der bischöflichen
Beurkundung desselben: „divina faciente ac
operante potentia".
Neben der Figur des Propstes zeigen sich
die Reste einer Inschrift, nämlich je 2—3 An-
fangsbuchstaben von acht untereinander stehen-
den Schriftzeilen. Diese Inschrift, welche durch
den Ausschnitt vom Jahre 1346 zerstört wurde,
ist in den Bericht der Chronik von hl. Kreuz
über das Sakrarium aufgenommen und dadurch
erhalten worden. Ich gebe die in romanischer
Majuskel eingravirte Inschrift in der Art wieder,
dafs die auf dem Schrein noch vorhandenen
Buchstaben in Majuskel, die der Chronik ent-
nommenen Ergänzungen in Minuskel gedruckt
erscheinen.
BERchtoldus pre-
POSitus sancte crucis
INDignus sub.
QVo facta
ESl revela-
Tio corporis
ET sanguinis
DNi (-domini)
Auf jeder Zeile (mit Ausnahme der Schlufs-
zeile) fehlen im Durchschnitt 8 Buchstaben;
nur die zweite überschreitet mit 16 Buch-
staben dieses Mittel bedeutend; doch läfst
sich durch die Annahme von zwei sehr ge-
wöhnlichen Abkürzungen (9 für us und sce
für sancte) die Zahl der fehlenden Buchstaben
6) Vergl. Fr. X. Kraus »Gesch. d. christl. Kunst«
I, 118.
auf 11 einschränken. Das Schwanken zwischen
6 und 11 Buchstaben (4. und 2. Zeile) findet seine
hinreichende Erklärung in den unregelmäfsigen
Zwischenräumen der Buchstaben, wie sie sich
selbst an den geringen erhaltenen Resten fest-
stellen lassen. Damit schwindet jedes Bedenken
gegen die Authentizität der von der Chronik
überlieferten Form der Inschrift, welche in
völlig sachgemäfser Weise die erhaltenen In-
schriftreste ergänzt und durch diese Reste hin-
wiederum mit günstigstem Erfolge die Probe
ihrer Verlässigkeit besteht.
Es entsteht nun die Frage, ob sich auf der
Vorderseite noch weitere Darstellungen, In-
schriften oder Verzierungen befanden, welche
der Veränderung von 1346 zum Opfer fielen.
Die Breite des Ausschnittes beträgt 6 cm. Die
Inschrift beanspruchte etwa 2,6 cm von der
Breite des Ausschnittes, die Ergänzung des
Apostels mit dem zugehörigen Säulchen 0,9 cm.
Es bleibt sonach in der Mitte ein Raum von
2,5 cm, welcher sicherlich irgendwie ausgefüllt
war. Eine Inschrift trug diese Fläche kaum;
man darf wohl annehmen, dafs eine solche, an
so hervorragender Stelle angebracht, von der
Chronik verzeichnet worden wäre. Es wird also
eine figürliche Darstellung oder ein Zierstück
die mittlere Fläche ausgefüllt haben; ich wage
es nicht, mich für eine dieser beiden Möglich-
keiten zu entscheiden, noch über den Inhalt
einer etwaigen Darstellung eine Vermuthung
auszusprechen.
B. Der Deckel ist durch folgende Dar-
stellungen, Inschriften und Ziergegenstände ge-
schmückt: In den vier Ecken, die abgerun-
deten Kanten theilweise verhüllend, die nim-
birten Evangelistensymbole. Auf der Vorder-
seite über dem Ausschnitt drei grofse, vier-
eckige, in vergoldetem Silber gefafste Steine,
zu beiden Seiten des oberen Steines eine in
Silber gefafste Silberkugel; ein weiteres Zier-
stück zwischen den beiden unteren Steinen,
wohl auch eine Silberkugel, ist weggebrochen.
Seitwärts links von dieser Verzierung bemerken
wir eine Inschrift; sie gehört zu der kleinen,
in betender Stellung darunter knieenden Figur
und ist für die Kunstgeschichte von besonderem
Interesse, weil sie den Künstler und seine Her-
kunft vermeldet: „f Conradtis de Lindowe fecit
me pro quo orat\e}".
Die Schmalseiten werden ausgefüllt durch
je eine nimbirte, in knieender Stellung betende,