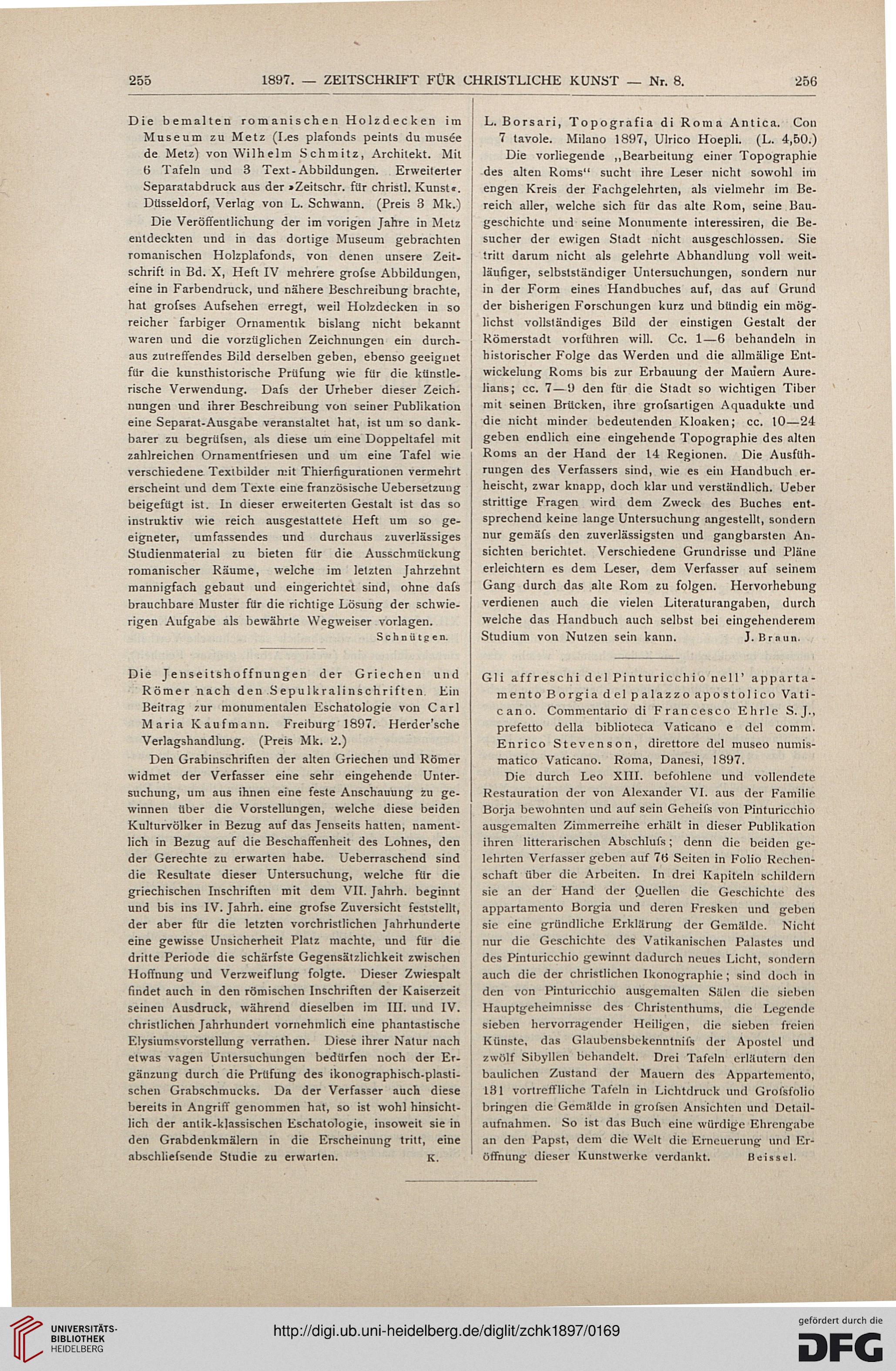255
1897. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.
256
Die bemalten romanischen Holzdecken im
Museum zu Metz (I.es plafonds peints du musee
de Metz) von Wilhelm Schmitz, Architekt. Mit
6 Tafeln und 3 Text-Abbildungen. Erweiterter
Separatabdruck aus der »Zeitschr. für christl. Kunst«.
Düsseldorf, Verlag von L. Schwann. (Preis 3 Mk.)
Die Veröffentlichung der im vorigen Jahre in Metz
entdeckten und in das dortige Museum gebrachten
romanischen Holzplafonds, von denen unsere Zeit-
schrift in Bd. X, Heft IV mehrere grofse Abbildungen,
eine in Farbendruck, und nähere Beschreibung brachte,
hat grofses Aufsehen erregt, weil Holzdecken in so
reicher farbiger Ornamentik bislang nicht bekannt
waren und die vorzüglichen Zeichnungen ein durch-
aus zutreffendes Bild derselben geben, ebenso geeignet
für die kunsthistorische Prüfung wie für die künstle-
rische Verwendung. Dafs der Urheber dieser Zeich-
nungen und ihrer Beschreibung von seiner Publikation
eine Separat-Ausgabe veranstaltet hat, ist um so dank-
barer zu begrüfsen, als diese um eine Doppeltafel mit
zahlreichen Ornamentfriesen und um eine Tafel wie
verschiedene Texlbilder mit Thierfigurationen vermehrt
erscheint und dem Texte eine französische Uebersetzung
beigefügt ist. In dieser erweiterten Gestalt ist das so
instruktiv wie reich ausgestattete Heft um so ge-
eigneter, umfassendes und durchaus zuverlässiges
Studienmaterial zu bieten für die Ausschmückung
romanischer Räume, welche im letzten Jahrzehnt
mannigfach gebaut und eingerichtet sind, ohne dafs
brauchbare Muster für die richtige Lösung der schwie-
rigen Aufgabe als bewährte Wegweiser vorlagen.
Schnütgen.
Die Jenseitshoffnungen der Griechen und
Römer nach den Sepulkralinschriften Ein
Beitrag zur monumentalen Eschatologie von Carl
Maria Kaufmann. Freiburg 1897. Herdcr'sche
Verlagshandlung. (Preis Mk. 2.)
Den Grabinschriften der alten Griechen und Römer
widmet der Verfasser eine sehr eingehende Unter-
suchung, um aus ihnen eine feste Anschauung zu ge-
winnen über die Vorstellungen, welche diese beiden
Kulturvölker in Bezug auf das Jenseits hatten, nament-
lich in Bezug auf die Beschaffenheit des Lohnes, den
der Gerechte zu erwarten habe. Ueberraschend sind
die Resultate dieser Untersuchung, welche für die
griechischen Inschriften mit dem VII. Jahrh. beginnt
und bis ins IV. Jahrh. eine grofse Zuversicht feststellt,
der aber für die letzten vorchristlichen Jahrhunderte
eine gewisse Unsicherheit Platz machte, und für die
dritte Periode die schärfste Gegensätzlichkeit zwischen
Hoffnung und Verzweiflung folgte. Dieser Zwiespalt
findet auch in den römischen Inschriften der Kaiserzeit
seinen Ausdruck, während dieselben im III. und IV.
christlichen Jahrhundert vornehmlich eine phantastische
Elysiumsvorstellung verrathen. Diese ihrer Natur nach
etwas vagen Untersuchungen bedürfen noch der Er-
gänzung durch die Prüfung des ikonographisch-plasti-
schen Grabschmucks. Da der Verfasser auch diese
bereits in Angriff genommen hat, so ist wohl hinsicht-
lich der antik-klassischen Eschatologie, insoweit sie in
den Grabdenkmälern in die Erscheinung tritt, eine
abschliefsende Studie zu erwarten. k.
L. Borsari, Topografia di Roma Antica. Con
7 tavole. Milano 1897, Ulrico Hoepli. (L. 4,50.)
Die vorliegende „Bearbeitung einer Topographie
des alten Roms" sucht ihre Leser nicht sowohl im
engen Kreis der Fachgelehrten, als vielmehr im Be-
reich aller, welche sich für das alte Rom, seine Bau-
geschichte und seine Monumente interessiren, die Be-
sucher der ewigen Stadt nicht ausgeschlossen. Sie
tritt darum nicht als gelehrte Abhandlung voll weit-
läufiger, selbstständiger Untersuchungen, sondern nur
in der Form eines Handbuches auf, das auf Grund
der bisherigen Forschungen kurz und bündig ein mög-
lichst vollständiges Bild der einstigen Gestalt der
Kömerstadt vorführen will. Cc. 1—6 behandeln in
historischer Folge das Werden und die allmälige Ent-
wickelung Roms bis zur Erbauung der Maliern Aure-
lians; cc. 7—1) den für die Stadt so wichtigen Tiber
mit seinen Brücken, ihre grofsartigen Aquädukte und
die nicht minder bedeutenden Kloaken; cc. 10—24
geben endlich eine eingehende Topographie des alten
Roms an der Hand der 14 Regionen. Die Ausfüh-
rungen des Verfassers sind, wie es ein Handbuch er-
heischt, zwar knapp, doch klar und verständlich. Ueber
strittige Fragen wird dem Zweck des Buches ent-
sprechend keine lange Untersuchung angestellt, sondern
nur gemäfs den zuverlässigsten und gangbarsten An-
sichten berichtet. Verschiedene Grundrisse und Pläne
erleichtern es dem Leser, dem Verfasser auf seinem
Gang durch das alte Rom zu folgen. Hervorhebung
verdienen auch die vielen Literaturangaben, durch
welche das Handbuch auch selbst bei eingehenderem
Studium von Nutzen sein kann. J. Braun.
Gli äffreschi del Pinturicchio nell' apparta-
mento Borgia del palazzo apostolico Vati-
cano. Commentario di Francesco Ehrle S. J.,
prefetto della biblioteca Vaticano e del comni.
Enrico Stevenson, direttore del museo numis-
matico Vaticano. Roma, Danesi, 1897.
Die durch Leo XIII. befohlene und vollendete
Restauration der von Alexander VI. aus der Familie
Borja bewohnten und auf sein Geheifs von Pinturicchio
ausgemalten Zimmerreihe erhält in dieser Publikation
ihren litterarischen Abschlufs; denn die beiden ge-
lehrten Verfasser geben auf 76 Seiten in Folio Rechen-
schaft über die Arbeiten. In drei Kapiteln schildern
sie an der Hand der Quellen die Geschichte des
appartamento Borgia und deren Fresken und geben
sie eine gründliche Erklärung der Gemälde. Nicht
nur die Geschichte des Vatikanischen Palastes und
des Pinturicchio gewinnt dadurch neues Licht, sondern
auch die der christlichen Ikonographie ; sind doch in
den von Pinturicchio ausgemalten Sälen die sieben
Hauptgeheimnisse des Christenthums, die Legende
sieben hervorragender Heiligen, die sieben freien
Künste, das Glaubensbekenntnis der Apostel und
zwölf Sibyllen behandelt. Drei Tafeln erläutern den
baulichen Zustand der Mauern des Appartemento,
131 vortreffliche Tafeln in Lichtdruck und Grofsfolio
bringen die Gemälde in grofsen Ansichten und Detail-
aufnahmen. So ist das Buch eine würdige Ehrengabe
an den Papst, dem die Welt die Erneuerung und Er-
öffnung dieser Kunstwerke verdankt. Beiisel.
1897. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.
256
Die bemalten romanischen Holzdecken im
Museum zu Metz (I.es plafonds peints du musee
de Metz) von Wilhelm Schmitz, Architekt. Mit
6 Tafeln und 3 Text-Abbildungen. Erweiterter
Separatabdruck aus der »Zeitschr. für christl. Kunst«.
Düsseldorf, Verlag von L. Schwann. (Preis 3 Mk.)
Die Veröffentlichung der im vorigen Jahre in Metz
entdeckten und in das dortige Museum gebrachten
romanischen Holzplafonds, von denen unsere Zeit-
schrift in Bd. X, Heft IV mehrere grofse Abbildungen,
eine in Farbendruck, und nähere Beschreibung brachte,
hat grofses Aufsehen erregt, weil Holzdecken in so
reicher farbiger Ornamentik bislang nicht bekannt
waren und die vorzüglichen Zeichnungen ein durch-
aus zutreffendes Bild derselben geben, ebenso geeignet
für die kunsthistorische Prüfung wie für die künstle-
rische Verwendung. Dafs der Urheber dieser Zeich-
nungen und ihrer Beschreibung von seiner Publikation
eine Separat-Ausgabe veranstaltet hat, ist um so dank-
barer zu begrüfsen, als diese um eine Doppeltafel mit
zahlreichen Ornamentfriesen und um eine Tafel wie
verschiedene Texlbilder mit Thierfigurationen vermehrt
erscheint und dem Texte eine französische Uebersetzung
beigefügt ist. In dieser erweiterten Gestalt ist das so
instruktiv wie reich ausgestattete Heft um so ge-
eigneter, umfassendes und durchaus zuverlässiges
Studienmaterial zu bieten für die Ausschmückung
romanischer Räume, welche im letzten Jahrzehnt
mannigfach gebaut und eingerichtet sind, ohne dafs
brauchbare Muster für die richtige Lösung der schwie-
rigen Aufgabe als bewährte Wegweiser vorlagen.
Schnütgen.
Die Jenseitshoffnungen der Griechen und
Römer nach den Sepulkralinschriften Ein
Beitrag zur monumentalen Eschatologie von Carl
Maria Kaufmann. Freiburg 1897. Herdcr'sche
Verlagshandlung. (Preis Mk. 2.)
Den Grabinschriften der alten Griechen und Römer
widmet der Verfasser eine sehr eingehende Unter-
suchung, um aus ihnen eine feste Anschauung zu ge-
winnen über die Vorstellungen, welche diese beiden
Kulturvölker in Bezug auf das Jenseits hatten, nament-
lich in Bezug auf die Beschaffenheit des Lohnes, den
der Gerechte zu erwarten habe. Ueberraschend sind
die Resultate dieser Untersuchung, welche für die
griechischen Inschriften mit dem VII. Jahrh. beginnt
und bis ins IV. Jahrh. eine grofse Zuversicht feststellt,
der aber für die letzten vorchristlichen Jahrhunderte
eine gewisse Unsicherheit Platz machte, und für die
dritte Periode die schärfste Gegensätzlichkeit zwischen
Hoffnung und Verzweiflung folgte. Dieser Zwiespalt
findet auch in den römischen Inschriften der Kaiserzeit
seinen Ausdruck, während dieselben im III. und IV.
christlichen Jahrhundert vornehmlich eine phantastische
Elysiumsvorstellung verrathen. Diese ihrer Natur nach
etwas vagen Untersuchungen bedürfen noch der Er-
gänzung durch die Prüfung des ikonographisch-plasti-
schen Grabschmucks. Da der Verfasser auch diese
bereits in Angriff genommen hat, so ist wohl hinsicht-
lich der antik-klassischen Eschatologie, insoweit sie in
den Grabdenkmälern in die Erscheinung tritt, eine
abschliefsende Studie zu erwarten. k.
L. Borsari, Topografia di Roma Antica. Con
7 tavole. Milano 1897, Ulrico Hoepli. (L. 4,50.)
Die vorliegende „Bearbeitung einer Topographie
des alten Roms" sucht ihre Leser nicht sowohl im
engen Kreis der Fachgelehrten, als vielmehr im Be-
reich aller, welche sich für das alte Rom, seine Bau-
geschichte und seine Monumente interessiren, die Be-
sucher der ewigen Stadt nicht ausgeschlossen. Sie
tritt darum nicht als gelehrte Abhandlung voll weit-
läufiger, selbstständiger Untersuchungen, sondern nur
in der Form eines Handbuches auf, das auf Grund
der bisherigen Forschungen kurz und bündig ein mög-
lichst vollständiges Bild der einstigen Gestalt der
Kömerstadt vorführen will. Cc. 1—6 behandeln in
historischer Folge das Werden und die allmälige Ent-
wickelung Roms bis zur Erbauung der Maliern Aure-
lians; cc. 7—1) den für die Stadt so wichtigen Tiber
mit seinen Brücken, ihre grofsartigen Aquädukte und
die nicht minder bedeutenden Kloaken; cc. 10—24
geben endlich eine eingehende Topographie des alten
Roms an der Hand der 14 Regionen. Die Ausfüh-
rungen des Verfassers sind, wie es ein Handbuch er-
heischt, zwar knapp, doch klar und verständlich. Ueber
strittige Fragen wird dem Zweck des Buches ent-
sprechend keine lange Untersuchung angestellt, sondern
nur gemäfs den zuverlässigsten und gangbarsten An-
sichten berichtet. Verschiedene Grundrisse und Pläne
erleichtern es dem Leser, dem Verfasser auf seinem
Gang durch das alte Rom zu folgen. Hervorhebung
verdienen auch die vielen Literaturangaben, durch
welche das Handbuch auch selbst bei eingehenderem
Studium von Nutzen sein kann. J. Braun.
Gli äffreschi del Pinturicchio nell' apparta-
mento Borgia del palazzo apostolico Vati-
cano. Commentario di Francesco Ehrle S. J.,
prefetto della biblioteca Vaticano e del comni.
Enrico Stevenson, direttore del museo numis-
matico Vaticano. Roma, Danesi, 1897.
Die durch Leo XIII. befohlene und vollendete
Restauration der von Alexander VI. aus der Familie
Borja bewohnten und auf sein Geheifs von Pinturicchio
ausgemalten Zimmerreihe erhält in dieser Publikation
ihren litterarischen Abschlufs; denn die beiden ge-
lehrten Verfasser geben auf 76 Seiten in Folio Rechen-
schaft über die Arbeiten. In drei Kapiteln schildern
sie an der Hand der Quellen die Geschichte des
appartamento Borgia und deren Fresken und geben
sie eine gründliche Erklärung der Gemälde. Nicht
nur die Geschichte des Vatikanischen Palastes und
des Pinturicchio gewinnt dadurch neues Licht, sondern
auch die der christlichen Ikonographie ; sind doch in
den von Pinturicchio ausgemalten Sälen die sieben
Hauptgeheimnisse des Christenthums, die Legende
sieben hervorragender Heiligen, die sieben freien
Künste, das Glaubensbekenntnis der Apostel und
zwölf Sibyllen behandelt. Drei Tafeln erläutern den
baulichen Zustand der Mauern des Appartemento,
131 vortreffliche Tafeln in Lichtdruck und Grofsfolio
bringen die Gemälde in grofsen Ansichten und Detail-
aufnahmen. So ist das Buch eine würdige Ehrengabe
an den Papst, dem die Welt die Erneuerung und Er-
öffnung dieser Kunstwerke verdankt. Beiisel.