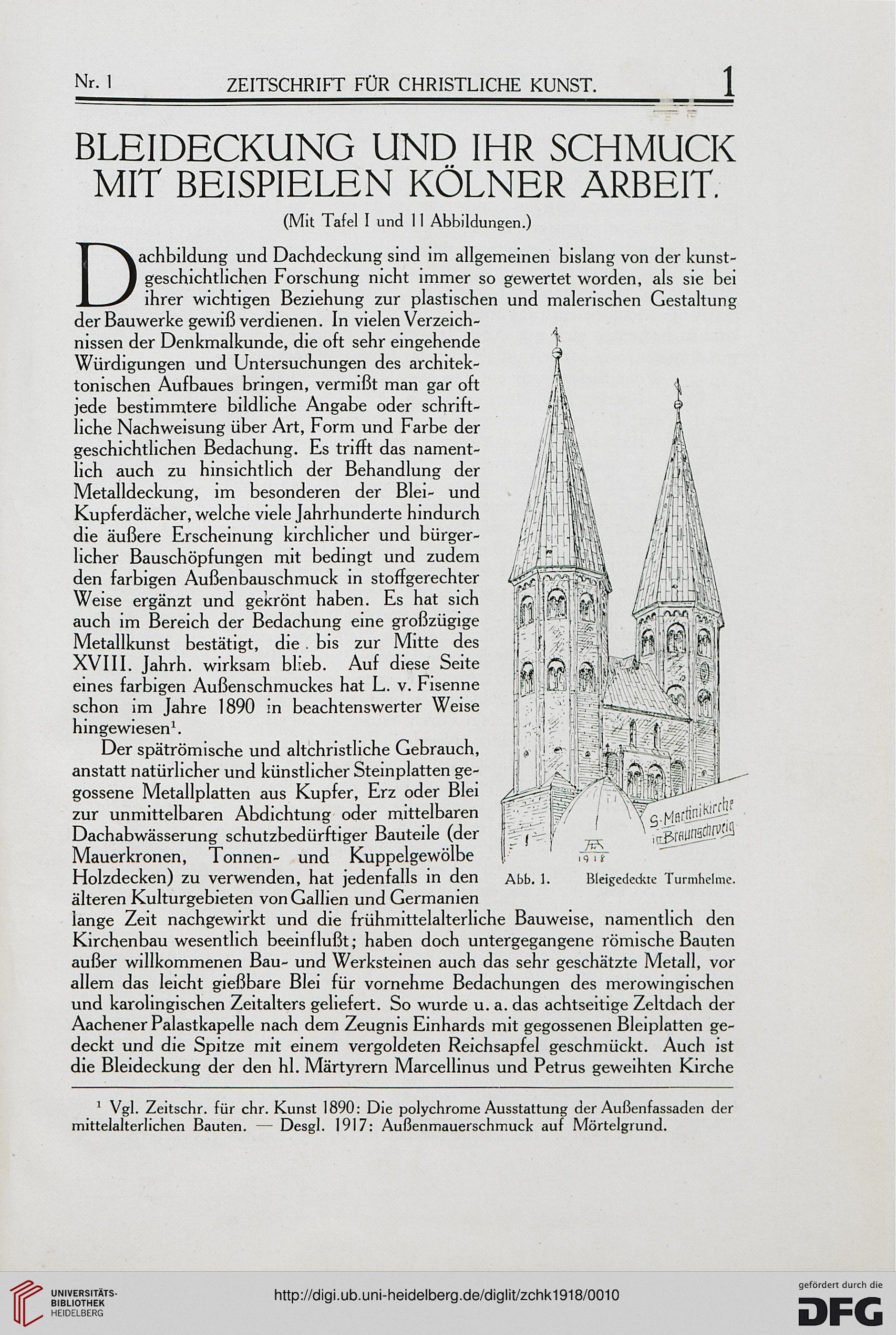Nr
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
1
BLEIDECKUNG UND IHR SCHMUCK
MIT BEISPIELEN KÖLNER ARBEIT.
(Mit Tafel I und 1 1 Abbildungen.)
Dachbildung und Dachdeckung sind im allgemeinen bislang von der kunst-
geschichtlichen Forschung nicht immer so gewertet worden, als sie bei
ihrer wichtigen Beziehung zur plastischen und malerischen Gestaltung
der Bauwerke gewiß verdienen. In vielen Verzeich-
nissen der Denkmalkunde, die oft sehr eingehende
Würdigungen und Untersuchungen des architek-
tonischen Aufbaues bringen, vermißt man gar oft
jede bestimmtere bildliche Angabe oder schrift-
liche Nachweisung über Art, Form und Farbe der
geschichtlichen Bedachung. Es trifft das nament-
lich auch zu hinsichtlich der Behandlung der
Metalldeckung, im besonderen der Blei- und
Kupferdächer, welche viele Jahrhunderte hindurch
die äußere Erscheinung kirchlicher und bürger-
licher Bauschöpfungen mit bedingt und zudem
den farbigen Außenbauschmuck in stoffgerechter
Weise ergänzt und gekrönt haben. Es hat sich
auch im Bereich der Bedachung eine großzügige
Metallkunst bestätigt, die . bis zur Mitte des
XVIII. Jahrh. wirksam blieb. Auf diese Seite
eines farbigen Außenschmuckes hat L. v. Fisenne
schon im Jahre 1890 in beachtenswerter Weise
hingewiesen1.
Der spätrömische und altchristliche Gebrauch,
anstatt natürlicher und künstlicher Steinplatten ge-
gossene Metallplatten aus Kupfer, Erz oder Blei
zur unmittelbaren Abdichtung oder mittelbaren
Dachabwässerung schutzbedürftiger Bauteile (der
Mauerkronen, Tonnen- und Kuppelgewölbe
Holzdecken) zu verwenden, hat jedenfalls in den
älteren Kulturgebieten von Gallien und Germanien
lange Zeit nachgewirkt und die frühmittelalterliche Bauweise, namentlich den
Kirchenbau wesentlich beeinflußt; haben doch untergegangene römische Bauten
außer willkommenen Bau- und Werksteinen auch das sehr geschätzte Metall, vor
allem das leicht gießbare Blei für vornehme Bedachungen des merowingischen
und karolingischen Zeitalters geliefert. So wurde u.a. das achtseitige Zeltdach der
Aachener Palastkapelle nach dem Zeugnis Einhards mit gegossenen Bleiplatten ge-
deckt und die Spitze mit einem vergoldeten Reichsapfel geschmückt. Auch ist
die Bleideckung der den hl. Märtyrern Marcellinus und Petrus geweihten Kirche
Bleigcdcduc Turmhclmc.
1 Vgl. Zeitschr. für ehr. Kunst 1890: Die polychrome Ausstattung der Außenfassaden der
mittelalterlichen Bauten. — Desgl. 1917: Außenmauerschmuck auf Mörtelgrund.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
1
BLEIDECKUNG UND IHR SCHMUCK
MIT BEISPIELEN KÖLNER ARBEIT.
(Mit Tafel I und 1 1 Abbildungen.)
Dachbildung und Dachdeckung sind im allgemeinen bislang von der kunst-
geschichtlichen Forschung nicht immer so gewertet worden, als sie bei
ihrer wichtigen Beziehung zur plastischen und malerischen Gestaltung
der Bauwerke gewiß verdienen. In vielen Verzeich-
nissen der Denkmalkunde, die oft sehr eingehende
Würdigungen und Untersuchungen des architek-
tonischen Aufbaues bringen, vermißt man gar oft
jede bestimmtere bildliche Angabe oder schrift-
liche Nachweisung über Art, Form und Farbe der
geschichtlichen Bedachung. Es trifft das nament-
lich auch zu hinsichtlich der Behandlung der
Metalldeckung, im besonderen der Blei- und
Kupferdächer, welche viele Jahrhunderte hindurch
die äußere Erscheinung kirchlicher und bürger-
licher Bauschöpfungen mit bedingt und zudem
den farbigen Außenbauschmuck in stoffgerechter
Weise ergänzt und gekrönt haben. Es hat sich
auch im Bereich der Bedachung eine großzügige
Metallkunst bestätigt, die . bis zur Mitte des
XVIII. Jahrh. wirksam blieb. Auf diese Seite
eines farbigen Außenschmuckes hat L. v. Fisenne
schon im Jahre 1890 in beachtenswerter Weise
hingewiesen1.
Der spätrömische und altchristliche Gebrauch,
anstatt natürlicher und künstlicher Steinplatten ge-
gossene Metallplatten aus Kupfer, Erz oder Blei
zur unmittelbaren Abdichtung oder mittelbaren
Dachabwässerung schutzbedürftiger Bauteile (der
Mauerkronen, Tonnen- und Kuppelgewölbe
Holzdecken) zu verwenden, hat jedenfalls in den
älteren Kulturgebieten von Gallien und Germanien
lange Zeit nachgewirkt und die frühmittelalterliche Bauweise, namentlich den
Kirchenbau wesentlich beeinflußt; haben doch untergegangene römische Bauten
außer willkommenen Bau- und Werksteinen auch das sehr geschätzte Metall, vor
allem das leicht gießbare Blei für vornehme Bedachungen des merowingischen
und karolingischen Zeitalters geliefert. So wurde u.a. das achtseitige Zeltdach der
Aachener Palastkapelle nach dem Zeugnis Einhards mit gegossenen Bleiplatten ge-
deckt und die Spitze mit einem vergoldeten Reichsapfel geschmückt. Auch ist
die Bleideckung der den hl. Märtyrern Marcellinus und Petrus geweihten Kirche
Bleigcdcduc Turmhclmc.
1 Vgl. Zeitschr. für ehr. Kunst 1890: Die polychrome Ausstattung der Außenfassaden der
mittelalterlichen Bauten. — Desgl. 1917: Außenmauerschmuck auf Mörtelgrund.