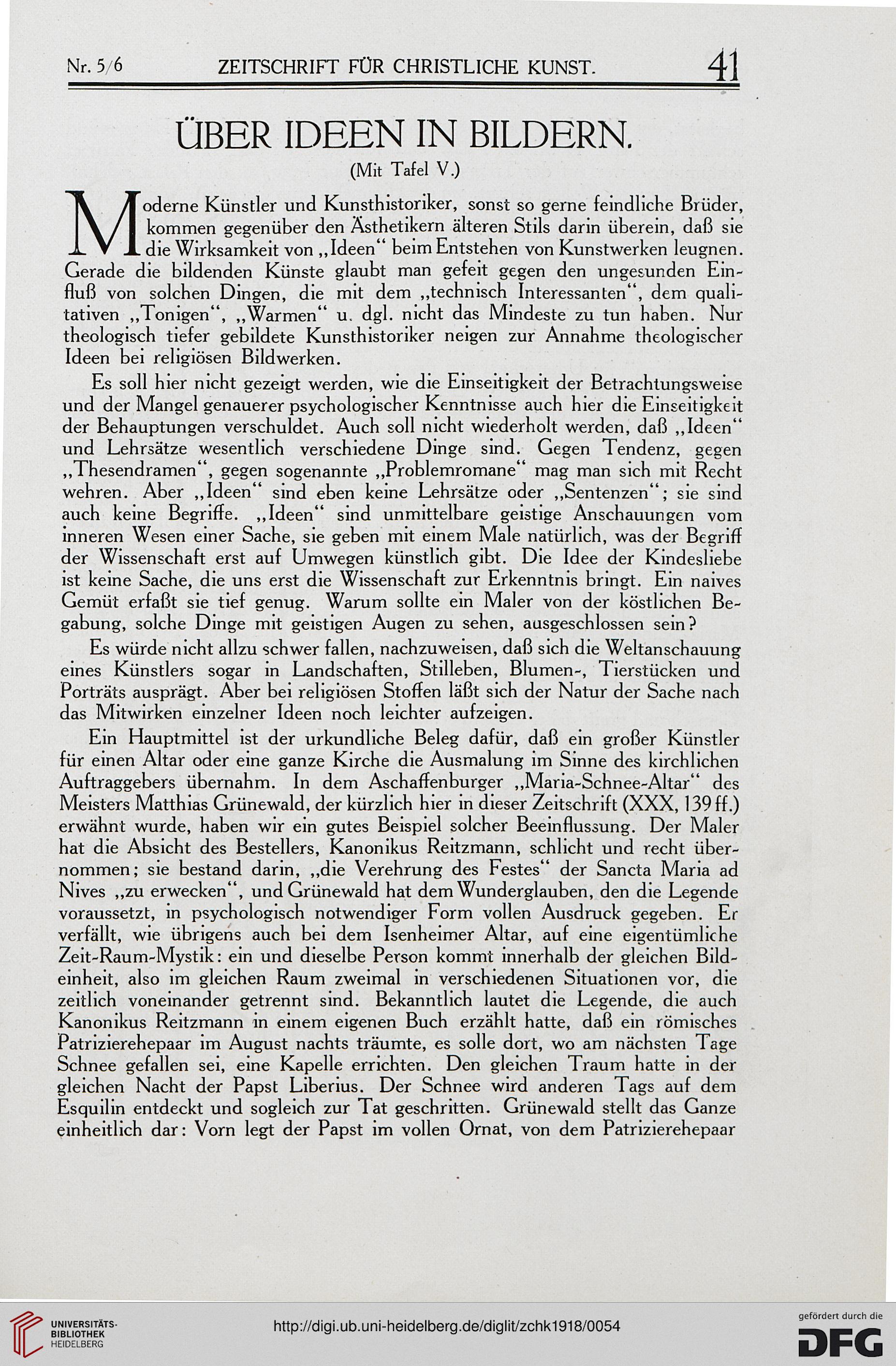Nr. 5 6__________ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.____________41
ÜBER IDEEN IN BILDERN.
(Mit Tafel V.)
Moderne Künstler und Kunsthistoriker, sonst so gerne feindliche Brüder,
kommen gegenüber den Ästhetikern älteren Stils darin überein, daß sie
die Wirksamkeit von „Ideen" beim Entstehen von Kunstwerken leugnen.
Gerade die bildenden Künste glaubt man gefeit gegen den ungesunden Ein-
fluß von solchen Dingen, die mit dem „technisch Interessanten", dem quali-
tativen „Tonigen", „Warmen" u. dgl. nicht das Mindeste zu tun haben. Nur
theologisch tiefer gebildete Kunsthistoriker neigen zur Annahme theologischer
Ideen bei religiösen Bildwerken.
Es soll hier nicht gezeigt werden, wie die Einseitigkeit der Betrachtungsweise
und der Mangel genauerer psychologischer Kenntnisse auch hier die Einseitigkeit
der Behauptungen verschuldet. Auch soll nicht wiederholt werden, daß „Ideen"
und Lehrsätze wesentlich verschiedene Dinge sind. Gegen Tendenz, gegen
„Thesendramen", gegen sogenannte „Problemromane" mag man sich mit Recht
wehren. Aber „Ideen" sind eben keine Lehrsätze oder „Sentenzen"; sie sind
auch keine Begriffe. „Ideen" sind unmittelbare geistige Anschauungen vom
inneren Wesen einer Sache, sie geben mit einem Male natürlich, was der Begriff
der Wissenschaft erst auf Umwegen künstlich gibt. Die Idee der Kindesliebe
ist keine Sache, die uns erst die Wissenschaft zur Erkenntnis bringt. Ein naives
Gemüt erfaßt sie tief genug. Warum sollte ein Maler von der köstlichen Be-
gabung, solche Dinge mit geistigen Augen zu sehen, ausgeschlossen sein ?
Es würde nicht allzu schwer fallen, nachzuweisen, daß sich die Weltanschauung
eines Künstlers sogar in Landschaften, Stilleben, Blumen-, Tierstücken und
Porträts ausprägt. Aber bei religiösen Stoffen läßt sich der Natur der Sache nach
das Mitwirken einzelner Ideen noch leichter aufzeigen.
Ein Hauptmittel ist der urkundliche Beleg dafür, daß ein großer Künstler
für einen Altar oder eine ganze Kirche die Ausmalung im Sinne des kirchlichen
Auftraggebers übernahm. In dem Aschaffenburger „Mana-Schnee-Altar" des
Meisters Matthias Grünewald, der kürzlich hier in dieser Zeitschrift (XXX, 139 ff.)
erwähnt wurde, haben wir ein gutes Beispiel solcher Beeinflussung. Der Maler
hat die Absicht des Bestellers, Kanonikus Reitzmann, schlicht und recht über-
nommen; sie bestand dann, „die Verehrung des Festes" der Sancta Maria ad
Nives „zu erwecken", und Grünewald hat dem Wunderglauben, den die Legende
voraussetzt, in psychologisch notwendiger Form vollen Ausdruck gegeben. Er
verfällt, wie übrigens auch bei dem Isenheimer Altar, auf eine eigentümliche
Zeit-Raum-Mystik: ein und dieselbe Person kommt innerhalb der gleichen Bild-
emheit, also im gleichen Raum zweimal in verschiedenen Situationen vor, die
zeitlich voneinander getrennt sind. Bekanntlich lautet die Legende, die auch
Kanonikus Reitzmann in einem eigenen Buch erzählt hatte, daß ein römisches
Patrizierehepaar im August nachts träumte, es solle dort, wo am nächsten Tage
Schnee gefallen sei, eine Kapelle errichten. Den gleichen Traum hatte in der
gleichen Nacht der Papst Libenus. Der Schnee wird anderen Tags auf dem
Esquilin entdeckt und sogleich zur Tat geschritten. Grünewald stellt das Ganze
einheitlich dar: Vorn legt der Papst im vollen Ornat, von dem Patrizierehepaar
ÜBER IDEEN IN BILDERN.
(Mit Tafel V.)
Moderne Künstler und Kunsthistoriker, sonst so gerne feindliche Brüder,
kommen gegenüber den Ästhetikern älteren Stils darin überein, daß sie
die Wirksamkeit von „Ideen" beim Entstehen von Kunstwerken leugnen.
Gerade die bildenden Künste glaubt man gefeit gegen den ungesunden Ein-
fluß von solchen Dingen, die mit dem „technisch Interessanten", dem quali-
tativen „Tonigen", „Warmen" u. dgl. nicht das Mindeste zu tun haben. Nur
theologisch tiefer gebildete Kunsthistoriker neigen zur Annahme theologischer
Ideen bei religiösen Bildwerken.
Es soll hier nicht gezeigt werden, wie die Einseitigkeit der Betrachtungsweise
und der Mangel genauerer psychologischer Kenntnisse auch hier die Einseitigkeit
der Behauptungen verschuldet. Auch soll nicht wiederholt werden, daß „Ideen"
und Lehrsätze wesentlich verschiedene Dinge sind. Gegen Tendenz, gegen
„Thesendramen", gegen sogenannte „Problemromane" mag man sich mit Recht
wehren. Aber „Ideen" sind eben keine Lehrsätze oder „Sentenzen"; sie sind
auch keine Begriffe. „Ideen" sind unmittelbare geistige Anschauungen vom
inneren Wesen einer Sache, sie geben mit einem Male natürlich, was der Begriff
der Wissenschaft erst auf Umwegen künstlich gibt. Die Idee der Kindesliebe
ist keine Sache, die uns erst die Wissenschaft zur Erkenntnis bringt. Ein naives
Gemüt erfaßt sie tief genug. Warum sollte ein Maler von der köstlichen Be-
gabung, solche Dinge mit geistigen Augen zu sehen, ausgeschlossen sein ?
Es würde nicht allzu schwer fallen, nachzuweisen, daß sich die Weltanschauung
eines Künstlers sogar in Landschaften, Stilleben, Blumen-, Tierstücken und
Porträts ausprägt. Aber bei religiösen Stoffen läßt sich der Natur der Sache nach
das Mitwirken einzelner Ideen noch leichter aufzeigen.
Ein Hauptmittel ist der urkundliche Beleg dafür, daß ein großer Künstler
für einen Altar oder eine ganze Kirche die Ausmalung im Sinne des kirchlichen
Auftraggebers übernahm. In dem Aschaffenburger „Mana-Schnee-Altar" des
Meisters Matthias Grünewald, der kürzlich hier in dieser Zeitschrift (XXX, 139 ff.)
erwähnt wurde, haben wir ein gutes Beispiel solcher Beeinflussung. Der Maler
hat die Absicht des Bestellers, Kanonikus Reitzmann, schlicht und recht über-
nommen; sie bestand dann, „die Verehrung des Festes" der Sancta Maria ad
Nives „zu erwecken", und Grünewald hat dem Wunderglauben, den die Legende
voraussetzt, in psychologisch notwendiger Form vollen Ausdruck gegeben. Er
verfällt, wie übrigens auch bei dem Isenheimer Altar, auf eine eigentümliche
Zeit-Raum-Mystik: ein und dieselbe Person kommt innerhalb der gleichen Bild-
emheit, also im gleichen Raum zweimal in verschiedenen Situationen vor, die
zeitlich voneinander getrennt sind. Bekanntlich lautet die Legende, die auch
Kanonikus Reitzmann in einem eigenen Buch erzählt hatte, daß ein römisches
Patrizierehepaar im August nachts träumte, es solle dort, wo am nächsten Tage
Schnee gefallen sei, eine Kapelle errichten. Den gleichen Traum hatte in der
gleichen Nacht der Papst Libenus. Der Schnee wird anderen Tags auf dem
Esquilin entdeckt und sogleich zur Tat geschritten. Grünewald stellt das Ganze
einheitlich dar: Vorn legt der Papst im vollen Ornat, von dem Patrizierehepaar