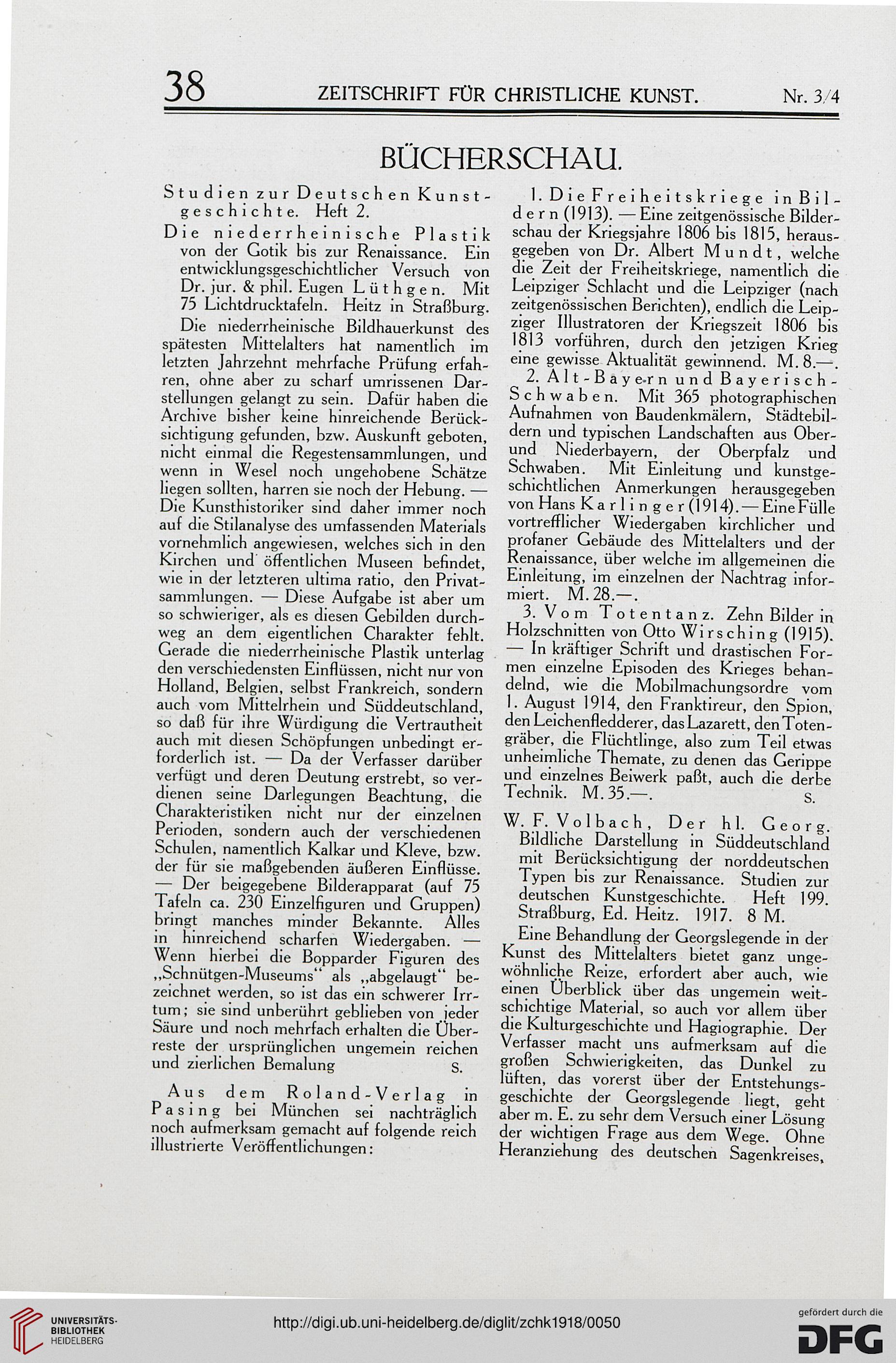38
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
Nr. 3. 4
BÜCHERSCHAU.
Studien zur Deutschen Kunst-
geschichte. Heft 2.
Die niederrheinische Plastik
von der Gotik bis zur Renaissance. Ein
entwicklungsgeschichtlicher Versuch von
Dr. jur. & phil. Eugen L ü t h g e n. Mit
75 Lichtdrucktafeln. Heitz in Straßburg.
Die niederrheinische Bildhauerkunst des
spätesten Mittelalters hat namentlich im
letzten Jahrzehnt mehrfache Prüfung erfah-
ren, ohne aber zu scharf umnssenen Dar-
stellungen gelangt zu sein. Dafür haben die
Archive bisher keine hinreichende Berück-
sichtigung gefunden, bzw. Auskunft geboten,
nicht einmal die Regestensammlungen, und
wenn in Wesel noch ungehobene Schätze
liegen sollten, harren sie noch der Hebung. —
Die Kunsthistoriker sind daher immer noch
auf die Stilanalyse des umfassenden Materials
vornehmlich angewiesen, welches sich in den
Kirchen und öffentlichen Museen befindet,
wie in der letzteren ultima ratio, den Privat-
sammlungen. — Diese Aufgabe ist aber um
so schwieriger, als es diesen Gebilden durch-
weg an dem eigentlichen Charakter fehlt.
Gerade die niederrheinische Plastik unterlag
den verschiedensten Einflüssen, nicht nur von
Holland, Belgien, selbst Frankreich, sondern
auch vom Mittelrhein und Süddeutschland,
so daß für ihre Würdigung die Vertrautheit
auch mit diesen Schöpfungen unbedingt er-
forderlich ist. — Da der Verfasser darüber
verfügt und deren Deutung erstrebt, so ver-
dienen seine Darlegungen Beachtung, die
Charakteristiken nicht nur der einzelnen
Perioden, sondern auch der verschiedenen
Schulen, namentlich Kaikar und Kleve, bzw.
der für sie maßgebenden äußeren Einflüsse.
— Der beigegebene Bilderapparat (auf 75
Tafeln ca. 230 Einzelfiguren und Gruppen)
bringt manches minder Bekannte. Alles
in hinreichend scharfen Wiedergaben. —
Wenn hierbei die Bopparder Figuren des
„Schnütgen-Museums" als „abgelaugt" be-
zeichnet werden, so ist das ein schwerer Irr-
tum; sie sind unberührt geblieben von jeder
Säure und noch mehrfach erhalten die Über-
reste der ursprünglichen ungemein reichen
und zierlichen Bemalung S.
Aus dem Roland-Verlag in
P a s i n g bei München sei nachträglich
noch aufmerksam gemacht auf folgende reich
illustrierte Veröffentlichungen:
1. Die Freiheitskriege in Bil-
dern (1913). —Eine zeitgenössische Bilder-
schau der Kriegsjahre 1806 bis 1815, heraus-
gegeben von Dr. Albert M u n d t , welche
die Zeit der Freiheitskriege, namentlich die
Leipziger Schlacht und die Leipziger (nach
zeitgenössischen Berichten), endlich die Leip-
ziger Illustratoren der Kriegszeit 1806 bis
1813 vorführen, durch den jetzigen Krieg
eine gewisse Aktualität gewinnend. M. 8.—.
2. Alt-Baye-rn und Bayerisch-
Schwaben. Mit 365 photographischen
Aufnahmen von Baudenkmälern, Städtebil-
dern und typischen Landschaften aus Ober-
und Niederbayern, der Oberpfalz und
Schwaben. Mit Einleitung und kunstge-
schichthchen Anmerkungen herausgegeben
von Hans Ka r 1 i n g e r (1914). — Eine Fülle
vortrefflicher Wiedergaben kirchlicher und
profaner Gebäude des Mittelalters und der
Renaissance, über welche im allgemeinen die
Einleitung, im einzelnen der Nachtrag infor-
miert. M.28—.
3. Vom Totentanz. Zehn Bilder in
Holzschnitten von Otto Wirsching (1915).
— In kräftiger Schrift und drastischen For-
men einzelne Episoden des Krieges behan-
delnd, wie die Mobilmachungsordre vom
I. August 1914, den Franktireur, den Spion,
den Leichenfledderer, das Lazarett, den Toten-
gräber, die Flüchtlinge, also zum Teil etwas
unheimliche Themate, zu denen das Gerippe
und einzelnes Beiwerk paßt, auch die derbe
Technik. M.35—. S.
W. F. Volbach, Der hl. Georg.
Bildliche Darstellung in Süddeutschland
mit Berücksichtigung der norddeutschen
Typen bis zur Renaissance. Studien zur
deutschen Kunstgeschichte. Heft 199.
Straßburg, Ed. Heitz. 1917. 8 M.
Eine Behandlung der Georgslegende in der
Kunst des Mittelalters bietet ganz unge-
wöhnliche Reize, erfordert aber auch, wie
einen Überblick über das ungemein weit-
schichtige Material, so auch vor allem über
die Kulturgeschichte und Hagiographie. Der
Verfasser macht uns aufmerksam auf die
großen Schwierigkeiten, das Dunkel zu
lüften, das vorerst über der Entstehungs-
geschichte der Georgslegende liegt, geht
aber m. E. zu sehr dem Versuch einer Lösung
der wichtigen Frage aus dem Wege. Ohne
Heranziehung des deutschen Sagenkreises,
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
Nr. 3. 4
BÜCHERSCHAU.
Studien zur Deutschen Kunst-
geschichte. Heft 2.
Die niederrheinische Plastik
von der Gotik bis zur Renaissance. Ein
entwicklungsgeschichtlicher Versuch von
Dr. jur. & phil. Eugen L ü t h g e n. Mit
75 Lichtdrucktafeln. Heitz in Straßburg.
Die niederrheinische Bildhauerkunst des
spätesten Mittelalters hat namentlich im
letzten Jahrzehnt mehrfache Prüfung erfah-
ren, ohne aber zu scharf umnssenen Dar-
stellungen gelangt zu sein. Dafür haben die
Archive bisher keine hinreichende Berück-
sichtigung gefunden, bzw. Auskunft geboten,
nicht einmal die Regestensammlungen, und
wenn in Wesel noch ungehobene Schätze
liegen sollten, harren sie noch der Hebung. —
Die Kunsthistoriker sind daher immer noch
auf die Stilanalyse des umfassenden Materials
vornehmlich angewiesen, welches sich in den
Kirchen und öffentlichen Museen befindet,
wie in der letzteren ultima ratio, den Privat-
sammlungen. — Diese Aufgabe ist aber um
so schwieriger, als es diesen Gebilden durch-
weg an dem eigentlichen Charakter fehlt.
Gerade die niederrheinische Plastik unterlag
den verschiedensten Einflüssen, nicht nur von
Holland, Belgien, selbst Frankreich, sondern
auch vom Mittelrhein und Süddeutschland,
so daß für ihre Würdigung die Vertrautheit
auch mit diesen Schöpfungen unbedingt er-
forderlich ist. — Da der Verfasser darüber
verfügt und deren Deutung erstrebt, so ver-
dienen seine Darlegungen Beachtung, die
Charakteristiken nicht nur der einzelnen
Perioden, sondern auch der verschiedenen
Schulen, namentlich Kaikar und Kleve, bzw.
der für sie maßgebenden äußeren Einflüsse.
— Der beigegebene Bilderapparat (auf 75
Tafeln ca. 230 Einzelfiguren und Gruppen)
bringt manches minder Bekannte. Alles
in hinreichend scharfen Wiedergaben. —
Wenn hierbei die Bopparder Figuren des
„Schnütgen-Museums" als „abgelaugt" be-
zeichnet werden, so ist das ein schwerer Irr-
tum; sie sind unberührt geblieben von jeder
Säure und noch mehrfach erhalten die Über-
reste der ursprünglichen ungemein reichen
und zierlichen Bemalung S.
Aus dem Roland-Verlag in
P a s i n g bei München sei nachträglich
noch aufmerksam gemacht auf folgende reich
illustrierte Veröffentlichungen:
1. Die Freiheitskriege in Bil-
dern (1913). —Eine zeitgenössische Bilder-
schau der Kriegsjahre 1806 bis 1815, heraus-
gegeben von Dr. Albert M u n d t , welche
die Zeit der Freiheitskriege, namentlich die
Leipziger Schlacht und die Leipziger (nach
zeitgenössischen Berichten), endlich die Leip-
ziger Illustratoren der Kriegszeit 1806 bis
1813 vorführen, durch den jetzigen Krieg
eine gewisse Aktualität gewinnend. M. 8.—.
2. Alt-Baye-rn und Bayerisch-
Schwaben. Mit 365 photographischen
Aufnahmen von Baudenkmälern, Städtebil-
dern und typischen Landschaften aus Ober-
und Niederbayern, der Oberpfalz und
Schwaben. Mit Einleitung und kunstge-
schichthchen Anmerkungen herausgegeben
von Hans Ka r 1 i n g e r (1914). — Eine Fülle
vortrefflicher Wiedergaben kirchlicher und
profaner Gebäude des Mittelalters und der
Renaissance, über welche im allgemeinen die
Einleitung, im einzelnen der Nachtrag infor-
miert. M.28—.
3. Vom Totentanz. Zehn Bilder in
Holzschnitten von Otto Wirsching (1915).
— In kräftiger Schrift und drastischen For-
men einzelne Episoden des Krieges behan-
delnd, wie die Mobilmachungsordre vom
I. August 1914, den Franktireur, den Spion,
den Leichenfledderer, das Lazarett, den Toten-
gräber, die Flüchtlinge, also zum Teil etwas
unheimliche Themate, zu denen das Gerippe
und einzelnes Beiwerk paßt, auch die derbe
Technik. M.35—. S.
W. F. Volbach, Der hl. Georg.
Bildliche Darstellung in Süddeutschland
mit Berücksichtigung der norddeutschen
Typen bis zur Renaissance. Studien zur
deutschen Kunstgeschichte. Heft 199.
Straßburg, Ed. Heitz. 1917. 8 M.
Eine Behandlung der Georgslegende in der
Kunst des Mittelalters bietet ganz unge-
wöhnliche Reize, erfordert aber auch, wie
einen Überblick über das ungemein weit-
schichtige Material, so auch vor allem über
die Kulturgeschichte und Hagiographie. Der
Verfasser macht uns aufmerksam auf die
großen Schwierigkeiten, das Dunkel zu
lüften, das vorerst über der Entstehungs-
geschichte der Georgslegende liegt, geht
aber m. E. zu sehr dem Versuch einer Lösung
der wichtigen Frage aus dem Wege. Ohne
Heranziehung des deutschen Sagenkreises,