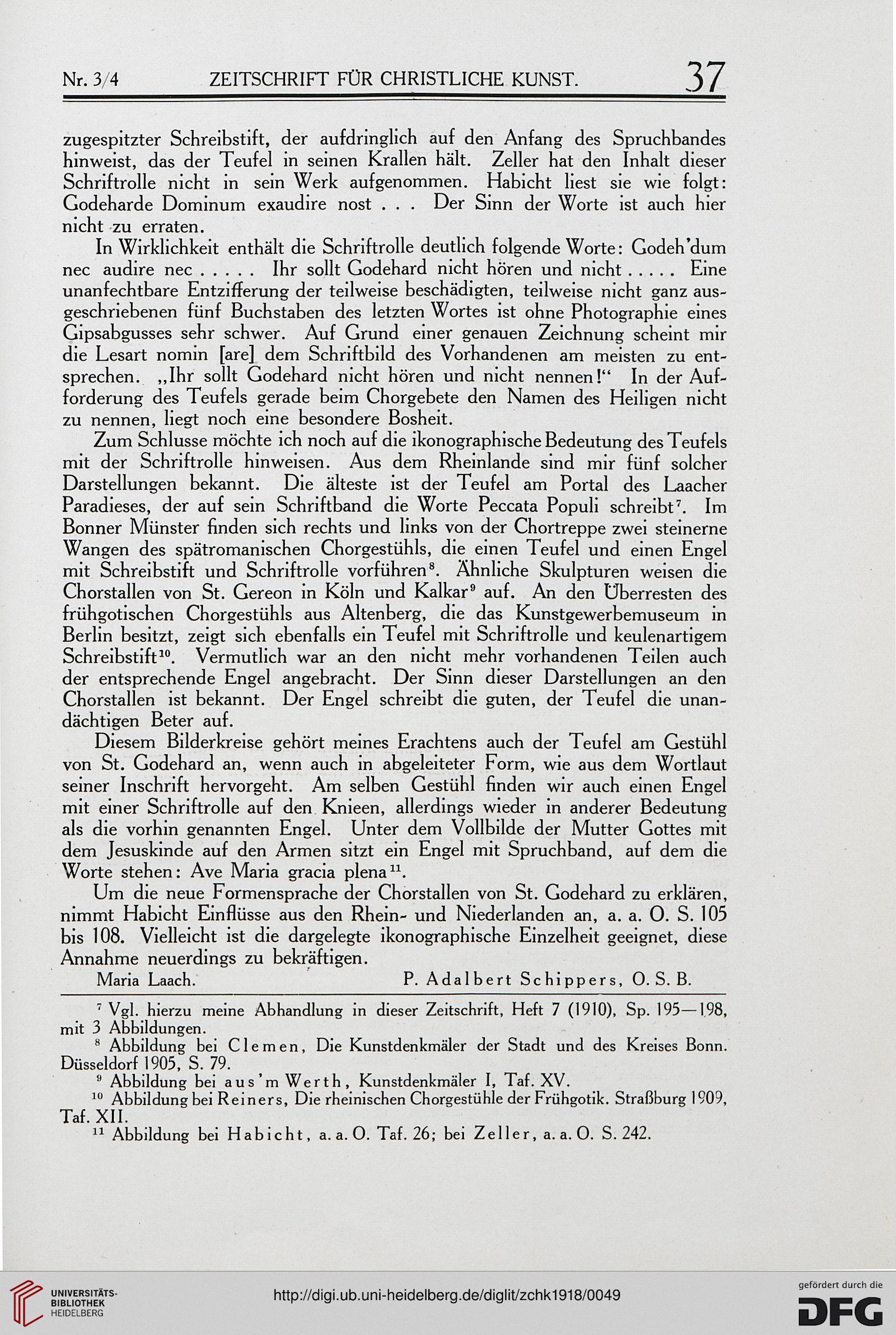Nr. 3/4__________ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.____________37
zugespitzter Schreibstift, der aufdringlich auf den Anfang des Spruchbandes
hinweist, das der Teufel in seinen Krallen hält. Zeller hat den Inhalt dieser
Schriftrolle nicht in sein Werk aufgenommen. Habicht liest sie wie folgt:
Godeharde Dominum exaudire nost . . . Der Sinn der Worte ist auch hier
nicht zu erraten.
In Wirklichkeit enthält die Schriftrolle deutlich folgende Worte: Godeh'dum
nee audire nee..... Ihr sollt Godehard nicht hören und nicht..... Eine
unanfechtbare Entzifferung der teilweise beschädigten, teilweise nicht ganz aus-
geschriebenen fünf Buchstaben des letzten Wortes ist ohne Photographie eines
Gipsabgusses sehr schwer. Auf Grund einer genauen Zeichnung scheint mir
die Lesart nomin [are] dem Schriftbild des Vorhandenen am meisten zu ent-
sprechen. „Ihr sollt Godehard nicht hören und nicht nennen!" In der Auf-
forderung des Teufels gerade beim Chorgebete den Namen des Heiligen nicht
zu nennen, liegt noch eine besondere Bosheit.
Zum Schlüsse möchte ich noch auf die ikonographische Bedeutung des Teufels
mit der Schriftrolle hinweisen. Aus dem Rheinlande sind mir fünf solcher
Darstellungen bekannt. Die älteste ist der Teufel am Portal des Laacher
Paradieses, der auf sein Schriftband die Worte Peccata Populi schreibt7. Im
Bonner Münster finden sich rechts und links von der Chortreppe zwei steinerne
Wangen des spätromanischen Chorgestühls, die einen Teufel und einen Engel
mit Schreibstift und Schriftrolle vorführen8. Ähnliche Skulpturen weisen die
Chorstallen von St. Gereon in Köln und Kaikar9 auf. An den Überresten des
frühgotischen Chorgestühls aus Altenberg, die das Kunstgewerbemuseum in
Berlin besitzt, zeigt sich ebenfalls ein Teufel mit Schriftrolle und keulenartigem
Schreibstift10. Vermutlich war an den nicht mehr vorhandenen Teilen auch
der entsprechende Engel angebracht. Der Sinn dieser Darstellungen an den
Chorstallen ist bekannt. Der Engel schreibt die guten, der Teufel die unan-
dächtigen Beter auf.
Diesem Bilderkreise gehört meines Erachtens auch der Teufel am Gestühl
von St. Godehard an, wenn auch in abgeleiteter Form, wie aus dem Wortlaut
seiner Inschrift hervorgeht. Am selben Gestühl finden wir auch einen Engel
mit einer Schriftrolle auf den Knieen, allerdings wieder in anderer Bedeutung
als die vorhin genannten Engel. Unter dem Vollbilde der Mutter Gottes mit
dem Jesuskinde auf den Armen sitzt ein Engel mit Spruchband, auf dem die
Worte stehen: Ave Maria gracia plena11.
Um die neue Formensprache der Chorstallen von St. Godehard zu erklären,
nimmt Habicht Einflüsse aus den Rhein- und Niederlanden an, a. a. 0. S. 105
bis 108. Vielleicht ist die dargelegte ikonographische Einzelheit geeignet, diese
Annahme neuerdings zu bekräftigen.
Maria Laach. P. Adalbert Schippers, 0. S. B.
7 Vgl. hierzu meine Abhandlung in dieser Zeitschrift, Heft 7 (1910), Sp. 195—198,
mit 3 Abbildungen.
s Abbildung bei C lernen, Die Kunstdenkmäler der Stadt und des Kreises Bonn.
Düsseldorf 1905, S. 79.
9 Abbildung bei aus'm Werth, Kunstdenkmäler I, Taf. XV.
10 Abbildung bei Reiners, Die rheinischen Chorgestühle der Frühgotik. Straßburg 1909,
Taf. XII.
11 Abbildung bei Habicht, a.a.O. Taf. 26; bei Zeller, a.a.O. S. 242.
zugespitzter Schreibstift, der aufdringlich auf den Anfang des Spruchbandes
hinweist, das der Teufel in seinen Krallen hält. Zeller hat den Inhalt dieser
Schriftrolle nicht in sein Werk aufgenommen. Habicht liest sie wie folgt:
Godeharde Dominum exaudire nost . . . Der Sinn der Worte ist auch hier
nicht zu erraten.
In Wirklichkeit enthält die Schriftrolle deutlich folgende Worte: Godeh'dum
nee audire nee..... Ihr sollt Godehard nicht hören und nicht..... Eine
unanfechtbare Entzifferung der teilweise beschädigten, teilweise nicht ganz aus-
geschriebenen fünf Buchstaben des letzten Wortes ist ohne Photographie eines
Gipsabgusses sehr schwer. Auf Grund einer genauen Zeichnung scheint mir
die Lesart nomin [are] dem Schriftbild des Vorhandenen am meisten zu ent-
sprechen. „Ihr sollt Godehard nicht hören und nicht nennen!" In der Auf-
forderung des Teufels gerade beim Chorgebete den Namen des Heiligen nicht
zu nennen, liegt noch eine besondere Bosheit.
Zum Schlüsse möchte ich noch auf die ikonographische Bedeutung des Teufels
mit der Schriftrolle hinweisen. Aus dem Rheinlande sind mir fünf solcher
Darstellungen bekannt. Die älteste ist der Teufel am Portal des Laacher
Paradieses, der auf sein Schriftband die Worte Peccata Populi schreibt7. Im
Bonner Münster finden sich rechts und links von der Chortreppe zwei steinerne
Wangen des spätromanischen Chorgestühls, die einen Teufel und einen Engel
mit Schreibstift und Schriftrolle vorführen8. Ähnliche Skulpturen weisen die
Chorstallen von St. Gereon in Köln und Kaikar9 auf. An den Überresten des
frühgotischen Chorgestühls aus Altenberg, die das Kunstgewerbemuseum in
Berlin besitzt, zeigt sich ebenfalls ein Teufel mit Schriftrolle und keulenartigem
Schreibstift10. Vermutlich war an den nicht mehr vorhandenen Teilen auch
der entsprechende Engel angebracht. Der Sinn dieser Darstellungen an den
Chorstallen ist bekannt. Der Engel schreibt die guten, der Teufel die unan-
dächtigen Beter auf.
Diesem Bilderkreise gehört meines Erachtens auch der Teufel am Gestühl
von St. Godehard an, wenn auch in abgeleiteter Form, wie aus dem Wortlaut
seiner Inschrift hervorgeht. Am selben Gestühl finden wir auch einen Engel
mit einer Schriftrolle auf den Knieen, allerdings wieder in anderer Bedeutung
als die vorhin genannten Engel. Unter dem Vollbilde der Mutter Gottes mit
dem Jesuskinde auf den Armen sitzt ein Engel mit Spruchband, auf dem die
Worte stehen: Ave Maria gracia plena11.
Um die neue Formensprache der Chorstallen von St. Godehard zu erklären,
nimmt Habicht Einflüsse aus den Rhein- und Niederlanden an, a. a. 0. S. 105
bis 108. Vielleicht ist die dargelegte ikonographische Einzelheit geeignet, diese
Annahme neuerdings zu bekräftigen.
Maria Laach. P. Adalbert Schippers, 0. S. B.
7 Vgl. hierzu meine Abhandlung in dieser Zeitschrift, Heft 7 (1910), Sp. 195—198,
mit 3 Abbildungen.
s Abbildung bei C lernen, Die Kunstdenkmäler der Stadt und des Kreises Bonn.
Düsseldorf 1905, S. 79.
9 Abbildung bei aus'm Werth, Kunstdenkmäler I, Taf. XV.
10 Abbildung bei Reiners, Die rheinischen Chorgestühle der Frühgotik. Straßburg 1909,
Taf. XII.
11 Abbildung bei Habicht, a.a.O. Taf. 26; bei Zeller, a.a.O. S. 242.