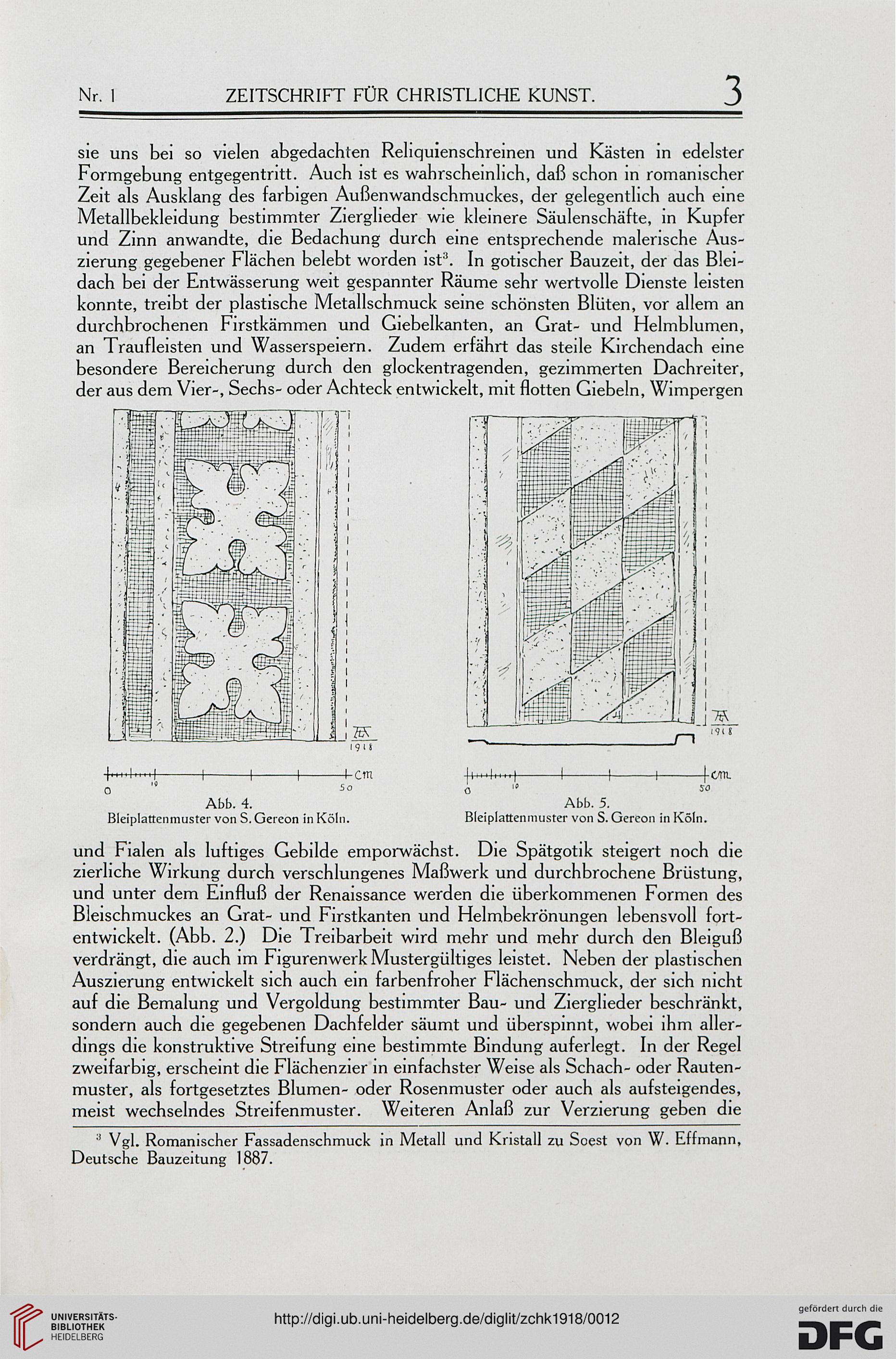Nr. 1
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
sie uns bei so vielen abgedachten Reliquienschreinen und Kästen in edelster
Formgebung entgegentritt. Auch ist es wahrscheinlich, daß schon in romanischer
Zeit als Ausklang des farbigen Außenwandschmuckes, der gelegentlich auch eine
Metallbekleidung bestimmter Zierglieder wie kleinere Säulenschäfte, in Kupfer
und Zinn anwandte, die Bedachung durch eine entsprechende malerische Aus-
zierung gegebener Flächen belebt worden ist:i. In gotischer Bauzeit, der das Blei-
dach bei der Entwässerung weit gespannter Räume sehr wertvolle Dienste leisten
konnte, treibt der plastische Metallschmuck seine schönsten Blüten, vor allem an
durchbrochenen Firstkämmen und Giebelkanten, an Grat- und Helmblumen,
an Traufleisten und Wasserspeiern. Zudem erfährt das steile Kirchendach eine
besondere Bereicherung durch den glockentragenden, gezimmerten Dachreiter,
der aus dem Vier-, Sechs- oder Achteck entwickelt, mit flotten Giebeln, Wimpergen
7g:
1911
Abb. 4.
Bleiplattenmuster von S. Gereon in Köli
-cm
|i'"l""l
Abb. 5.
Bleiplattenmuster von S. Gereon in Köln.
-cm.
und Fialen als luftiges Gebilde emporwächst. Die Spätgotik steigert noch die
zierliche Wirkung durch verschlungenes Maßwerk und durchbrochene Brüstung,
und unter dem Einfluß der Renaissance werden die überkommenen Formen des
Bleischmuckes an Grat- und Firstkanten und Helmbekrönungen lebensvoll fort-
entwickelt. (Abb. 2.) Die Treibarbeit wird mehr und mehr durch den Bleiguß
verdrängt, die auch im Figurenwerk Mustergültiges leistet. Neben der plastischen
Auszierung entwickelt sich auch ein farbenfroher Flächenschmuck, der sich nicht
auf die Bemalung und Vergoldung bestimmter Bau- und Zierglieder beschränkt,
sondern auch die gegebenen Dachfelder säumt und überspinnt, wobei ihm aller-
dings die konstruktive Streifung eine bestimmte Bindung auferlegt. In der Regel
zweifarbig, erscheint die Flächenzier in einfachster Weise als Schach- oder Rauten-
muster, als fortgesetztes Blumen- oder Rosenmuster oder auch als aufsteigendes,
meist wechselndes Streifenmuster. Weiteren Anlaß zur Verzierung geben die
;l Vgl. Romanischer Fassadenschmuck in Metall und Kristall zu Soest von W. Effmann,
Deutsche Bauzeitung 1887.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
sie uns bei so vielen abgedachten Reliquienschreinen und Kästen in edelster
Formgebung entgegentritt. Auch ist es wahrscheinlich, daß schon in romanischer
Zeit als Ausklang des farbigen Außenwandschmuckes, der gelegentlich auch eine
Metallbekleidung bestimmter Zierglieder wie kleinere Säulenschäfte, in Kupfer
und Zinn anwandte, die Bedachung durch eine entsprechende malerische Aus-
zierung gegebener Flächen belebt worden ist:i. In gotischer Bauzeit, der das Blei-
dach bei der Entwässerung weit gespannter Räume sehr wertvolle Dienste leisten
konnte, treibt der plastische Metallschmuck seine schönsten Blüten, vor allem an
durchbrochenen Firstkämmen und Giebelkanten, an Grat- und Helmblumen,
an Traufleisten und Wasserspeiern. Zudem erfährt das steile Kirchendach eine
besondere Bereicherung durch den glockentragenden, gezimmerten Dachreiter,
der aus dem Vier-, Sechs- oder Achteck entwickelt, mit flotten Giebeln, Wimpergen
7g:
1911
Abb. 4.
Bleiplattenmuster von S. Gereon in Köli
-cm
|i'"l""l
Abb. 5.
Bleiplattenmuster von S. Gereon in Köln.
-cm.
und Fialen als luftiges Gebilde emporwächst. Die Spätgotik steigert noch die
zierliche Wirkung durch verschlungenes Maßwerk und durchbrochene Brüstung,
und unter dem Einfluß der Renaissance werden die überkommenen Formen des
Bleischmuckes an Grat- und Firstkanten und Helmbekrönungen lebensvoll fort-
entwickelt. (Abb. 2.) Die Treibarbeit wird mehr und mehr durch den Bleiguß
verdrängt, die auch im Figurenwerk Mustergültiges leistet. Neben der plastischen
Auszierung entwickelt sich auch ein farbenfroher Flächenschmuck, der sich nicht
auf die Bemalung und Vergoldung bestimmter Bau- und Zierglieder beschränkt,
sondern auch die gegebenen Dachfelder säumt und überspinnt, wobei ihm aller-
dings die konstruktive Streifung eine bestimmte Bindung auferlegt. In der Regel
zweifarbig, erscheint die Flächenzier in einfachster Weise als Schach- oder Rauten-
muster, als fortgesetztes Blumen- oder Rosenmuster oder auch als aufsteigendes,
meist wechselndes Streifenmuster. Weiteren Anlaß zur Verzierung geben die
;l Vgl. Romanischer Fassadenschmuck in Metall und Kristall zu Soest von W. Effmann,
Deutsche Bauzeitung 1887.