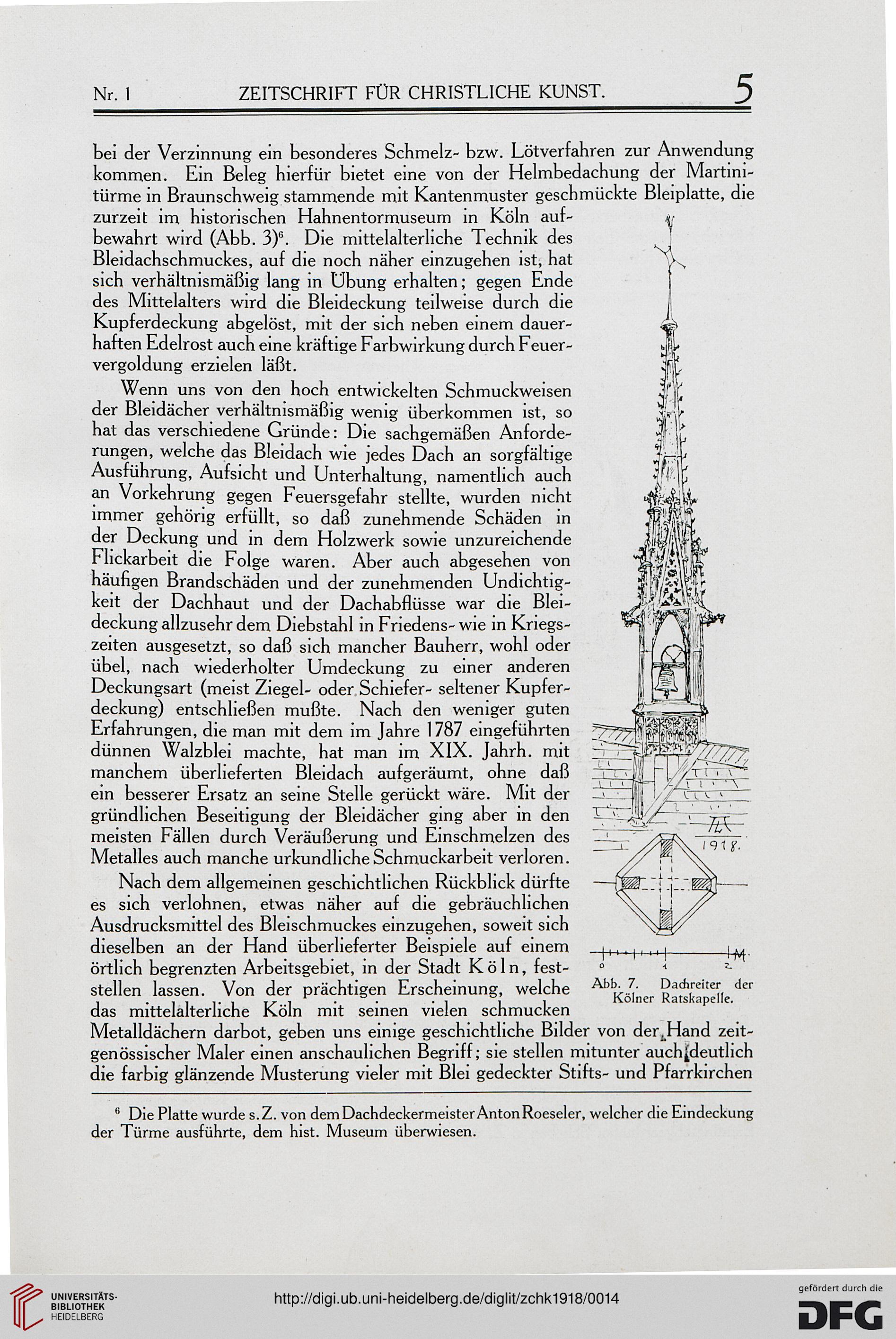Nr
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
bei der Verzinnung ein besonderes Schmelz- bzw. Lötverfahren zur Anwendung
kommen. Ein Beleg hierfür bietet eine von der Helmbedachung der Martini-
türme in Braunschweig stammende mit Kantenmuster geschmückte Bleiplatte, die
zurzeit im historischen Hahnentormuseum in Köln auf- *,■
bewahrt wird (Abb. 3)". Die mittelalterliche Technik des
Bleidachschmuckes, auf die noch näher einzugehen ist, hat
sich verhältnismäßig lang in Übung erhalten; gegen Ende
des Mittelalters wird die Bleideckung teilweise durch die
Kupferdeckung abgelöst, mit der sich neben einem dauer-
haften Edelrost auch eine kräftige Farbwirkung durch Feuer-
vergoldung erzielen läßt.
Wenn uns von den hoch entwickelten Schmuckweisen
der Bleidächer verhältnismäßig wenig überkommen ist, so
hat das verschiedene Gründe: Die sachgemäßen Anforde-
rungen, welche das Bleidach wie jedes Dach an sorgfältige
Ausführung, Aufsicht und Unterhaltung, namentlich auch
an Vorkehrung gegen Feuersgefahr stellte, wurden nicht
immer gehörig erfüllt, so daß zunehmende Schäden in
der Deckung und in dem Holzwerk sowie unzureichende
rhckarbeit die Folge waren. Aber auch abgesehen von
häufigen Brandschäden und der zunehmenden Undichtig-
keit der Dachhaut und der Dachabflüsse war die Blei-
deckung allzusehr dem Diebstahl in Friedens-wie in Kriegs-
zeiten ausgesetzt, so daß sich mancher Bauherr, wohl oder
übel, nach wiederholter Umdeckung zu einer anderen
Deckungsart (meist Ziegel- oder Schiefer- seltener Kupfer-
deckung) entschließen mußte. Nach den weniger guten
Erfahrungen, die man mit dem im Jahre 1787 eingeführten
dünnen Walzblei machte, hat man im XIX. Jahrh. mit
manchem überlieferten Bleidach aufgeräumt, ohne daß
ein besserer Ersatz an seine Stelle gerückt wäre. Mit der
gründlichen Beseitigung der Bleidächer ging aber in den
meisten Fällen durch Veräußerung und Einschmelzen des
Metalles auch manche urkundliche Schmuckarbeit verloren.
Nach dem allgemeinen geschichtlichen Rückblick dürfte
es sich verlohnen, etwas näher auf die gebräuchlichen
Ausdrucksmittel des Bleischmuckes einzugehen, soweit sich
dieselben an der Hand überlieferter Beispiele auf einem
örtlich begrenzten Arbeitsgebiet, in der Stadt Köln, fest-
stellen lassen. Von der prächtigen Erscheinung, welche
das mittelalterliche Köln mit seinen vielen schmucken
Metalldächern darbot, geben uns einige geschichtliche Bilder von dertHand zeit-
genössischer Maler einen anschaulichen Begriff; sie stellen mitunter auch^deutlich
die farbig glänzende Musterung vieler mit Blei gedeckter Stifts- und Pfarrkirchen
191 g.
Abb. 7. Dachreiter der
Kölner Ratskapelle.
6 Die Platte wurde s.Z. von dem Dachdeckermeister Anton Roeseler, welcher die Eindeckung
der Türme ausführte, dem hist. Museum überwiesen.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
bei der Verzinnung ein besonderes Schmelz- bzw. Lötverfahren zur Anwendung
kommen. Ein Beleg hierfür bietet eine von der Helmbedachung der Martini-
türme in Braunschweig stammende mit Kantenmuster geschmückte Bleiplatte, die
zurzeit im historischen Hahnentormuseum in Köln auf- *,■
bewahrt wird (Abb. 3)". Die mittelalterliche Technik des
Bleidachschmuckes, auf die noch näher einzugehen ist, hat
sich verhältnismäßig lang in Übung erhalten; gegen Ende
des Mittelalters wird die Bleideckung teilweise durch die
Kupferdeckung abgelöst, mit der sich neben einem dauer-
haften Edelrost auch eine kräftige Farbwirkung durch Feuer-
vergoldung erzielen läßt.
Wenn uns von den hoch entwickelten Schmuckweisen
der Bleidächer verhältnismäßig wenig überkommen ist, so
hat das verschiedene Gründe: Die sachgemäßen Anforde-
rungen, welche das Bleidach wie jedes Dach an sorgfältige
Ausführung, Aufsicht und Unterhaltung, namentlich auch
an Vorkehrung gegen Feuersgefahr stellte, wurden nicht
immer gehörig erfüllt, so daß zunehmende Schäden in
der Deckung und in dem Holzwerk sowie unzureichende
rhckarbeit die Folge waren. Aber auch abgesehen von
häufigen Brandschäden und der zunehmenden Undichtig-
keit der Dachhaut und der Dachabflüsse war die Blei-
deckung allzusehr dem Diebstahl in Friedens-wie in Kriegs-
zeiten ausgesetzt, so daß sich mancher Bauherr, wohl oder
übel, nach wiederholter Umdeckung zu einer anderen
Deckungsart (meist Ziegel- oder Schiefer- seltener Kupfer-
deckung) entschließen mußte. Nach den weniger guten
Erfahrungen, die man mit dem im Jahre 1787 eingeführten
dünnen Walzblei machte, hat man im XIX. Jahrh. mit
manchem überlieferten Bleidach aufgeräumt, ohne daß
ein besserer Ersatz an seine Stelle gerückt wäre. Mit der
gründlichen Beseitigung der Bleidächer ging aber in den
meisten Fällen durch Veräußerung und Einschmelzen des
Metalles auch manche urkundliche Schmuckarbeit verloren.
Nach dem allgemeinen geschichtlichen Rückblick dürfte
es sich verlohnen, etwas näher auf die gebräuchlichen
Ausdrucksmittel des Bleischmuckes einzugehen, soweit sich
dieselben an der Hand überlieferter Beispiele auf einem
örtlich begrenzten Arbeitsgebiet, in der Stadt Köln, fest-
stellen lassen. Von der prächtigen Erscheinung, welche
das mittelalterliche Köln mit seinen vielen schmucken
Metalldächern darbot, geben uns einige geschichtliche Bilder von dertHand zeit-
genössischer Maler einen anschaulichen Begriff; sie stellen mitunter auch^deutlich
die farbig glänzende Musterung vieler mit Blei gedeckter Stifts- und Pfarrkirchen
191 g.
Abb. 7. Dachreiter der
Kölner Ratskapelle.
6 Die Platte wurde s.Z. von dem Dachdeckermeister Anton Roeseler, welcher die Eindeckung
der Türme ausführte, dem hist. Museum überwiesen.