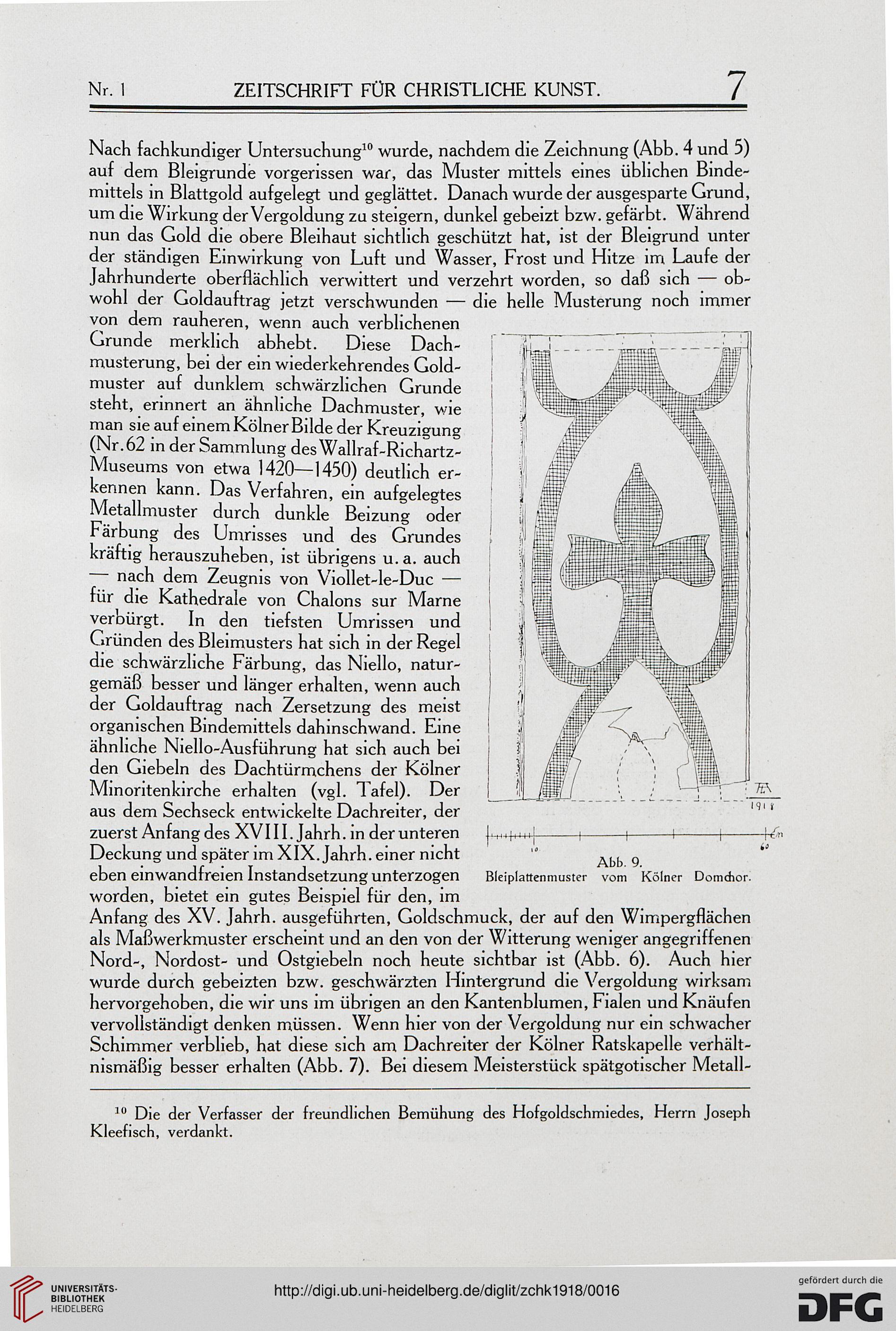Nr. 1
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
7
Nach fachkundiger Untersuchung10 wurde, nachdem die Zeichnung (Abb. 4 und 5)
auf dem Bleigrunde vorgerissen war, das Muster mittels eines üblichen Binde-
mittels in Blattgold aufgelegt und geglättet. Danach wurde der ausgesparte Grund,
um die Wirkung der Vergoldung zu steigern, dunkel gebeizt bzw. gefärbt. Während
nun das Gold die obere Bleihaut sichtlich geschützt hat, ist der Bleigrund unter
der ständigen Einwirkung von Luft und Wasser, Frost und Hitze im Laufe der
Jahrhunderte oberflächlich verwittert und verzehrt worden, so daß sich — ob-
wohl der Goldauftrag jetzt verschwunden — die helle Musterung noch immer
von dem rauheren, wenn auch verblichenen
Grunde merklich abhebt. Diese Dach-
musterung, bei der ein wiederkehrendes Gold-
muster auf dunklem schwärzlichen Grunde
steht, erinnert an ähnliche Dachmuster, wie
man sie auf einem Kölner Bilde der Kreuzigung
(Nr. 62 in der Sammlung des Wallraf-Richartz-
Museums von etwa 1420—1450) deutlich er-
kennen kann. Das Verfahren, ein aufgelegtes
Metallmuster durch dunkle Beizung oder
Färbung des Umrisses und des Grundes
kräftig herauszuheben, ist übrigens u.a. auch
nach dem Zeugnis von Viollet-le-Duc —
für die Kathedrale von Chalons sur Marne
verbürgt. In den tiefsten Umrissen und
Gründen des Bleimusters hat sich in der Regel
die schwärzliche Färbung, das Niello, natur-
gemäß besser und länger erhalten, wenn auch
der Goldauftrag nach Zersetzung des meist
organischen Bindemittels dahinschwand. Eine
ähnliche Niello-Ausführung hat sich auch bei
den Giebeln des Dachtürmchens der Kölner
Minontenkirche erhalten (vgl. Tafel). Der
aus dem Sechseck entwickelte Dachreiter, der
zuerst Anfang des XV111. Jahrh. in der unteren
Deckung und später im XIX. Jahrh. einer nicht
eben einwandfreien Instandsetzung unterzogen
worden, bietet ein gutes Beispiel für den, im
Anfang des XV. Jahrh. ausgeführten, Goldschmuck, der auf den Wimpergflächen
als Maßwerkmuster erscheint und an den von der Witterung weniger angegriffenen
Nord-, Nordost- und Ostgiebeln noch heute sichtbar ist (Abb. 6). Auch hier
wurde durch gebeizten bzw. geschwärzten Hintergrund die Vergoldung wirksam
hervorgehoben, die wir uns im übrigen an den Kantenblumen, Fialen und Knäufen
vervollständigt denken müssen. Wenn hier von der Vergoldung nur ein schwacher
Schimmer verblieb, hat diese sich am Dachreiter der Kölner Ratskapelle verhält-
nismäßig besser erhalten (Abb. 7). Bei diesem Meisterstück spätgotischer Metall-
I9i I
Ih-ii |i i ii
Abb. 9.
Bleiplattenmuster vom Kölner Domchor.
10 Die der Verfasser der freundlichen Bemühung des Hofgoldschmiedes, Herrn Joseph
Kleefisch, verdankt.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
7
Nach fachkundiger Untersuchung10 wurde, nachdem die Zeichnung (Abb. 4 und 5)
auf dem Bleigrunde vorgerissen war, das Muster mittels eines üblichen Binde-
mittels in Blattgold aufgelegt und geglättet. Danach wurde der ausgesparte Grund,
um die Wirkung der Vergoldung zu steigern, dunkel gebeizt bzw. gefärbt. Während
nun das Gold die obere Bleihaut sichtlich geschützt hat, ist der Bleigrund unter
der ständigen Einwirkung von Luft und Wasser, Frost und Hitze im Laufe der
Jahrhunderte oberflächlich verwittert und verzehrt worden, so daß sich — ob-
wohl der Goldauftrag jetzt verschwunden — die helle Musterung noch immer
von dem rauheren, wenn auch verblichenen
Grunde merklich abhebt. Diese Dach-
musterung, bei der ein wiederkehrendes Gold-
muster auf dunklem schwärzlichen Grunde
steht, erinnert an ähnliche Dachmuster, wie
man sie auf einem Kölner Bilde der Kreuzigung
(Nr. 62 in der Sammlung des Wallraf-Richartz-
Museums von etwa 1420—1450) deutlich er-
kennen kann. Das Verfahren, ein aufgelegtes
Metallmuster durch dunkle Beizung oder
Färbung des Umrisses und des Grundes
kräftig herauszuheben, ist übrigens u.a. auch
nach dem Zeugnis von Viollet-le-Duc —
für die Kathedrale von Chalons sur Marne
verbürgt. In den tiefsten Umrissen und
Gründen des Bleimusters hat sich in der Regel
die schwärzliche Färbung, das Niello, natur-
gemäß besser und länger erhalten, wenn auch
der Goldauftrag nach Zersetzung des meist
organischen Bindemittels dahinschwand. Eine
ähnliche Niello-Ausführung hat sich auch bei
den Giebeln des Dachtürmchens der Kölner
Minontenkirche erhalten (vgl. Tafel). Der
aus dem Sechseck entwickelte Dachreiter, der
zuerst Anfang des XV111. Jahrh. in der unteren
Deckung und später im XIX. Jahrh. einer nicht
eben einwandfreien Instandsetzung unterzogen
worden, bietet ein gutes Beispiel für den, im
Anfang des XV. Jahrh. ausgeführten, Goldschmuck, der auf den Wimpergflächen
als Maßwerkmuster erscheint und an den von der Witterung weniger angegriffenen
Nord-, Nordost- und Ostgiebeln noch heute sichtbar ist (Abb. 6). Auch hier
wurde durch gebeizten bzw. geschwärzten Hintergrund die Vergoldung wirksam
hervorgehoben, die wir uns im übrigen an den Kantenblumen, Fialen und Knäufen
vervollständigt denken müssen. Wenn hier von der Vergoldung nur ein schwacher
Schimmer verblieb, hat diese sich am Dachreiter der Kölner Ratskapelle verhält-
nismäßig besser erhalten (Abb. 7). Bei diesem Meisterstück spätgotischer Metall-
I9i I
Ih-ii |i i ii
Abb. 9.
Bleiplattenmuster vom Kölner Domchor.
10 Die der Verfasser der freundlichen Bemühung des Hofgoldschmiedes, Herrn Joseph
Kleefisch, verdankt.