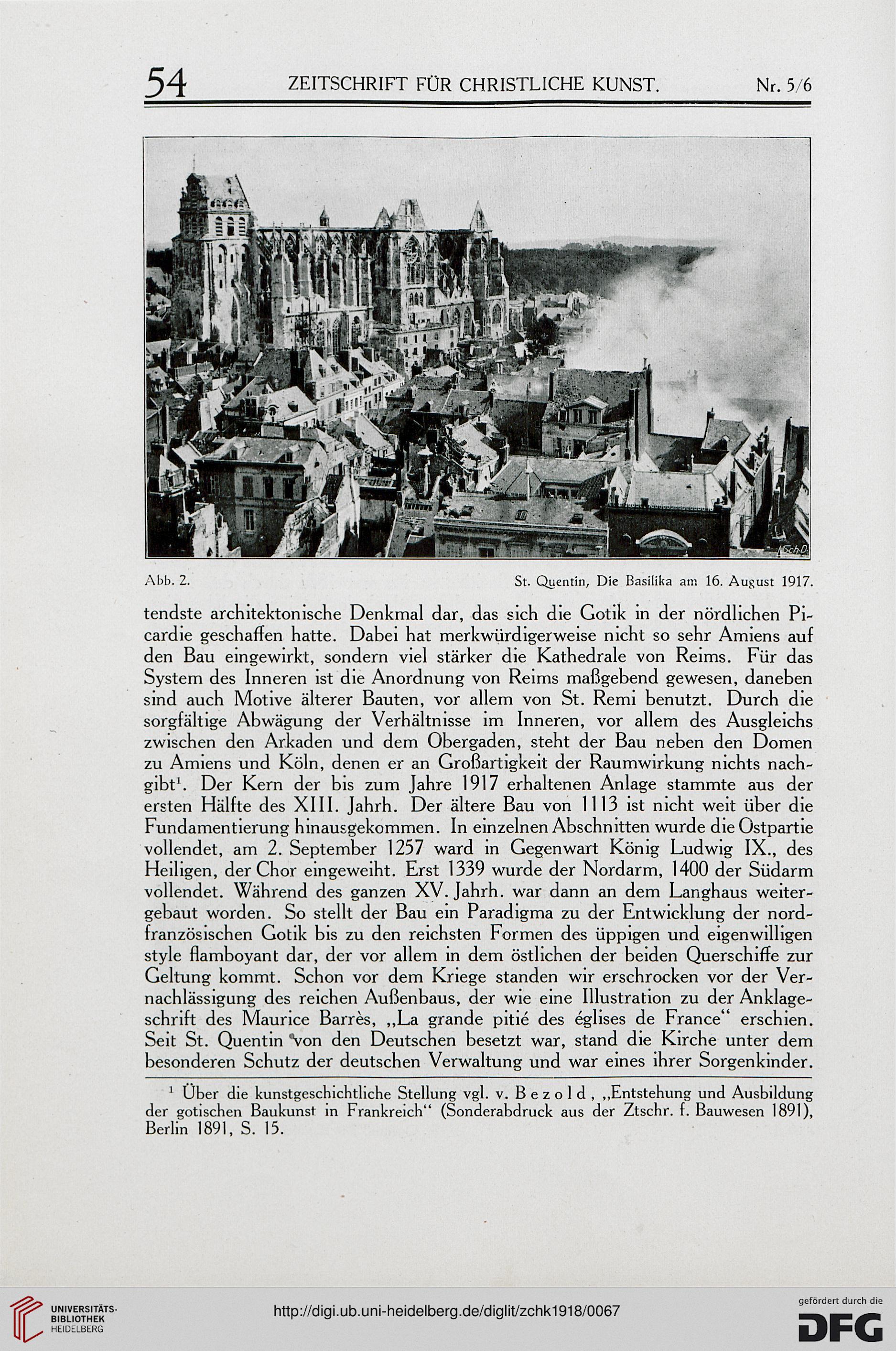54
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
Nr. 5/6
Abb. 2.
St. Quentin, Die Basilika am 16. August 1917.
tendste architektonische Denkmal dar, das sich die Gotik in der nördlichen Pi-
cardie geschaffen hatte. Dabei hat merkwürdigerweise nicht so sehr Amiens auf
den Bau eingewirkt, sondern viel stärker die Kathedrale von Reims. Für das
System des Inneren ist die Anordnung von Reims maßgebend gewesen, daneben
sind auch Motive älterer Bauten, vor allem von St. Remi benutzt. Durch die
sorgfältige Abwägung der Verhältnisse im Inneren, vor allem des Ausgleichs
zwischen den Arkaden und dem Obergaden, steht der Bau neben den Domen
zu Amiens und Köln, denen er an Großartigkeit der Raumwirkung nichts nach-
gibt1. Der Kern der bis zum Jahre 1917 erhaltenen Anlage stammte aus der
ersten Hälfte des XIII. Jahrh. Der ältere Bau von 1113 ist nicht weit über die
Fundamentierung hinausgekommen. In einzelnen Abschnitten wurde die Ostpartie
vollendet, am 2. September 1257 ward in Gegenwart König Ludwig IX., des
Heiligen, der Chor eingeweiht. Erst 1339 wurde der Nordarm, 1400 der Südarm
vollendet. Während des ganzen XV. Jahrh. war dann an dem Langhaus weiter-
gebaut worden. So stellt der Bau ein Paradigma zu der Entwicklung der nord-
französischen Gotik bis zu den reichsten Formen des üppigen und eigenwilligen
style flamboyant dar, der vor allem in dem östlichen der beiden Querschiffe zur
Geltung kommt. Schon vor dem Kriege standen wir erschrocken vor der Ver-
nachlässigung des reichen Außenbaus, der wie eine Illustration zu der Anklage-
schrift des Maurice Barres, „La grande pitie des eghses de France" erschien.
Seit St. Quentin *von den Deutschen besetzt war, stand die Kirche unter dem
besonderen Schutz der deutschen Verwaltung und war eines ihrer Sorgenkinder.
1 Über die kunstgeschichtliche Stellung vgl. v. B e z o 1 d , „Entstehung und Ausbildung
der gotischen Baukunst in Frankreich" (Sonderabdruck aus der Ztschr. f. Bauwesen 1891),
Berlin 1891, S. 15.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
Nr. 5/6
Abb. 2.
St. Quentin, Die Basilika am 16. August 1917.
tendste architektonische Denkmal dar, das sich die Gotik in der nördlichen Pi-
cardie geschaffen hatte. Dabei hat merkwürdigerweise nicht so sehr Amiens auf
den Bau eingewirkt, sondern viel stärker die Kathedrale von Reims. Für das
System des Inneren ist die Anordnung von Reims maßgebend gewesen, daneben
sind auch Motive älterer Bauten, vor allem von St. Remi benutzt. Durch die
sorgfältige Abwägung der Verhältnisse im Inneren, vor allem des Ausgleichs
zwischen den Arkaden und dem Obergaden, steht der Bau neben den Domen
zu Amiens und Köln, denen er an Großartigkeit der Raumwirkung nichts nach-
gibt1. Der Kern der bis zum Jahre 1917 erhaltenen Anlage stammte aus der
ersten Hälfte des XIII. Jahrh. Der ältere Bau von 1113 ist nicht weit über die
Fundamentierung hinausgekommen. In einzelnen Abschnitten wurde die Ostpartie
vollendet, am 2. September 1257 ward in Gegenwart König Ludwig IX., des
Heiligen, der Chor eingeweiht. Erst 1339 wurde der Nordarm, 1400 der Südarm
vollendet. Während des ganzen XV. Jahrh. war dann an dem Langhaus weiter-
gebaut worden. So stellt der Bau ein Paradigma zu der Entwicklung der nord-
französischen Gotik bis zu den reichsten Formen des üppigen und eigenwilligen
style flamboyant dar, der vor allem in dem östlichen der beiden Querschiffe zur
Geltung kommt. Schon vor dem Kriege standen wir erschrocken vor der Ver-
nachlässigung des reichen Außenbaus, der wie eine Illustration zu der Anklage-
schrift des Maurice Barres, „La grande pitie des eghses de France" erschien.
Seit St. Quentin *von den Deutschen besetzt war, stand die Kirche unter dem
besonderen Schutz der deutschen Verwaltung und war eines ihrer Sorgenkinder.
1 Über die kunstgeschichtliche Stellung vgl. v. B e z o 1 d , „Entstehung und Ausbildung
der gotischen Baukunst in Frankreich" (Sonderabdruck aus der Ztschr. f. Bauwesen 1891),
Berlin 1891, S. 15.