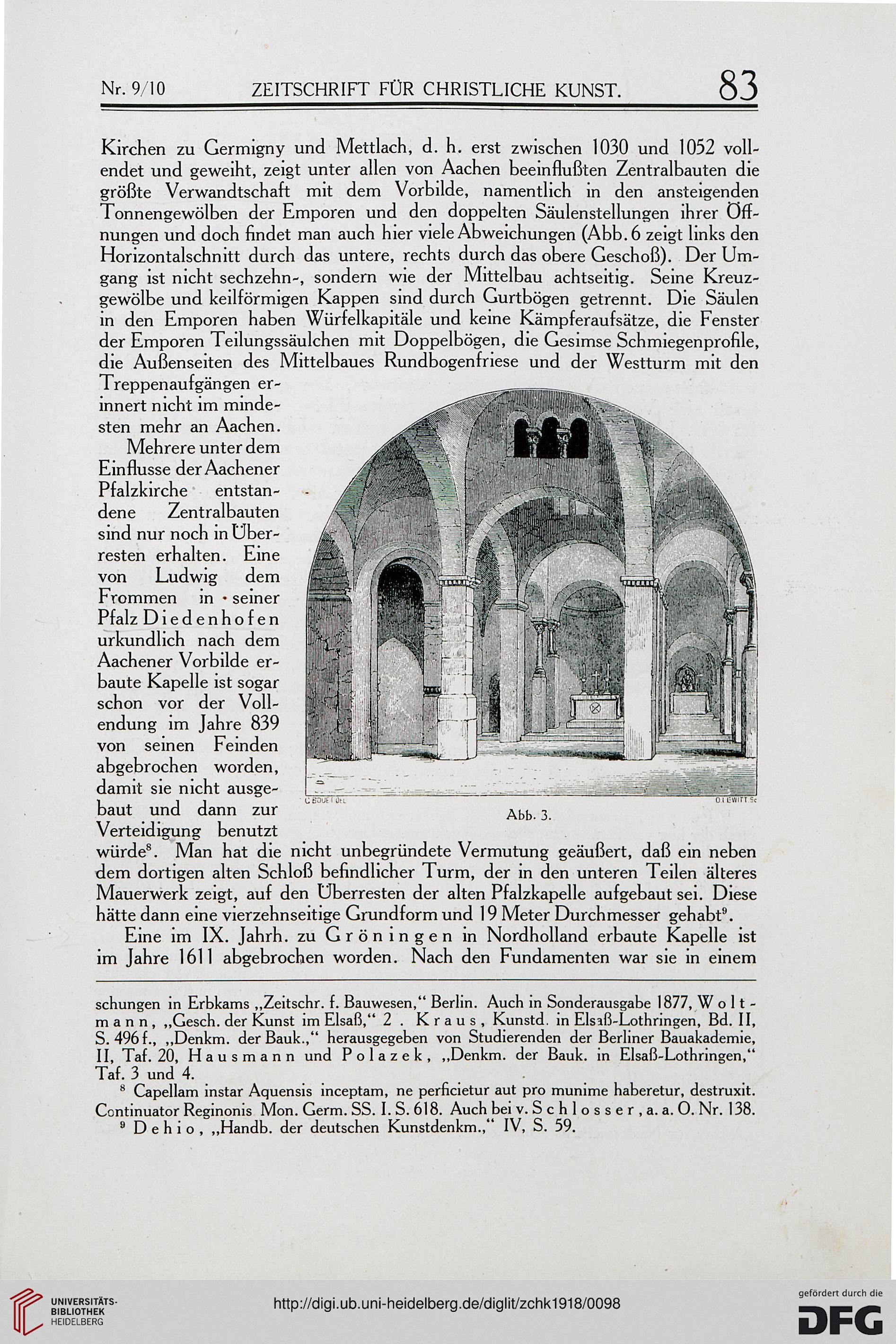Nr. 9/10
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
83
Kirchen zu Germigny und Mettlach, d. h. erst zwischen 1030 und 1052 voll-
endet und geweiht, zeigt unter allen von Aachen beeinflußten Zentralbauten die
größte Verwandtschaft mit dem Vorbilde, namentlich in den ansteigenden
Tonnengewölben der Emporen und den doppelten Säulenstellungen ihrer Öff-
nungen und doch findet man auch hier viele Abweichungen (Abb. 6 zeigt links den
Horizontalschnitt durch das untere, rechts durch das obere Geschoß). Der Um-
gang ist nicht sechzehn-, sondern wie der Mittelbau achtseitig. Seine Kreuz-
gewölbe und keilförmigen Kappen sind durch Gurtbögen getrennt. Die Säulen
in den Emporen haben Würfelkapitäle und keine Kämpferaufsätze, die Fenster
der Emporen Teilungssäulchen mit Doppelbögen, die Gesimse Schmiegenprofile,
die Außenseiten des Mittelbaues Rundbogenfriese und der Westturm mit den
Treppenaufgängen er-
innert nicht im minde-
sten mehr an Aachen.
Mehrere unter dem
Einflüsse der Aachener
Pfalzkirche entstan-
dene Zentralbauten
sind nur noch in Über-
resten erhalten. Eine
von Ludwig dem
Frommen in • seiner
Pfalz Diedenhofen
urkundlich nach dem
Aachener Vorbilde er-
baute Kapelle ist sogar
schon vor der Voll-
endung im Jahre 839
von seinen Feinden
abgebrochen worden,
damit sie nicht ausge-
baut und dann zur
Verteidigung benutzt
würde8. Man hat die nicht unbegründete Vermutung geäußert, daß ein neben
dem dortigen alten Schloß befindlicher Turm, der in den unteren Teilen älteres
Mauerwerk zeigt, auf den Überresten der alten Pfalzkapelle aufgebaut sei. Diese
hätte dann eine vierzehnseitige Grundform und 19 Meter Durchmesser gehabt9.
Eine im IX. Jahrh. zu Groningen in Nordholland erbaute Kapelle ist
im Jahre 1611 abgebrochen worden. Nach den Fundamenten war sie in einem
Abb. 3.
schungen in Erbkams „Zeitschr. f. Bauwesen," Berlin. Auch in Sonderausgabe 1877, W o 1 t -
mann, „Gesch. der Kunst im Elsaß," 2 . Kraus, Kunstd. in Elsiß-Lothringen, Bd. II,
S. 496 f., „Denkm. der Bauk.," herausgegeben von Studierenden der Berliner Bauakademie,
II, Taf. 20, Hausmann und Polazek, „Denkm. der Bauk. in Elsaß-Lothringen,"
Taf. 3 und 4.
8 Capellam instar Aquensis inceptam, ne perficietur aut pro mumme haberetur, destruxit.
Continuator Reginonis Mon. Germ. SS. I. S. 618. Auch bei v. S c h 1 o s s e r , a. a. O. Nr. 138.
a D e h i o , „Handb. der deutschen Kunstdenkm.," IV, S. 59.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
83
Kirchen zu Germigny und Mettlach, d. h. erst zwischen 1030 und 1052 voll-
endet und geweiht, zeigt unter allen von Aachen beeinflußten Zentralbauten die
größte Verwandtschaft mit dem Vorbilde, namentlich in den ansteigenden
Tonnengewölben der Emporen und den doppelten Säulenstellungen ihrer Öff-
nungen und doch findet man auch hier viele Abweichungen (Abb. 6 zeigt links den
Horizontalschnitt durch das untere, rechts durch das obere Geschoß). Der Um-
gang ist nicht sechzehn-, sondern wie der Mittelbau achtseitig. Seine Kreuz-
gewölbe und keilförmigen Kappen sind durch Gurtbögen getrennt. Die Säulen
in den Emporen haben Würfelkapitäle und keine Kämpferaufsätze, die Fenster
der Emporen Teilungssäulchen mit Doppelbögen, die Gesimse Schmiegenprofile,
die Außenseiten des Mittelbaues Rundbogenfriese und der Westturm mit den
Treppenaufgängen er-
innert nicht im minde-
sten mehr an Aachen.
Mehrere unter dem
Einflüsse der Aachener
Pfalzkirche entstan-
dene Zentralbauten
sind nur noch in Über-
resten erhalten. Eine
von Ludwig dem
Frommen in • seiner
Pfalz Diedenhofen
urkundlich nach dem
Aachener Vorbilde er-
baute Kapelle ist sogar
schon vor der Voll-
endung im Jahre 839
von seinen Feinden
abgebrochen worden,
damit sie nicht ausge-
baut und dann zur
Verteidigung benutzt
würde8. Man hat die nicht unbegründete Vermutung geäußert, daß ein neben
dem dortigen alten Schloß befindlicher Turm, der in den unteren Teilen älteres
Mauerwerk zeigt, auf den Überresten der alten Pfalzkapelle aufgebaut sei. Diese
hätte dann eine vierzehnseitige Grundform und 19 Meter Durchmesser gehabt9.
Eine im IX. Jahrh. zu Groningen in Nordholland erbaute Kapelle ist
im Jahre 1611 abgebrochen worden. Nach den Fundamenten war sie in einem
Abb. 3.
schungen in Erbkams „Zeitschr. f. Bauwesen," Berlin. Auch in Sonderausgabe 1877, W o 1 t -
mann, „Gesch. der Kunst im Elsaß," 2 . Kraus, Kunstd. in Elsiß-Lothringen, Bd. II,
S. 496 f., „Denkm. der Bauk.," herausgegeben von Studierenden der Berliner Bauakademie,
II, Taf. 20, Hausmann und Polazek, „Denkm. der Bauk. in Elsaß-Lothringen,"
Taf. 3 und 4.
8 Capellam instar Aquensis inceptam, ne perficietur aut pro mumme haberetur, destruxit.
Continuator Reginonis Mon. Germ. SS. I. S. 618. Auch bei v. S c h 1 o s s e r , a. a. O. Nr. 138.
a D e h i o , „Handb. der deutschen Kunstdenkm.," IV, S. 59.