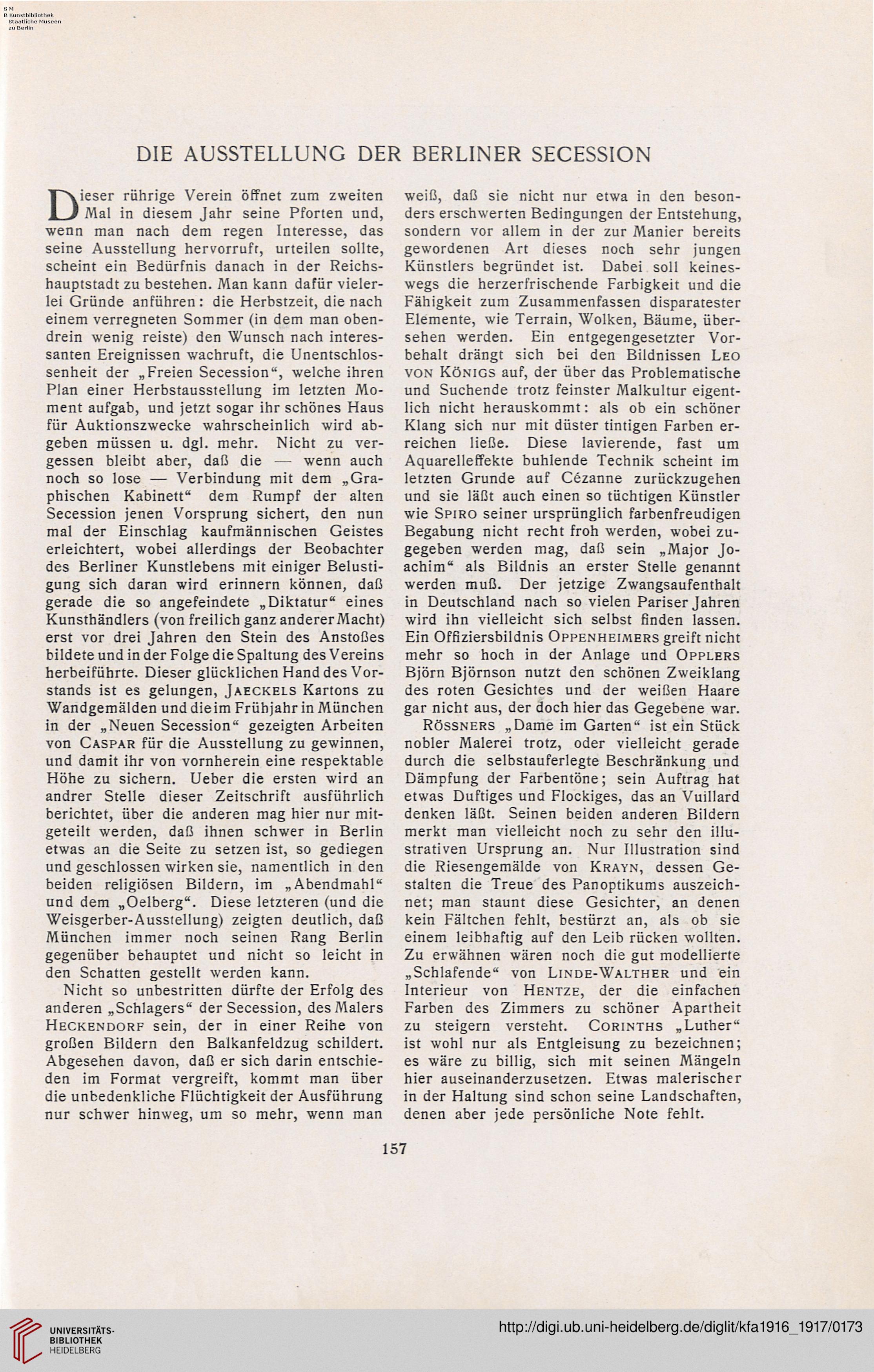DIE AUSSTELLUNG DER BERLINER SECESSION
Dieser rührige Verein öffnet zum zweiten
Mal in diesem Jahr seine Pforten und,
wenn man nach dem regen Interesse, das
seine Ausstellung hervorruft, urteilen sollte,
scheint ein Bedürfnis danach in der Reichs-
hauptstadt zu bestehen. Man kann dafür vieler-
lei Gründe anführen: die Herbstzeit, die nach
einem verregneten Sommer (in dem man oben-
drein wenig reiste) den Wunsch nach interes-
santen Ereignissen wachruft, die Unentschlos-
senheit der „Freien Secession", welche ihren
Plan einer Herbstausstellung im letzten Mo-
ment aufgab, und jetzt sogar ihr schönes Haus
für Auktionszwecke wahrscheinlich wird ab-
geben müssen u. dgl. mehr. Nicht zu ver-
gessen bleibt aber, daß die — wenn auch
noch so lose — Verbindung mit dem „Gra-
phischen Kabinett" dem Rumpf der alten
Secession jenen Vorsprung sichert, den nun
mal der Einschlag kaufmännischen Geistes
erleichtert, wobei allerdings der Beobachter
des Berliner Kunstlebens mit einiger Belusti-
gung sich daran wird erinnern können, daß
gerade die so angefeindete „Diktatur" eines
Kunsthändlers (von freilich ganz andererMacht)
erst vor drei Jahren den Stein des Anstoßes
bildete und in der Folge die Spaltung des Vereins
herbeiführte. Dieser glücklichen Hand des Vor-
stands ist es gelungen, Jaeckels Kartons zu
Wandgemälden und die im Frühjahr in München
in der „Neuen Secession" gezeigten Arbeiten
von Caspar für die Ausstellung zu gewinnen,
und damit ihr von vornherein eine respektable
Höhe zu sichern. Ueber die ersten wird an
andrer Stelle dieser Zeitschrift ausführlich
berichtet, über die anderen mag hier nur mit-
geteilt werden, daß ihnen schwer in Berlin
etwas an die Seite zu setzen ist, so gediegen
und geschlossen wirken sie, namentlich in den
beiden religiösen Bildern, im „Abendmahl"
und dem „Oelberg". Diese letzteren (und die
Weisgerber-Ausstellung) zeigten deutlich, daß
München immer noch seinen Rang Berlin
gegenüber behauptet und nicht so leicht in
den Schatten gestellt werden kann.
Nicht so unbestritten dürfte der Erfolg des
anderen „Schlagers" der Secession, des Malers
Heckendorf sein, der in einer Reihe von
großen Bildern den Balkanfeldzug schildert.
Abgesehen davon, daß er sich darin entschie-
den im Format vergreift, kommt man über
die unbedenkliche Flüchtigkeit der Ausführung
nur schwer hinweg, um so mehr, wenn man
weiß, daß sie nicht nur etwa in den beson-
ders erschwerten Bedingungen der Entstehung,
sondern vor allem in der zur Manier bereits
gewordenen Art dieses noch sehr jungen
Künstlers begründet ist. Dabei soll keines-
wegs die herzerfrischende Farbigkeit und die
Fähigkeit zum Zusammenfassen disparatester
Elemente, wie Terrain, Wolken, Bäume, über-
sehen werden. Ein entgegengesetzter Vor-
behalt drängt sich bei den Bildnissen Leo
von Königs auf, der über das Problematische
und Suchende trotz feinster Malkultur eigent-
lich nicht herauskommt: als ob ein schöner
Klang sich nur mit düster tintigen Farben er-
reichen ließe. Diese lavierende, fast um
Aquarelleffekte buhlende Technik scheint im
letzten Grunde auf Cezanne zurückzugehen
und sie läßt auch einen so tüchtigen Künstler
wie Spiro seiner ursprünglich farbenfreudigen
Begabung nicht recht froh werden, wobei zu-
gegeben werden mag, daß sein „Major Jo-
achim" als Bildnis an erster Stelle genannt
werden muß. Der jetzige Zwangsaufenthalt
in Deutschland nach so vielen Pariser Jahren
wird ihn vielleicht sich selbst finden lassen.
Ein Offiziersbildnis Oppenheimers greift nicht
mehr so hoch in der Anlage und Opplers
Björn Björnson nutzt den schönen Zweiklang
des roten Gesichtes und der weißen Haare
gar nicht aus, der doch hier das Gegebene war.
Rössners „Dame im Garten" ist ein Stück
nobler Malerei trotz, oder vielleicht gerade
durch die selbstauferlegte Beschränkung und
Dämpfung der Farbentöne; sein Auftrag hat
etwas Duftiges und Flockiges, das an Vuillard
denken läßt. Seinen beiden anderen Bildern
merkt man vielleicht noch zu sehr den illu-
strativen Ursprung an. Nur Illustration sind
die Riesengemälde von Krayn, dessen Ge-
stalten die Treue des Panoptikums auszeich-
net; man staunt diese Gesichter, an denen
kein Fältchen fehlt, bestürzt an, als ob sie
einem leibhaftig auf den Leib rücken wollten.
Zu erwähnen wären noch die gut modellierte
„Schlafende" von Linde-Walther und ein
Interieur von Hentze, der die einfachen
Farben des Zimmers zu schöner Apartheit
zu steigern versteht. Corinths „Luther"
ist wohl nur als Entgleisung zu bezeichnen;
es wäre zu billig, sich mit seinen Mängeln
hier auseinanderzusetzen. Etwas malerischer
in der Haltung sind schon seine Landschaften,
denen aber jede persönliche Note fehlt.
157
Dieser rührige Verein öffnet zum zweiten
Mal in diesem Jahr seine Pforten und,
wenn man nach dem regen Interesse, das
seine Ausstellung hervorruft, urteilen sollte,
scheint ein Bedürfnis danach in der Reichs-
hauptstadt zu bestehen. Man kann dafür vieler-
lei Gründe anführen: die Herbstzeit, die nach
einem verregneten Sommer (in dem man oben-
drein wenig reiste) den Wunsch nach interes-
santen Ereignissen wachruft, die Unentschlos-
senheit der „Freien Secession", welche ihren
Plan einer Herbstausstellung im letzten Mo-
ment aufgab, und jetzt sogar ihr schönes Haus
für Auktionszwecke wahrscheinlich wird ab-
geben müssen u. dgl. mehr. Nicht zu ver-
gessen bleibt aber, daß die — wenn auch
noch so lose — Verbindung mit dem „Gra-
phischen Kabinett" dem Rumpf der alten
Secession jenen Vorsprung sichert, den nun
mal der Einschlag kaufmännischen Geistes
erleichtert, wobei allerdings der Beobachter
des Berliner Kunstlebens mit einiger Belusti-
gung sich daran wird erinnern können, daß
gerade die so angefeindete „Diktatur" eines
Kunsthändlers (von freilich ganz andererMacht)
erst vor drei Jahren den Stein des Anstoßes
bildete und in der Folge die Spaltung des Vereins
herbeiführte. Dieser glücklichen Hand des Vor-
stands ist es gelungen, Jaeckels Kartons zu
Wandgemälden und die im Frühjahr in München
in der „Neuen Secession" gezeigten Arbeiten
von Caspar für die Ausstellung zu gewinnen,
und damit ihr von vornherein eine respektable
Höhe zu sichern. Ueber die ersten wird an
andrer Stelle dieser Zeitschrift ausführlich
berichtet, über die anderen mag hier nur mit-
geteilt werden, daß ihnen schwer in Berlin
etwas an die Seite zu setzen ist, so gediegen
und geschlossen wirken sie, namentlich in den
beiden religiösen Bildern, im „Abendmahl"
und dem „Oelberg". Diese letzteren (und die
Weisgerber-Ausstellung) zeigten deutlich, daß
München immer noch seinen Rang Berlin
gegenüber behauptet und nicht so leicht in
den Schatten gestellt werden kann.
Nicht so unbestritten dürfte der Erfolg des
anderen „Schlagers" der Secession, des Malers
Heckendorf sein, der in einer Reihe von
großen Bildern den Balkanfeldzug schildert.
Abgesehen davon, daß er sich darin entschie-
den im Format vergreift, kommt man über
die unbedenkliche Flüchtigkeit der Ausführung
nur schwer hinweg, um so mehr, wenn man
weiß, daß sie nicht nur etwa in den beson-
ders erschwerten Bedingungen der Entstehung,
sondern vor allem in der zur Manier bereits
gewordenen Art dieses noch sehr jungen
Künstlers begründet ist. Dabei soll keines-
wegs die herzerfrischende Farbigkeit und die
Fähigkeit zum Zusammenfassen disparatester
Elemente, wie Terrain, Wolken, Bäume, über-
sehen werden. Ein entgegengesetzter Vor-
behalt drängt sich bei den Bildnissen Leo
von Königs auf, der über das Problematische
und Suchende trotz feinster Malkultur eigent-
lich nicht herauskommt: als ob ein schöner
Klang sich nur mit düster tintigen Farben er-
reichen ließe. Diese lavierende, fast um
Aquarelleffekte buhlende Technik scheint im
letzten Grunde auf Cezanne zurückzugehen
und sie läßt auch einen so tüchtigen Künstler
wie Spiro seiner ursprünglich farbenfreudigen
Begabung nicht recht froh werden, wobei zu-
gegeben werden mag, daß sein „Major Jo-
achim" als Bildnis an erster Stelle genannt
werden muß. Der jetzige Zwangsaufenthalt
in Deutschland nach so vielen Pariser Jahren
wird ihn vielleicht sich selbst finden lassen.
Ein Offiziersbildnis Oppenheimers greift nicht
mehr so hoch in der Anlage und Opplers
Björn Björnson nutzt den schönen Zweiklang
des roten Gesichtes und der weißen Haare
gar nicht aus, der doch hier das Gegebene war.
Rössners „Dame im Garten" ist ein Stück
nobler Malerei trotz, oder vielleicht gerade
durch die selbstauferlegte Beschränkung und
Dämpfung der Farbentöne; sein Auftrag hat
etwas Duftiges und Flockiges, das an Vuillard
denken läßt. Seinen beiden anderen Bildern
merkt man vielleicht noch zu sehr den illu-
strativen Ursprung an. Nur Illustration sind
die Riesengemälde von Krayn, dessen Ge-
stalten die Treue des Panoptikums auszeich-
net; man staunt diese Gesichter, an denen
kein Fältchen fehlt, bestürzt an, als ob sie
einem leibhaftig auf den Leib rücken wollten.
Zu erwähnen wären noch die gut modellierte
„Schlafende" von Linde-Walther und ein
Interieur von Hentze, der die einfachen
Farben des Zimmers zu schöner Apartheit
zu steigern versteht. Corinths „Luther"
ist wohl nur als Entgleisung zu bezeichnen;
es wäre zu billig, sich mit seinen Mängeln
hier auseinanderzusetzen. Etwas malerischer
in der Haltung sind schon seine Landschaften,
denen aber jede persönliche Note fehlt.
157