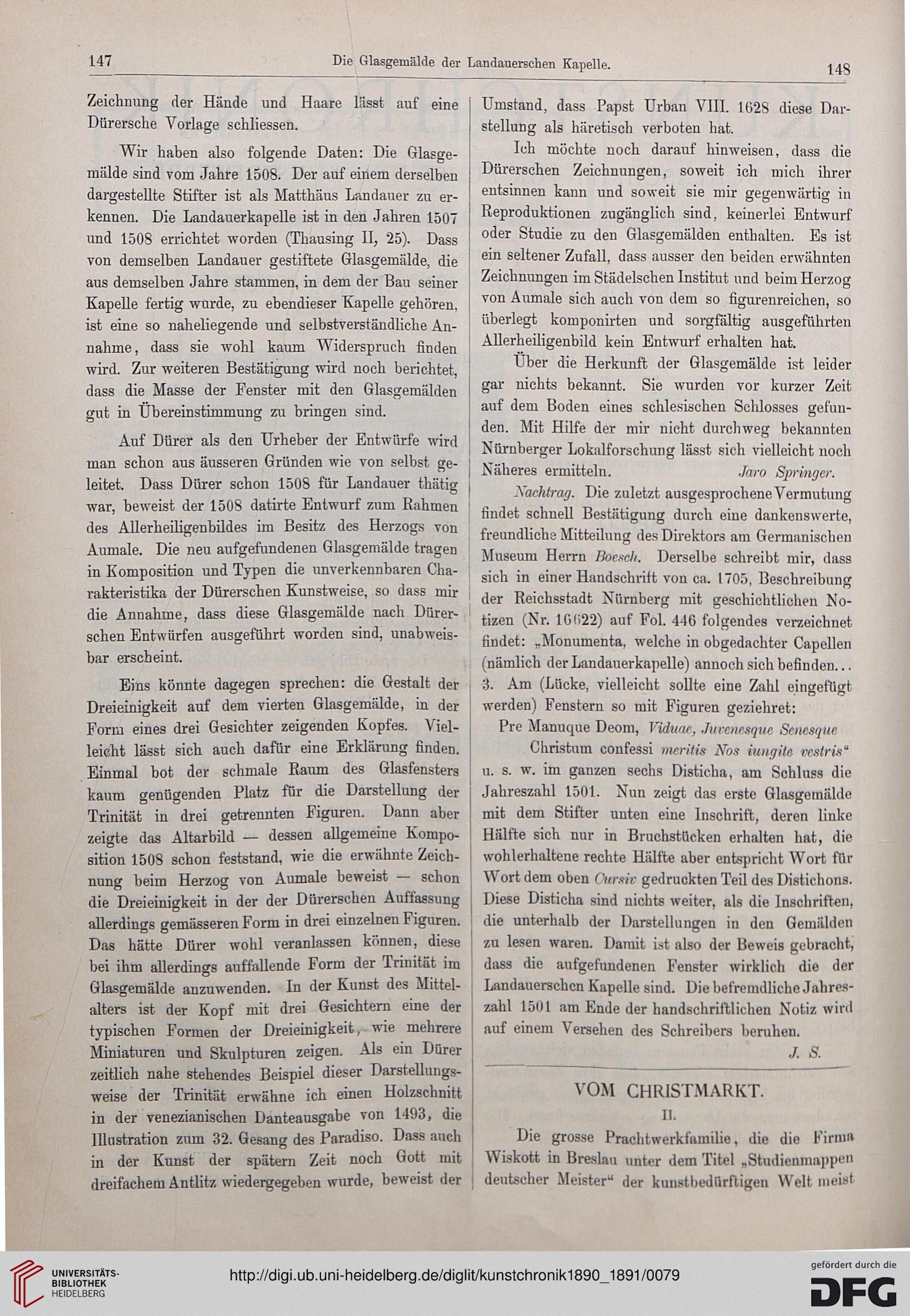147
Die Glasgemälde der Landauerschen Kapelle.
148
Zeichnung der Hände und Haare lässt auf eine
Dürersche Vorlage schliessen.
Wir haben also folgende Daten: Die Glasge-
mälde sind vom Jahre 1508. Der auf einem derselben
dargestellte Stifter ist als Matthäus Landauer zu er-
kennen. Die Landauerkapelle ist in den Jahren 1507
und 1508 errichtet worden (Thausing II, 25). Dass
von demselben Landauer gestiftete Glasgemälde, die
aus demselben Jahre stammen, in dem der Bau seiner
Kapelle fertig wurde, zu ebendieser Kapelle gehören,
ist eine so naheliegende und selbstverständliche An-
nahme, dass sie wohl kaum Widerspruch finden
wird. Zur weiteren Bestätigung wird noch berichtet,
dass die Masse der Fenster mit den Glasgemälden
gut in Übereinstimmung zu bringen sind.
Auf Dürer als den Urheber der Entwürfe wird
man schon aus äusseren Gründen wie von selbst ge-
leitet. Dass Dürer schon 1508 für Landauer thätig
war, beweist der 1508 datirte Entwurf zum Rahmen
des Allerheiligenbildes im Besitz des Herzogs von
Aumale. Die neu aufgefundenen Glasgemälde tragen
in Komposition und Typen die unverkennbaren Cha-
rakteristika der Dürerschen Kunstweise, so dass mir
die Annahme, dass diese Glasgemälde nach Dürer-
schen Entwürfen ausgeführt worden sind, unabweis-
bar erscheint.
Eins könnte dagegen sprechen: die Gestalt der
Dreieinigkeit auf dem vierten Glasgemälde, in der
Form eines drei Gesichter zeigenden Kopfes. Viel-
leicht lässt sich auch dafür eine Erklärung finden.
Einmal bot der schmale Raum des Glasfensters
kaum genügenden Platz für die Darstellung der
Trinität in drei getrennten Figuren. Dann aber
zeigte das Altarbild — dessen allgemeine Kompo-
sition 1508 schon feststand, wie die erwähnte Zeich-
nung beim Herzog von Aumale beweist — schon
die Dreieinigkeit in der der Dürerschen Auffassung
allerdings gemässeren Form in drei einzelnen Figuren.
Das hätte Dürer wohl veranlassen können, diese
bei ihm allerdings auffallende Form der Trinität im
Glasgemälde anzuwenden. In der Kunst des Mittel-
alters ist der Kopf mit drei Gesichtern eine der
typischen Formen der Dreieinigkeit, wie mehrere
Miniaturen und Skulpturen zeigen. Als ein Dürer
zeitlich nahe stehendes Beispiel dieser Darstellungs-
weise der Trinität erwähne ich einen Holzschnitt
in der venezianischen Danteausgabe von 1493, die
Illustration zum 32. Gesang des Paradiso. Dass auch
in der Kunst der spätem Zeit noch Gott mit
dreifachem Antlitz wiedergegeben wurde, beweist der
Umstand, dass Papst Urban VIII. 1628 diese Dar-
stellung als häretisch verboten hat.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass die
Dürerschen Zeichnungen, soweit ich mich ihrer
entsinnen kann und soweit sie mir gegenwärtig in
Reproduktionen zugänglich sind, keinerlei Entwurf
oder Studie zu den Glasgemälden enthalten. Es ist
ein seltener Zufall, dass ausser den beiden erwähnten
Zeichnungen im Städelschen Institut und beim Herzog
von Aumale sich auch von dem so figurenreichen, so
überlegt komponirten und sorgfältig ausgeführten
Allerheiligenbild kein Entwurf erhalten hat.
Über die Herkunft der Glasgemälde ist leider
gar nichts bekannt. Sie wurden vor kurzer Zeit
auf dem Boden eines schlesischen Schlosses gefun-
den. Mit Hilfe der mir nicht durchweg bekannten
Nürnberger Lokalforschung lasst sich vielleicht noch
j Näheres ermitteln. Jaro Springer.
Nachtrag. Die zuletzt ausgesprochene Vermutung
findet schnell Bestätigung durch eine dankenswerte,
freundliche Mitteilung des Direktors am Germanischen
Museum Herrn Boeseh. Derselbe schreibt mir, dass
1 sich in einer Handschrift von ca. 1705, Beschreibung
1 der Reichsstadt Nürnberg mit geschichtlichen No-
tizen (Nr. 1GB22) auf Fol. 446 folgendes verzeichnet
findet: „Monumenta, welche in obgedachter Capellen
(nämlich der Landauerkapelle) annoch sich befinden...
; 3. Am (Lücke, vielleicht sollte eine Zahl eingefügt
| werden) Fenstern so mit Figuren geziehret:
Pre Manuque Deom, Viduae, Juvcnesque Sencsqur
Christum confessi mcrilis Nos iungitß vcstris"
u. s. w. im ganzen sechs Disticha, am Schluss die
Jahreszahl 1501. Nun zeigt das erste Glasgemälde
mit dem Stifter unten eine Inschrift, deren linke
Hälfte sich nur in Bruchstücken erhalten hat, die
wohlerhaltene rechte Hälfte aber entspricht Wort für
Wort dem oben (torsiv gedruckten Teil des Distichons.
Diese Disticha sind nichts weiter, als die Inschriften,
die unterhalb der Darstellungen in den Gemälden
zu lesen waren. Damit ist also der Beweis gebracht,
dass die aufgefundenen Fenster wirklich die der
Landauerschen Kapelle sind. Die befremdliche Jahres-
zahl 1501 am Ende der handschriftlichen Notiz wird
auf einem Versehen des Schreibers beruhen.
J. S.
VOM CHRISTMARKT.
II.
Die grosse Prachtwerkfamilie, die die Kiriuu
Wiskott in Breslau unter dem Titel „Studienmappeii
deutscher Meister" der kunstbedürftigen Well meid
Die Glasgemälde der Landauerschen Kapelle.
148
Zeichnung der Hände und Haare lässt auf eine
Dürersche Vorlage schliessen.
Wir haben also folgende Daten: Die Glasge-
mälde sind vom Jahre 1508. Der auf einem derselben
dargestellte Stifter ist als Matthäus Landauer zu er-
kennen. Die Landauerkapelle ist in den Jahren 1507
und 1508 errichtet worden (Thausing II, 25). Dass
von demselben Landauer gestiftete Glasgemälde, die
aus demselben Jahre stammen, in dem der Bau seiner
Kapelle fertig wurde, zu ebendieser Kapelle gehören,
ist eine so naheliegende und selbstverständliche An-
nahme, dass sie wohl kaum Widerspruch finden
wird. Zur weiteren Bestätigung wird noch berichtet,
dass die Masse der Fenster mit den Glasgemälden
gut in Übereinstimmung zu bringen sind.
Auf Dürer als den Urheber der Entwürfe wird
man schon aus äusseren Gründen wie von selbst ge-
leitet. Dass Dürer schon 1508 für Landauer thätig
war, beweist der 1508 datirte Entwurf zum Rahmen
des Allerheiligenbildes im Besitz des Herzogs von
Aumale. Die neu aufgefundenen Glasgemälde tragen
in Komposition und Typen die unverkennbaren Cha-
rakteristika der Dürerschen Kunstweise, so dass mir
die Annahme, dass diese Glasgemälde nach Dürer-
schen Entwürfen ausgeführt worden sind, unabweis-
bar erscheint.
Eins könnte dagegen sprechen: die Gestalt der
Dreieinigkeit auf dem vierten Glasgemälde, in der
Form eines drei Gesichter zeigenden Kopfes. Viel-
leicht lässt sich auch dafür eine Erklärung finden.
Einmal bot der schmale Raum des Glasfensters
kaum genügenden Platz für die Darstellung der
Trinität in drei getrennten Figuren. Dann aber
zeigte das Altarbild — dessen allgemeine Kompo-
sition 1508 schon feststand, wie die erwähnte Zeich-
nung beim Herzog von Aumale beweist — schon
die Dreieinigkeit in der der Dürerschen Auffassung
allerdings gemässeren Form in drei einzelnen Figuren.
Das hätte Dürer wohl veranlassen können, diese
bei ihm allerdings auffallende Form der Trinität im
Glasgemälde anzuwenden. In der Kunst des Mittel-
alters ist der Kopf mit drei Gesichtern eine der
typischen Formen der Dreieinigkeit, wie mehrere
Miniaturen und Skulpturen zeigen. Als ein Dürer
zeitlich nahe stehendes Beispiel dieser Darstellungs-
weise der Trinität erwähne ich einen Holzschnitt
in der venezianischen Danteausgabe von 1493, die
Illustration zum 32. Gesang des Paradiso. Dass auch
in der Kunst der spätem Zeit noch Gott mit
dreifachem Antlitz wiedergegeben wurde, beweist der
Umstand, dass Papst Urban VIII. 1628 diese Dar-
stellung als häretisch verboten hat.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass die
Dürerschen Zeichnungen, soweit ich mich ihrer
entsinnen kann und soweit sie mir gegenwärtig in
Reproduktionen zugänglich sind, keinerlei Entwurf
oder Studie zu den Glasgemälden enthalten. Es ist
ein seltener Zufall, dass ausser den beiden erwähnten
Zeichnungen im Städelschen Institut und beim Herzog
von Aumale sich auch von dem so figurenreichen, so
überlegt komponirten und sorgfältig ausgeführten
Allerheiligenbild kein Entwurf erhalten hat.
Über die Herkunft der Glasgemälde ist leider
gar nichts bekannt. Sie wurden vor kurzer Zeit
auf dem Boden eines schlesischen Schlosses gefun-
den. Mit Hilfe der mir nicht durchweg bekannten
Nürnberger Lokalforschung lasst sich vielleicht noch
j Näheres ermitteln. Jaro Springer.
Nachtrag. Die zuletzt ausgesprochene Vermutung
findet schnell Bestätigung durch eine dankenswerte,
freundliche Mitteilung des Direktors am Germanischen
Museum Herrn Boeseh. Derselbe schreibt mir, dass
1 sich in einer Handschrift von ca. 1705, Beschreibung
1 der Reichsstadt Nürnberg mit geschichtlichen No-
tizen (Nr. 1GB22) auf Fol. 446 folgendes verzeichnet
findet: „Monumenta, welche in obgedachter Capellen
(nämlich der Landauerkapelle) annoch sich befinden...
; 3. Am (Lücke, vielleicht sollte eine Zahl eingefügt
| werden) Fenstern so mit Figuren geziehret:
Pre Manuque Deom, Viduae, Juvcnesque Sencsqur
Christum confessi mcrilis Nos iungitß vcstris"
u. s. w. im ganzen sechs Disticha, am Schluss die
Jahreszahl 1501. Nun zeigt das erste Glasgemälde
mit dem Stifter unten eine Inschrift, deren linke
Hälfte sich nur in Bruchstücken erhalten hat, die
wohlerhaltene rechte Hälfte aber entspricht Wort für
Wort dem oben (torsiv gedruckten Teil des Distichons.
Diese Disticha sind nichts weiter, als die Inschriften,
die unterhalb der Darstellungen in den Gemälden
zu lesen waren. Damit ist also der Beweis gebracht,
dass die aufgefundenen Fenster wirklich die der
Landauerschen Kapelle sind. Die befremdliche Jahres-
zahl 1501 am Ende der handschriftlichen Notiz wird
auf einem Versehen des Schreibers beruhen.
J. S.
VOM CHRISTMARKT.
II.
Die grosse Prachtwerkfamilie, die die Kiriuu
Wiskott in Breslau unter dem Titel „Studienmappeii
deutscher Meister" der kunstbedürftigen Well meid