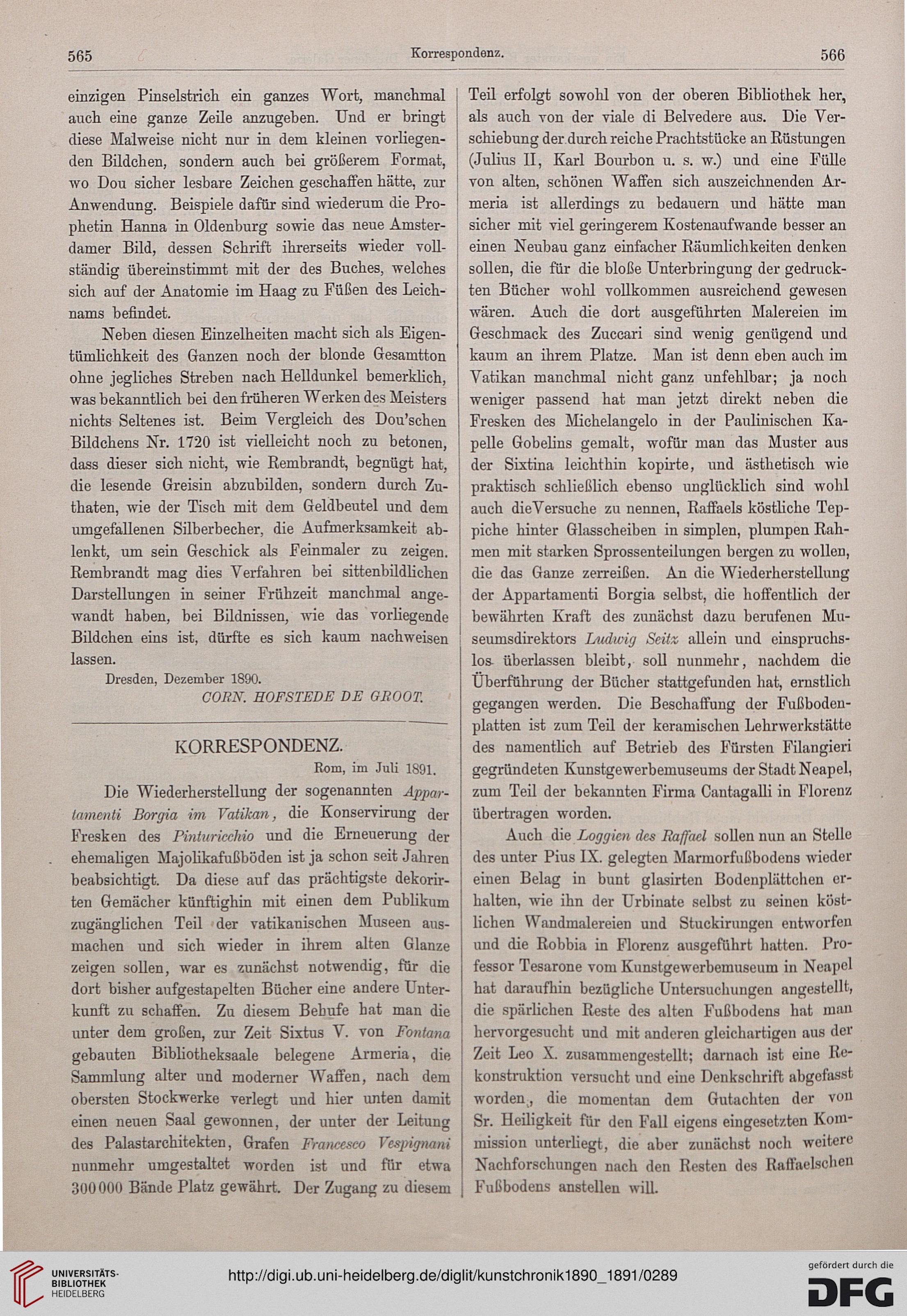565
Korrespondenz.
566
einzigen Pinselstrich ein ganzes Wort, manchmal
auch eine ganze Zeile anzugeben. Und er bringt
diese Mälweise nicht nur in dem kleinen vorliegen-
den Bildchen, sondern auch bei größerem Format,
wo Dou sicher lesbare Zeichen geschaffen hätte, zur
Anwendung. Beispiele dafür sind wiederum die Pro-
pbetin Hanna in Oldenburg sowie das neue Amster-
damer Bild, dessen Scbrift ihrerseits wieder voll-
ständig übereinstimmt mit der des Buches, welches
sich auf der Anatomie im Haag zu Füßen des Leich-
nams befindet.
Neben diesen Einzelheiten macht sich als Eigen-
tümlichkeit des Ganzen noch der blonde Gesamtton
ohne jegliches Streben nach Helldunkel bemerkhch,
was bekanntlich bei den früheren Werken des Meisters
nichts Seltenes ist. Beim Vergleich des Dou'schen
Bildchens Nr. 1720 ist vielleicht noch zu betonen,
dass dieser sich nicht, wie Rembrandt, begnügt hat,
die lesende Greisin abzubilden, sondern durch Zu-
thaten, wie der Tisch mit dem Geldbeutel und dem
umgefallenen Silberbecher, die Aufmerksamkeit ab-
lenkt, um sein Geschick als Feinmaler zu zeigen.
Rembrandt mag dies Verfahren bei sittenbildlichen
Darstellungen in seiner Frühzeit manchmal ange-
wandt haben, bei Bildnissen, wie das vorliegende
Bildchen eins ist, dürfte es sich kaum nachweisen
lassen.
Dresden, Dezember 1890.
CORN. HOFSTEDE DE OROOT.
KORRESPONDENZ.
Rom, im Juli 1891.
Die Wiederherstellung der sogenannten Appar-
tamenü Borgia im Vatikan, die Konservirung der
Fresken des Pinturicchio und die Erneuerung der
ehemaligen Majolikafußböden ist ja schon seit Jahren
beabsichtigt. Da diese auf das prächtigste dekorir-
ten Gemächer künftighin mit einen dem Publikum
zugänglichen Teil der vatikanischen Museen aus-
machen und sich wieder in ihrem alten Glänze
zeigen sollen, war es zunächst notwendig, für die
dort bisher aufgestapelten Bücher eine andere Unter-
kunft zu schaffen. Zu diesem Behufe hat man die
unter dem großen, zur Zeit Sixtus V. von Fontana
gebauten Bibliotheksaale belegene Armeria, die
Sammlung alter und moderner Waffen, nach dem
obersten Stockwerke verlegt und hier unten damit
einen neuen Saal gewonnen, der unter der Leitung
des Palastarchitekten, Grafen Francesco Vespignani
nunmehr umgestaltet worden ist und für etwa
300 000 Bände Platz gewährt. Der Zugang zu diesem
Teil erfolgt sowohl von der oberen Bibliothek her,
als auch von der viale di Belvedere aus. Die Ver-
schiebung der durch reiche Prachtstücke an Rüstungen
(Julius II, Karl Bourbon u. s. w.) und eine Fülle
von alten, schönen Waffen sich auszeichnenden Ar-
meria ist allerdings zu bedauern und hätte man
sicher mit viel geringerem Kostenaufwande besser an
einen Neubau ganz einfacher Räumlichkeiten denken
sollen, die für die bloße Unterbringung der gedruck-
ten Bücher wohl vollkommen ausreichend gewesen
wären. Auch die dort ausgeführten Malereien im
Geschmack des Zuccari sind wenig genügend und
kaum an ihrem Platze. Man ist denn eben auch im
Vatikan manchmal nicht ganz unfehlbar; ja noch
weniger passend hat man jetzt direkt neben die
Fresken des Michelangelo in der Paulinischen Ka-
pelle Gobelins gemalt, wofür man das Muster aus
der Sixtina leichthin kopirte, und ästhetisch wie
praktisch schließlich ebenso unglücklich sind wohl
auch die Versuche zu nennen, Raffaels köstliche Tep-
piche hinter Glasscheiben in simplen, plumpen Rah-
men mit starken Sprossenteilungen bergen zu wollen,
die das Ganze zerreißen. An die Wiederherstellung
der Appartamenti Borgia selbst, die hoffentlich der
bewährten Kraft des zunächst dazu berufenen Mu-
seumsdirektors Ludwig Seitz allein und einspruchs-
los- überlassen bleibt, soll nunmehr, nachdem die
Überführung der Bücher stattgefunden hat, ernstlich
gegangen werden. Die Beschaffung der Fußboden-
platten ist zum Teil der keramischen Lehrwerkstätte
des namentlich auf Betrieb des Fürsten Filangieri
gegründeten Kunstgewerbemuseums der Stadt Neapel,
zum Teil der bekannten Firma Cantagalli in Florenz
übertragen worden.
Auch die Loggien des Iiaffacl sollen nun an Stelle
des unter Pius IX. gelegten Marmorfußbodens wieder
einen Belag in bunt glasirten Bodenplättchen er-
halten, wie ihn der Urbinate selbst zu seinen köst-
lichen Wandmalereien und Stuckirungen entworfen
und die Robbia in Florenz ausgeführt hatten. Pro-
fessor Tesarone vom Kunstgewerbemuseum in Neapel
hat daraufhin bezügliche Untersuchungen angestellt,
die spärlichen Reste des alten Fußbodens hat man
hervorgesucht und mit anderen gleichartigen aus der
Zeit Leo X. zusammengestellt; darnach ist eine Re-
konstruktion versucht und eine Denkschrift abgefassl
worden, die momentan dem Gutachten der von
Sr. Heiligkeit für den Fall eigens eingesetzten Kom-
mission unterliegt, die aber zunächst noch weitere
Nachforschungen nach den Resten des Raffaelschen
Fußbodens anstellen will.
Korrespondenz.
566
einzigen Pinselstrich ein ganzes Wort, manchmal
auch eine ganze Zeile anzugeben. Und er bringt
diese Mälweise nicht nur in dem kleinen vorliegen-
den Bildchen, sondern auch bei größerem Format,
wo Dou sicher lesbare Zeichen geschaffen hätte, zur
Anwendung. Beispiele dafür sind wiederum die Pro-
pbetin Hanna in Oldenburg sowie das neue Amster-
damer Bild, dessen Scbrift ihrerseits wieder voll-
ständig übereinstimmt mit der des Buches, welches
sich auf der Anatomie im Haag zu Füßen des Leich-
nams befindet.
Neben diesen Einzelheiten macht sich als Eigen-
tümlichkeit des Ganzen noch der blonde Gesamtton
ohne jegliches Streben nach Helldunkel bemerkhch,
was bekanntlich bei den früheren Werken des Meisters
nichts Seltenes ist. Beim Vergleich des Dou'schen
Bildchens Nr. 1720 ist vielleicht noch zu betonen,
dass dieser sich nicht, wie Rembrandt, begnügt hat,
die lesende Greisin abzubilden, sondern durch Zu-
thaten, wie der Tisch mit dem Geldbeutel und dem
umgefallenen Silberbecher, die Aufmerksamkeit ab-
lenkt, um sein Geschick als Feinmaler zu zeigen.
Rembrandt mag dies Verfahren bei sittenbildlichen
Darstellungen in seiner Frühzeit manchmal ange-
wandt haben, bei Bildnissen, wie das vorliegende
Bildchen eins ist, dürfte es sich kaum nachweisen
lassen.
Dresden, Dezember 1890.
CORN. HOFSTEDE DE OROOT.
KORRESPONDENZ.
Rom, im Juli 1891.
Die Wiederherstellung der sogenannten Appar-
tamenü Borgia im Vatikan, die Konservirung der
Fresken des Pinturicchio und die Erneuerung der
ehemaligen Majolikafußböden ist ja schon seit Jahren
beabsichtigt. Da diese auf das prächtigste dekorir-
ten Gemächer künftighin mit einen dem Publikum
zugänglichen Teil der vatikanischen Museen aus-
machen und sich wieder in ihrem alten Glänze
zeigen sollen, war es zunächst notwendig, für die
dort bisher aufgestapelten Bücher eine andere Unter-
kunft zu schaffen. Zu diesem Behufe hat man die
unter dem großen, zur Zeit Sixtus V. von Fontana
gebauten Bibliotheksaale belegene Armeria, die
Sammlung alter und moderner Waffen, nach dem
obersten Stockwerke verlegt und hier unten damit
einen neuen Saal gewonnen, der unter der Leitung
des Palastarchitekten, Grafen Francesco Vespignani
nunmehr umgestaltet worden ist und für etwa
300 000 Bände Platz gewährt. Der Zugang zu diesem
Teil erfolgt sowohl von der oberen Bibliothek her,
als auch von der viale di Belvedere aus. Die Ver-
schiebung der durch reiche Prachtstücke an Rüstungen
(Julius II, Karl Bourbon u. s. w.) und eine Fülle
von alten, schönen Waffen sich auszeichnenden Ar-
meria ist allerdings zu bedauern und hätte man
sicher mit viel geringerem Kostenaufwande besser an
einen Neubau ganz einfacher Räumlichkeiten denken
sollen, die für die bloße Unterbringung der gedruck-
ten Bücher wohl vollkommen ausreichend gewesen
wären. Auch die dort ausgeführten Malereien im
Geschmack des Zuccari sind wenig genügend und
kaum an ihrem Platze. Man ist denn eben auch im
Vatikan manchmal nicht ganz unfehlbar; ja noch
weniger passend hat man jetzt direkt neben die
Fresken des Michelangelo in der Paulinischen Ka-
pelle Gobelins gemalt, wofür man das Muster aus
der Sixtina leichthin kopirte, und ästhetisch wie
praktisch schließlich ebenso unglücklich sind wohl
auch die Versuche zu nennen, Raffaels köstliche Tep-
piche hinter Glasscheiben in simplen, plumpen Rah-
men mit starken Sprossenteilungen bergen zu wollen,
die das Ganze zerreißen. An die Wiederherstellung
der Appartamenti Borgia selbst, die hoffentlich der
bewährten Kraft des zunächst dazu berufenen Mu-
seumsdirektors Ludwig Seitz allein und einspruchs-
los- überlassen bleibt, soll nunmehr, nachdem die
Überführung der Bücher stattgefunden hat, ernstlich
gegangen werden. Die Beschaffung der Fußboden-
platten ist zum Teil der keramischen Lehrwerkstätte
des namentlich auf Betrieb des Fürsten Filangieri
gegründeten Kunstgewerbemuseums der Stadt Neapel,
zum Teil der bekannten Firma Cantagalli in Florenz
übertragen worden.
Auch die Loggien des Iiaffacl sollen nun an Stelle
des unter Pius IX. gelegten Marmorfußbodens wieder
einen Belag in bunt glasirten Bodenplättchen er-
halten, wie ihn der Urbinate selbst zu seinen köst-
lichen Wandmalereien und Stuckirungen entworfen
und die Robbia in Florenz ausgeführt hatten. Pro-
fessor Tesarone vom Kunstgewerbemuseum in Neapel
hat daraufhin bezügliche Untersuchungen angestellt,
die spärlichen Reste des alten Fußbodens hat man
hervorgesucht und mit anderen gleichartigen aus der
Zeit Leo X. zusammengestellt; darnach ist eine Re-
konstruktion versucht und eine Denkschrift abgefassl
worden, die momentan dem Gutachten der von
Sr. Heiligkeit für den Fall eigens eingesetzten Kom-
mission unterliegt, die aber zunächst noch weitere
Nachforschungen nach den Resten des Raffaelschen
Fußbodens anstellen will.