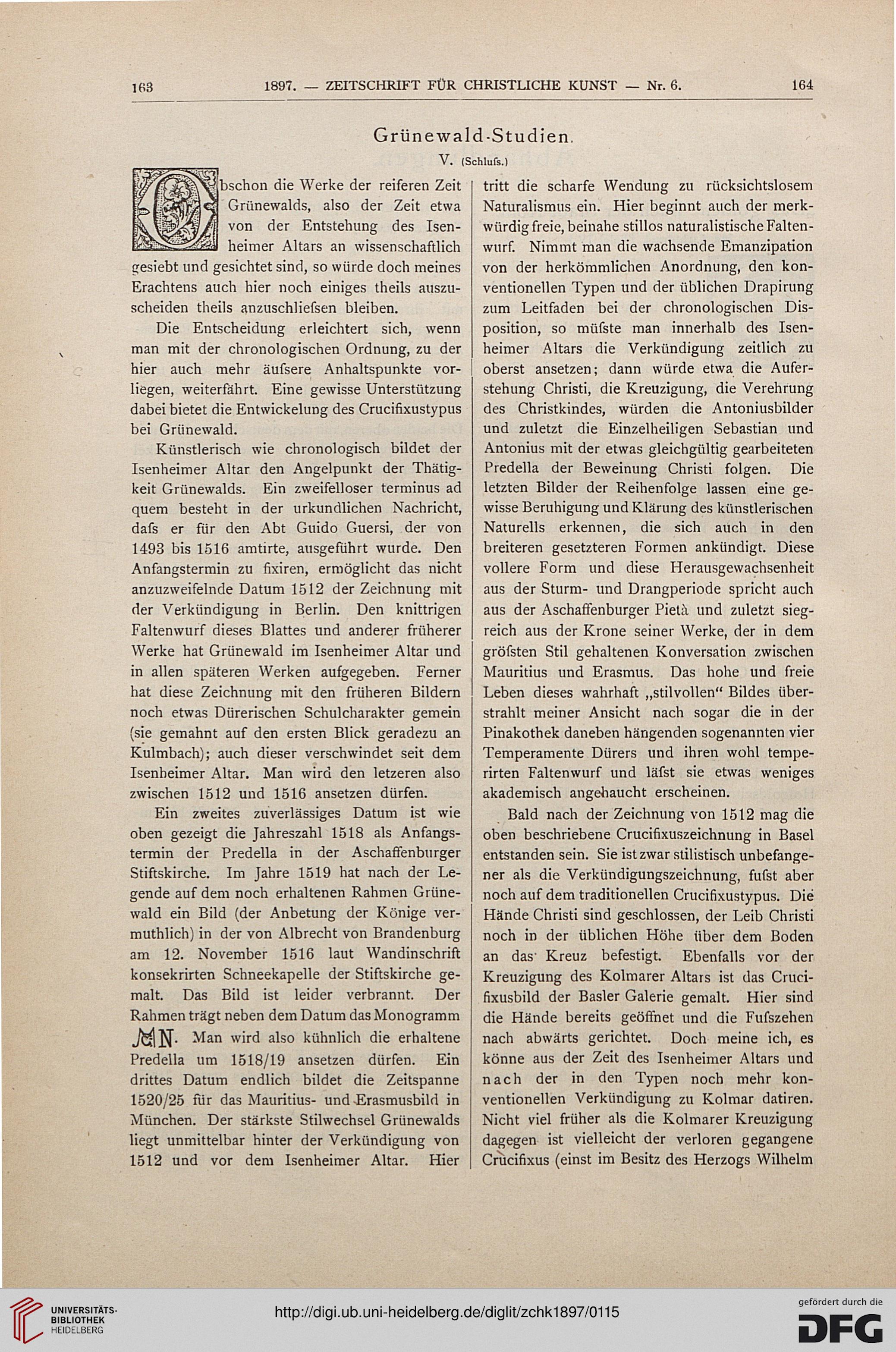163
1897.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTUCHE KUNST — Nr. 6.
164
Grünewald-Studien.
V. (Schlufs.)
'bschon die Werke der reiferen Zeit
Grünewalds, also der Zeit etwa
von der Entstehung des Isen-
heimer Altars an wissenschaftlich
gesiebt und gesichtet sind, so würde doch meines
Erachtens auch hier noch einiges theils auszu-
scheiden theils anzuschliefsen bleiben.
Die Entscheidung erleichtert sich, wenn
man mit der chronologischen Ordnung, zu der
hier auch mehr äufsere Anhaltspunkte vor-
liegen, weiterfährt. Eine gewisse Unterstützung
dabei bietet die Entwickelung des Crucifixustypus
bei Grünewald.
Künstlerisch wie chronologisch bildet der
Isenheimer Altar den Angelpunkt der Thätig-
keit Grünewalds. Ein zweifelloser terminus ad
quem besteht in der urkundlichen Nachricht,
dafs er für den Abt Guido Guersi, der von
1493 bis 1516 amtirte, ausgeführt wurde. Den
Anfangstermin zu fixiren, ermöglicht das nicht
anzuzweifelnde Datum 1512 der Zeichnung mit
der Verkündigung in Berlin. Den knittrigen
Faltenwurf dieses Blattes und anderer früherer
Werke hat Grünewald im Isenheimer Altar und
in allen späteren Werken aufgegeben. Ferner
hat diese Zeichnung mit den früheren Bildern
noch etwas Dürerischen Schulcharakter gemein
(sie gemahnt auf den ersten Blick geradezu an
Kulmbach); auch dieser verschwindet seit dem
Isenheimer Altar. Man wird den letzeren also
zwischen 1512 und 1516 ansetzen dürfen.
Ein zweites zuverlässiges Datum ist wie
oben gezeigt die Jahreszahl 1518 als Anfangs-
termin der Predella in der Aschaffenburger
Stiftskirche. Im Jahre 1519 hat nach der Le-
gende auf dem noch erhaltenen Rahmen Grüne-
wald ein Bild (der Anbetung der Könige ver-
muthlich) in der von Albrecht von Brandenburg
am 12. November 1516 laut Wandinschrift
konsekrirten Schneekapelle der Stiftskirche ge-
malt. Das Bild ist leider verbrannt. Der
Rahmen trägt neben dem Datum das Monogramm
Jr^lJJ. Man wird also kühnlich die erhaltene
Predella um 1518/19 ansetzen dürfen. Ein
drittes Datum endlich bildet die Zeitspanne
1520/25 für das Mauritius- und-Erasmusbild in
München. Der stärkste Stilwechsel Grünewalds
liegt unmittelbar hinter der Verkündigung von
1512 und vor dem Isenheimer Altar. Hier
tritt die scharfe Wendung zu rücksichtslosem
Naturalismus ein. Hier beginnt auch der merk-
würdigfreie, beinahe stillos naturalistische Falten-
wurf. Nimmt man die wachsende Emanzipation
von der herkömmlichen Anordnung, den kon-
ventionellen Typen und der üblichen Drapirung
zum Leitfaden bei der chronologischen Dis-
position, so müfste man innerhalb des Isen-
heimer Altars die Verkündigung zeitlich zu
oberst ansetzen; dann würde etwa die Aufer-
stehung Christi, die Kreuzigung, die Verehrung
des Christkindes, würden die Antoniusbilder
und zuletzt die Einzelheiligen Sebastian und
Antonius mit der etwas gleichgültig gearbeiteten
Predella der Beweinung Christi folgen. Die
letzten Bilder der Reihenfolge lassen eine ge-
wisse Beruhigung und Klärung des künstlerischen
Naturells erkennen, die sich auch in den
breiteren gesetzteren Formen ankündigt. Diese
vollere Form und diese Herausgewachsenheit
aus der Sturm- und Drangperiode spricht auch
aus der Aschaffenburger Pieta und zuletzt sieg-
reich aus der Krone seiner Werke, der in dem
gröfsten Stil gehaltenen Konversation zwischen
Mauritius und Erasmus. Das hohe und freie
Leben dieses wahrhaft „stilvollen" Bildes über-
strahlt meiner Ansicht nach sogar die in der
Pinakothek daneben hängenden sogenannten vier
Temperamente Dürers und ihren wohl tempe-
rirten Faltenwurf und läfst sie etwas weniges
akademisch angehaucht erscheinen.
Bald nach der Zeichnung von 1512 mag die
oben beschriebene Crucifixuszeichnung in Basel
entstanden sein. Sie ist zwar stilistisch unbefange-
ner als die Verkündigungszeichnung, fufst aber
noch auf dem traditionellen Crucifixustypus. Die
Hände Christi sind geschlossen, der Leib Christi
noch in der üblichen Höhe über dem Boden
an das- Kreuz befestigt. Ebenfalls vor der
Kreuzigung des Kolmarer Altars ist das Cruci-
fixusbild der Basler Galerie gemalt. Hier sind
die Hände bereits geöffnet und die Fufszehen
nach abwärts gerichtet. Doch meine ich, es
könne aus der Zeit des Isenheimer Altars und
nach der in den Typen noch mehr kon-
ventionellen Verkündigung zu Kolmar datiren.
Nicht viel früher als die Kolmarer Kreuzigung
dagegen ist vielleicht der verloren gegangene
Crucifixus (einst im Besitz des Herzogs Wilhelm
1897.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTUCHE KUNST — Nr. 6.
164
Grünewald-Studien.
V. (Schlufs.)
'bschon die Werke der reiferen Zeit
Grünewalds, also der Zeit etwa
von der Entstehung des Isen-
heimer Altars an wissenschaftlich
gesiebt und gesichtet sind, so würde doch meines
Erachtens auch hier noch einiges theils auszu-
scheiden theils anzuschliefsen bleiben.
Die Entscheidung erleichtert sich, wenn
man mit der chronologischen Ordnung, zu der
hier auch mehr äufsere Anhaltspunkte vor-
liegen, weiterfährt. Eine gewisse Unterstützung
dabei bietet die Entwickelung des Crucifixustypus
bei Grünewald.
Künstlerisch wie chronologisch bildet der
Isenheimer Altar den Angelpunkt der Thätig-
keit Grünewalds. Ein zweifelloser terminus ad
quem besteht in der urkundlichen Nachricht,
dafs er für den Abt Guido Guersi, der von
1493 bis 1516 amtirte, ausgeführt wurde. Den
Anfangstermin zu fixiren, ermöglicht das nicht
anzuzweifelnde Datum 1512 der Zeichnung mit
der Verkündigung in Berlin. Den knittrigen
Faltenwurf dieses Blattes und anderer früherer
Werke hat Grünewald im Isenheimer Altar und
in allen späteren Werken aufgegeben. Ferner
hat diese Zeichnung mit den früheren Bildern
noch etwas Dürerischen Schulcharakter gemein
(sie gemahnt auf den ersten Blick geradezu an
Kulmbach); auch dieser verschwindet seit dem
Isenheimer Altar. Man wird den letzeren also
zwischen 1512 und 1516 ansetzen dürfen.
Ein zweites zuverlässiges Datum ist wie
oben gezeigt die Jahreszahl 1518 als Anfangs-
termin der Predella in der Aschaffenburger
Stiftskirche. Im Jahre 1519 hat nach der Le-
gende auf dem noch erhaltenen Rahmen Grüne-
wald ein Bild (der Anbetung der Könige ver-
muthlich) in der von Albrecht von Brandenburg
am 12. November 1516 laut Wandinschrift
konsekrirten Schneekapelle der Stiftskirche ge-
malt. Das Bild ist leider verbrannt. Der
Rahmen trägt neben dem Datum das Monogramm
Jr^lJJ. Man wird also kühnlich die erhaltene
Predella um 1518/19 ansetzen dürfen. Ein
drittes Datum endlich bildet die Zeitspanne
1520/25 für das Mauritius- und-Erasmusbild in
München. Der stärkste Stilwechsel Grünewalds
liegt unmittelbar hinter der Verkündigung von
1512 und vor dem Isenheimer Altar. Hier
tritt die scharfe Wendung zu rücksichtslosem
Naturalismus ein. Hier beginnt auch der merk-
würdigfreie, beinahe stillos naturalistische Falten-
wurf. Nimmt man die wachsende Emanzipation
von der herkömmlichen Anordnung, den kon-
ventionellen Typen und der üblichen Drapirung
zum Leitfaden bei der chronologischen Dis-
position, so müfste man innerhalb des Isen-
heimer Altars die Verkündigung zeitlich zu
oberst ansetzen; dann würde etwa die Aufer-
stehung Christi, die Kreuzigung, die Verehrung
des Christkindes, würden die Antoniusbilder
und zuletzt die Einzelheiligen Sebastian und
Antonius mit der etwas gleichgültig gearbeiteten
Predella der Beweinung Christi folgen. Die
letzten Bilder der Reihenfolge lassen eine ge-
wisse Beruhigung und Klärung des künstlerischen
Naturells erkennen, die sich auch in den
breiteren gesetzteren Formen ankündigt. Diese
vollere Form und diese Herausgewachsenheit
aus der Sturm- und Drangperiode spricht auch
aus der Aschaffenburger Pieta und zuletzt sieg-
reich aus der Krone seiner Werke, der in dem
gröfsten Stil gehaltenen Konversation zwischen
Mauritius und Erasmus. Das hohe und freie
Leben dieses wahrhaft „stilvollen" Bildes über-
strahlt meiner Ansicht nach sogar die in der
Pinakothek daneben hängenden sogenannten vier
Temperamente Dürers und ihren wohl tempe-
rirten Faltenwurf und läfst sie etwas weniges
akademisch angehaucht erscheinen.
Bald nach der Zeichnung von 1512 mag die
oben beschriebene Crucifixuszeichnung in Basel
entstanden sein. Sie ist zwar stilistisch unbefange-
ner als die Verkündigungszeichnung, fufst aber
noch auf dem traditionellen Crucifixustypus. Die
Hände Christi sind geschlossen, der Leib Christi
noch in der üblichen Höhe über dem Boden
an das- Kreuz befestigt. Ebenfalls vor der
Kreuzigung des Kolmarer Altars ist das Cruci-
fixusbild der Basler Galerie gemalt. Hier sind
die Hände bereits geöffnet und die Fufszehen
nach abwärts gerichtet. Doch meine ich, es
könne aus der Zeit des Isenheimer Altars und
nach der in den Typen noch mehr kon-
ventionellen Verkündigung zu Kolmar datiren.
Nicht viel früher als die Kolmarer Kreuzigung
dagegen ist vielleicht der verloren gegangene
Crucifixus (einst im Besitz des Herzogs Wilhelm