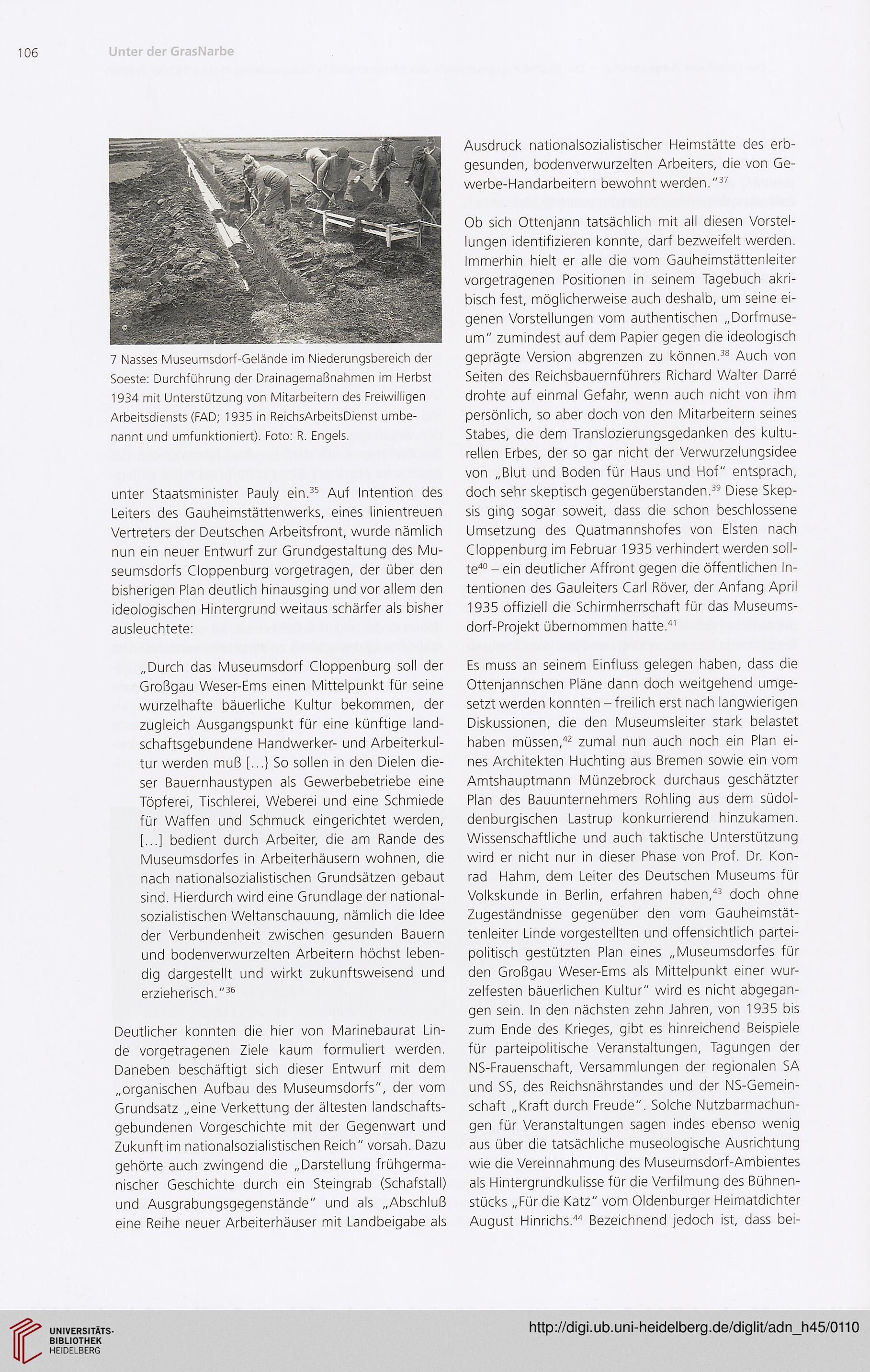106
Jnter der GrasNarbe
7 Nasses Museumsdorf-Gelände im Niederungsbereich der
Soeste: Durchführung der Drainagemaßnahmen im Herbst
1934 mit Unterstützung von Mitarbeitern des Freiwilligen
Arbeitsdiensts (FAD; 1935 in ReichsArbeitsDienst umbe-
nannt und umfunktioniert). Foto: R. Engels.
unter Staatsminister Pauly ein.35 Auf Intention des
Leiters des Gauheimstättenwerks, eines linientreuen
Vertreters der Deutschen Arbeitsfront, wurde nämlich
nun ein neuer Entwurf zur Grundgestaltung des Mu-
seumsdorfs Cloppenburg vorgetragen, der über den
bisherigen Plan deutlich hinausging und vor allem den
ideologischen Hintergrund weitaus schärfer als bisher
ausleuchtete:
Ausdruck nationalsozialistischer Heimstätte des erb-
gesunden, bodenverwurzelten Arbeiters, die von Ge-
werbe-Handarbeitern bewohnt werden."37
Ob sich Ottenjann tatsächlich mit all diesen Vorstel-
lungen identifizieren konnte, darf bezweifelt werden.
Immerhin hielt er alle die vom Gauheimstättenleiter
vorgetragenen Positionen in seinem Tagebuch akri-
bisch fest, möglicherweise auch deshalb, um seine ei-
genen Vorstellungen vom authentischen „Dorfmuse-
um" zumindest auf dem Papier gegen die ideologisch
geprägte Version abgrenzen zu können.38 Auch von
Seiten des Reichsbauernführers Richard Walter Darre
drohte auf einmal Gefahr, wenn auch nicht von ihm
persönlich, so aber doch von den Mitarbeitern seines
Stabes, die dem Translozierungsgedanken des kultu-
rellen Erbes, der so gar nicht der Verwurzelungsidee
von „Blut und Boden für Haus und Hof" entsprach,
doch sehr skeptisch gegenüberstanden.39 Diese Skep-
sis ging sogar soweit, dass die schon beschlossene
Umsetzung des Quatmannshofes von Elsten nach
Cloppenburg im Februar 1935 verhindert werden soll-
te40 - ein deutlicher Affront gegen die öffentlichen In-
tentionen des Gauleiters Carl Rover, der Anfang April
1935 offiziell die Schirmherrschaft für das Museums-
dorf-Projekt übernommen hatte.41
„Durch das Museumsdorf Cloppenburg soll der
Großgau Weser-Ems einen Mittelpunkt für seine
wurzelhafte bäuerliche Kultur bekommen, der
zugleich Ausgangspunkt für eine künftige land-
schaftsgebundene Handwerker- und Arbeiterkul-
tur werden muß [...} So sollen in den Dielen die-
ser Bauernhaustypen als Gewerbebetriebe eine
Töpferei, Tischlerei, Weberei und eine Schmiede
für Waffen und Schmuck eingerichtet werden,
[...] bedient durch Arbeiter, die am Rande des
Museumsdorfes in Arbeiterhäusern wohnen, die
nach nationalsozialistischen Grundsätzen gebaut
sind. Hierdurch wird eine Grundlage der national-
sozialistischen Weltanschauung, nämlich die Idee
der Verbundenheit zwischen gesunden Bauern
und bodenverwurzelten Arbeitern höchst leben-
dig dargestellt und wirkt zukunftsweisend und
erzieherisch."35
Deutlicher konnten die hier von Marinebaurat Lin-
de vorgetragenen Ziele kaum formuliert werden.
Daneben beschäftigt sich dieser Entwurf mit dem
„organischen Aufbau des Museumsdorfs", der vom
Grundsatz „eine Verkettung der ältesten landschafts-
gebundenen Vorgeschichte mit der Gegenwart und
Zukunft im nationalsozialistischen Reich" vorsah. Dazu
gehörte auch zwingend die „Darstellung frühgerma-
nischer Geschichte durch ein Steingrab (Schafstall)
und Ausgrabungsgegenstände" und als „Abschluß
eine Reihe neuer Arbeiterhäuser mit Landbeigabe als
Es muss an seinem Einfluss gelegen haben, dass die
Ottenjannschen Pläne dann doch weitgehend umge-
setztwerden konnten - freilich erst nach langwierigen
Diskussionen, die den Museumsleiter stark belastet
haben müssen,42 zumal nun auch noch ein Plan ei-
nes Architekten Huchting aus Bremen sowie ein vom
Amtshauptmann Münzebrock durchaus geschätzter
Plan des Bauunternehmers Rohling aus dem südol-
denburgischen Lastrup konkurrierend hinzukamen.
Wissenschaftliche und auch taktische Unterstützung
wird er nicht nur in dieser Phase von Prof. Dr. Kon-
rad Hahm, dem Leiter des Deutschen Museums für
Volkskunde in Berlin, erfahren haben,43 doch ohne
Zugeständnisse gegenüber den vom Gauheimstät-
tenleiter Linde vorgestellten und offensichtlich partei-
politisch gestützten Plan eines „Museumsdorfes für
den Großgau Weser-Ems als Mittelpunkt einer wur-
zelfesten bäuerlichen Kultur" wird es nicht abgegan-
gen sein. In den nächsten zehn Jahren, von 1935 bis
zum Ende des Krieges, gibt es hinreichend Beispiele
für parteipolitische Veranstaltungen, Tagungen der
NS-Frauenschaft, Versammlungen der regionalen SA
und SS, des Reichsnährstandes und der NS-Gemein-
schaft „Kraft durch Freude". Solche Nutzbarmachun-
gen für Veranstaltungen sagen indes ebenso wenig
aus über die tatsächliche museologische Ausrichtung
wie die Vereinnahmung des Museumsdorf-Ambientes
als Hintergrundkulisse für die Verfilmung des Bühnen-
stücks „Für die Katz" vom Oldenburger Heimatdichter
August Hinrichs.44 Bezeichnend jedoch ist, dass bei-
Jnter der GrasNarbe
7 Nasses Museumsdorf-Gelände im Niederungsbereich der
Soeste: Durchführung der Drainagemaßnahmen im Herbst
1934 mit Unterstützung von Mitarbeitern des Freiwilligen
Arbeitsdiensts (FAD; 1935 in ReichsArbeitsDienst umbe-
nannt und umfunktioniert). Foto: R. Engels.
unter Staatsminister Pauly ein.35 Auf Intention des
Leiters des Gauheimstättenwerks, eines linientreuen
Vertreters der Deutschen Arbeitsfront, wurde nämlich
nun ein neuer Entwurf zur Grundgestaltung des Mu-
seumsdorfs Cloppenburg vorgetragen, der über den
bisherigen Plan deutlich hinausging und vor allem den
ideologischen Hintergrund weitaus schärfer als bisher
ausleuchtete:
Ausdruck nationalsozialistischer Heimstätte des erb-
gesunden, bodenverwurzelten Arbeiters, die von Ge-
werbe-Handarbeitern bewohnt werden."37
Ob sich Ottenjann tatsächlich mit all diesen Vorstel-
lungen identifizieren konnte, darf bezweifelt werden.
Immerhin hielt er alle die vom Gauheimstättenleiter
vorgetragenen Positionen in seinem Tagebuch akri-
bisch fest, möglicherweise auch deshalb, um seine ei-
genen Vorstellungen vom authentischen „Dorfmuse-
um" zumindest auf dem Papier gegen die ideologisch
geprägte Version abgrenzen zu können.38 Auch von
Seiten des Reichsbauernführers Richard Walter Darre
drohte auf einmal Gefahr, wenn auch nicht von ihm
persönlich, so aber doch von den Mitarbeitern seines
Stabes, die dem Translozierungsgedanken des kultu-
rellen Erbes, der so gar nicht der Verwurzelungsidee
von „Blut und Boden für Haus und Hof" entsprach,
doch sehr skeptisch gegenüberstanden.39 Diese Skep-
sis ging sogar soweit, dass die schon beschlossene
Umsetzung des Quatmannshofes von Elsten nach
Cloppenburg im Februar 1935 verhindert werden soll-
te40 - ein deutlicher Affront gegen die öffentlichen In-
tentionen des Gauleiters Carl Rover, der Anfang April
1935 offiziell die Schirmherrschaft für das Museums-
dorf-Projekt übernommen hatte.41
„Durch das Museumsdorf Cloppenburg soll der
Großgau Weser-Ems einen Mittelpunkt für seine
wurzelhafte bäuerliche Kultur bekommen, der
zugleich Ausgangspunkt für eine künftige land-
schaftsgebundene Handwerker- und Arbeiterkul-
tur werden muß [...} So sollen in den Dielen die-
ser Bauernhaustypen als Gewerbebetriebe eine
Töpferei, Tischlerei, Weberei und eine Schmiede
für Waffen und Schmuck eingerichtet werden,
[...] bedient durch Arbeiter, die am Rande des
Museumsdorfes in Arbeiterhäusern wohnen, die
nach nationalsozialistischen Grundsätzen gebaut
sind. Hierdurch wird eine Grundlage der national-
sozialistischen Weltanschauung, nämlich die Idee
der Verbundenheit zwischen gesunden Bauern
und bodenverwurzelten Arbeitern höchst leben-
dig dargestellt und wirkt zukunftsweisend und
erzieherisch."35
Deutlicher konnten die hier von Marinebaurat Lin-
de vorgetragenen Ziele kaum formuliert werden.
Daneben beschäftigt sich dieser Entwurf mit dem
„organischen Aufbau des Museumsdorfs", der vom
Grundsatz „eine Verkettung der ältesten landschafts-
gebundenen Vorgeschichte mit der Gegenwart und
Zukunft im nationalsozialistischen Reich" vorsah. Dazu
gehörte auch zwingend die „Darstellung frühgerma-
nischer Geschichte durch ein Steingrab (Schafstall)
und Ausgrabungsgegenstände" und als „Abschluß
eine Reihe neuer Arbeiterhäuser mit Landbeigabe als
Es muss an seinem Einfluss gelegen haben, dass die
Ottenjannschen Pläne dann doch weitgehend umge-
setztwerden konnten - freilich erst nach langwierigen
Diskussionen, die den Museumsleiter stark belastet
haben müssen,42 zumal nun auch noch ein Plan ei-
nes Architekten Huchting aus Bremen sowie ein vom
Amtshauptmann Münzebrock durchaus geschätzter
Plan des Bauunternehmers Rohling aus dem südol-
denburgischen Lastrup konkurrierend hinzukamen.
Wissenschaftliche und auch taktische Unterstützung
wird er nicht nur in dieser Phase von Prof. Dr. Kon-
rad Hahm, dem Leiter des Deutschen Museums für
Volkskunde in Berlin, erfahren haben,43 doch ohne
Zugeständnisse gegenüber den vom Gauheimstät-
tenleiter Linde vorgestellten und offensichtlich partei-
politisch gestützten Plan eines „Museumsdorfes für
den Großgau Weser-Ems als Mittelpunkt einer wur-
zelfesten bäuerlichen Kultur" wird es nicht abgegan-
gen sein. In den nächsten zehn Jahren, von 1935 bis
zum Ende des Krieges, gibt es hinreichend Beispiele
für parteipolitische Veranstaltungen, Tagungen der
NS-Frauenschaft, Versammlungen der regionalen SA
und SS, des Reichsnährstandes und der NS-Gemein-
schaft „Kraft durch Freude". Solche Nutzbarmachun-
gen für Veranstaltungen sagen indes ebenso wenig
aus über die tatsächliche museologische Ausrichtung
wie die Vereinnahmung des Museumsdorf-Ambientes
als Hintergrundkulisse für die Verfilmung des Bühnen-
stücks „Für die Katz" vom Oldenburger Heimatdichter
August Hinrichs.44 Bezeichnend jedoch ist, dass bei-