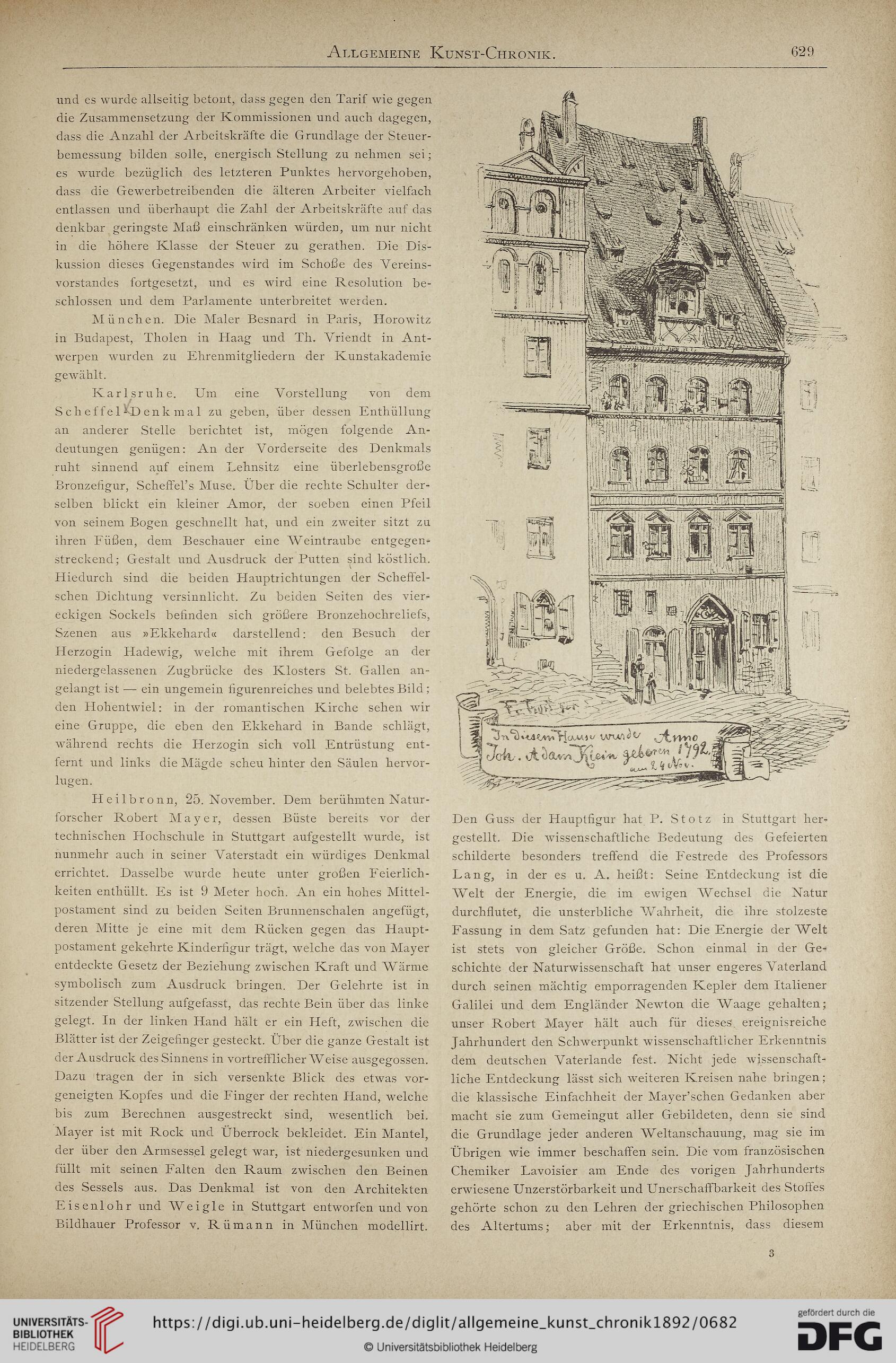Allgemeine Kunst-Chronik.
629
und es wurde allseitig betont, dass gegen den Tarif wie gegen
die Zusammensetzung der Kommissionen und auch dagegen,
dass die Anzahl der Arbeitskräfte die Grundlage der Steuer-
bemessung bilden solle, energisch Stellung zu nehmen sei;
es wurde bezüglich des letzteren Punktes hervorgehoben,
dass die Gewerbetreibenden die älteren Arbeiter vielfach
entlassen und überhaupt die Zahl der Arbeitskräfte auf das
denkbar, geringste Maß einschränken würden, um nur nicht
in die höhere Klasse der Steuer zu gerathen. Die Dis-
kussion dieses Gegenstandes wird im Schoße des Vereins-
vorstandes fortgesetzt, und es wird eine Resolution be-
schlossen und dem Parlamente unterbreitet werden.
München. Die Maler Besnard in Paris, Horowitz
in Budapest, Tholen in Haag und Th. Vriendt in Ant-
werpen wurden zu Ehrenmitgliedern der Kunstakademie
gewählt.
Karlsruhe. Um eine Vorstellung von dem
Scheffel ^Denkmal zu geben, über dessen Enthüllung
an anderer Stelle berichtet ist, mögen folgende An-
deutungen genügen: An der Vorderseite des Denkmals
ruht sinnend auf einem Lehnsitz eine überlebensgroße
Bronzefigur, Scheffel's Muse. Über die rechte Schulter der-
selben blickt ein kleiner Amor, der soeben einen Pfeil
von seinem Bogen geschnellt hat, und ein zweiter sitzt zu
ihren Füßen, dem Beschauer eine Weintraube entgegen-
streckend; Gestalt und Ausdruck der Putten sind köstlich.
Hiedurch sind die beiden Hauptrichtungen der Scheffel-
schen Dichtung versinnlicht. Zu beiden Seiten des vier-
eckigen Sockels befinden sich größere Bronzehochreliefs,
Szenen aus »Ekkehard« darstellend: den Besuch der
Herzogin Hadewig, welche mit ihrem Gefolge an der
niedergelassenen Zugbrücke des Klosters St. Gallen an-
gelangt ist — ein ungemein figurenreiches und belebtes Bild ;
den Hohentwiel: in der romantischen Kirche sehen wir
eine Gruppe, die eben den Ekkehard in Bande schlägt,
während rechts die Herzogin sich voll Entrüstung ent-
fernt und links die Mägde scheu hinter den Säulen hervor-
lugen.
Heilbronn, 25. November. Dem berühmten Natur-
forscher Robert Mayer, dessen Büste bereits vor der
technischen Hochschule in Stuttgart aufgestellt wurde, ist
nunmehr auch in seiner Vaterstadt ein würdiges Denkmal
errichtet. Dasselbe wurde heute unter großen Feierlich-
keiten enthüllt. Es ist 9 Meter hoch. An ein hohes Mittel-
postament sind zu beiden Seiten Brunnenschalen angefügt,
deren Mitte je eine mit dem Rücken gegen das Haupt-
postament gekehrte Kinderfigur trägt, welche das von Mayer
entdeckte Gesetz der Beziehung zwischen Kraft und Wärme
symbolisch zum Ausdruck bringen. Der Gelehrte ist in
sitzender Stellung aufgefasst, das rechte Bein über das linke
gelegt. In der linken Hand hält er ein Heft, zwischen die
Blätter ist der Zeigefinger gesteckt. Über die ganze Gestalt ist
der Ausdruck des Sinnens in vortrefflicher Weise ausgegossen.
Dazu tragen der in sich versenkte Blick des etwas vor-
geneigten Kopfes und die Finger der rechten Hand, welche
bis zum Berechnen ausgestreckt sind, wesentlich bei.
Mayer ist mit Rock und Überrock bekleidet. Ein Mantel,
der über den Armsessel gelegt war, ist niedergesunken und
füllt mit seinen Falten den Raum zwischen den Beinen
des Sessels aus. Das Denkmal ist von den Architekten
Eisenlohr und Weigle in Stuttgart entworfen und von
Bildhauer Professor v. Rümann in München modellirt.
Den Guss der Hauptfigur hat P. Stotz in Stuttgart her-
gestellt. Die wissenschaftliche Bedeutung des Gefeierten
schilderte besonders treffend die Festrede des Professors
Lang, in der es u. A. heißt: Seine Entdeckung ist die
Welt der Energie, die im ewigen Wechsel die Natur
durchflutet, die unsterbliche Wahrheit, die ihre stolzeste
Fassung in dem Satz gefunden hat: Die Energie der Welt
ist stets von gleicher Größe. Schon einmal in der Ge-
schichte der Naturwissenschaft hat unser engeres Vaterland
durch seinen mächtig emporragenden Kepler dem Italiener
Galilei und dem Engländer Newton die Waage gehalten;
unser Robert Mayer hält auch für dieses, ereignisreiche
Jahrhundert den Schwerpunkt wissenschaftlicher Erkenntnis
dem deutschen Vaterlande fest. Nicht jede wissenschaft-
liche Entdeckung lässt sich weiteren Kreisen nahe bringen;
die klassische Einfachheit der Mayer'schen Gedanken aber
macht sie zum Gemeingut aller Gebildeten, denn sie sind
die Grundlage jeder anderen Weltanschauung, mag sie im
Übrigen wie immer beschaffen sein. Die vom französischen
Chemiker Lavoisier am Ende des vorigen Jahrhunderts
erwiesene Unzerstörbarkeit und Ünerschaffbarkeit des Stoffes
gehörte schon zu den Lehren der griechischen Philosophen
des Altertums; aber mit der Erkenntnis, dass diesem
3
629
und es wurde allseitig betont, dass gegen den Tarif wie gegen
die Zusammensetzung der Kommissionen und auch dagegen,
dass die Anzahl der Arbeitskräfte die Grundlage der Steuer-
bemessung bilden solle, energisch Stellung zu nehmen sei;
es wurde bezüglich des letzteren Punktes hervorgehoben,
dass die Gewerbetreibenden die älteren Arbeiter vielfach
entlassen und überhaupt die Zahl der Arbeitskräfte auf das
denkbar, geringste Maß einschränken würden, um nur nicht
in die höhere Klasse der Steuer zu gerathen. Die Dis-
kussion dieses Gegenstandes wird im Schoße des Vereins-
vorstandes fortgesetzt, und es wird eine Resolution be-
schlossen und dem Parlamente unterbreitet werden.
München. Die Maler Besnard in Paris, Horowitz
in Budapest, Tholen in Haag und Th. Vriendt in Ant-
werpen wurden zu Ehrenmitgliedern der Kunstakademie
gewählt.
Karlsruhe. Um eine Vorstellung von dem
Scheffel ^Denkmal zu geben, über dessen Enthüllung
an anderer Stelle berichtet ist, mögen folgende An-
deutungen genügen: An der Vorderseite des Denkmals
ruht sinnend auf einem Lehnsitz eine überlebensgroße
Bronzefigur, Scheffel's Muse. Über die rechte Schulter der-
selben blickt ein kleiner Amor, der soeben einen Pfeil
von seinem Bogen geschnellt hat, und ein zweiter sitzt zu
ihren Füßen, dem Beschauer eine Weintraube entgegen-
streckend; Gestalt und Ausdruck der Putten sind köstlich.
Hiedurch sind die beiden Hauptrichtungen der Scheffel-
schen Dichtung versinnlicht. Zu beiden Seiten des vier-
eckigen Sockels befinden sich größere Bronzehochreliefs,
Szenen aus »Ekkehard« darstellend: den Besuch der
Herzogin Hadewig, welche mit ihrem Gefolge an der
niedergelassenen Zugbrücke des Klosters St. Gallen an-
gelangt ist — ein ungemein figurenreiches und belebtes Bild ;
den Hohentwiel: in der romantischen Kirche sehen wir
eine Gruppe, die eben den Ekkehard in Bande schlägt,
während rechts die Herzogin sich voll Entrüstung ent-
fernt und links die Mägde scheu hinter den Säulen hervor-
lugen.
Heilbronn, 25. November. Dem berühmten Natur-
forscher Robert Mayer, dessen Büste bereits vor der
technischen Hochschule in Stuttgart aufgestellt wurde, ist
nunmehr auch in seiner Vaterstadt ein würdiges Denkmal
errichtet. Dasselbe wurde heute unter großen Feierlich-
keiten enthüllt. Es ist 9 Meter hoch. An ein hohes Mittel-
postament sind zu beiden Seiten Brunnenschalen angefügt,
deren Mitte je eine mit dem Rücken gegen das Haupt-
postament gekehrte Kinderfigur trägt, welche das von Mayer
entdeckte Gesetz der Beziehung zwischen Kraft und Wärme
symbolisch zum Ausdruck bringen. Der Gelehrte ist in
sitzender Stellung aufgefasst, das rechte Bein über das linke
gelegt. In der linken Hand hält er ein Heft, zwischen die
Blätter ist der Zeigefinger gesteckt. Über die ganze Gestalt ist
der Ausdruck des Sinnens in vortrefflicher Weise ausgegossen.
Dazu tragen der in sich versenkte Blick des etwas vor-
geneigten Kopfes und die Finger der rechten Hand, welche
bis zum Berechnen ausgestreckt sind, wesentlich bei.
Mayer ist mit Rock und Überrock bekleidet. Ein Mantel,
der über den Armsessel gelegt war, ist niedergesunken und
füllt mit seinen Falten den Raum zwischen den Beinen
des Sessels aus. Das Denkmal ist von den Architekten
Eisenlohr und Weigle in Stuttgart entworfen und von
Bildhauer Professor v. Rümann in München modellirt.
Den Guss der Hauptfigur hat P. Stotz in Stuttgart her-
gestellt. Die wissenschaftliche Bedeutung des Gefeierten
schilderte besonders treffend die Festrede des Professors
Lang, in der es u. A. heißt: Seine Entdeckung ist die
Welt der Energie, die im ewigen Wechsel die Natur
durchflutet, die unsterbliche Wahrheit, die ihre stolzeste
Fassung in dem Satz gefunden hat: Die Energie der Welt
ist stets von gleicher Größe. Schon einmal in der Ge-
schichte der Naturwissenschaft hat unser engeres Vaterland
durch seinen mächtig emporragenden Kepler dem Italiener
Galilei und dem Engländer Newton die Waage gehalten;
unser Robert Mayer hält auch für dieses, ereignisreiche
Jahrhundert den Schwerpunkt wissenschaftlicher Erkenntnis
dem deutschen Vaterlande fest. Nicht jede wissenschaft-
liche Entdeckung lässt sich weiteren Kreisen nahe bringen;
die klassische Einfachheit der Mayer'schen Gedanken aber
macht sie zum Gemeingut aller Gebildeten, denn sie sind
die Grundlage jeder anderen Weltanschauung, mag sie im
Übrigen wie immer beschaffen sein. Die vom französischen
Chemiker Lavoisier am Ende des vorigen Jahrhunderts
erwiesene Unzerstörbarkeit und Ünerschaffbarkeit des Stoffes
gehörte schon zu den Lehren der griechischen Philosophen
des Altertums; aber mit der Erkenntnis, dass diesem
3