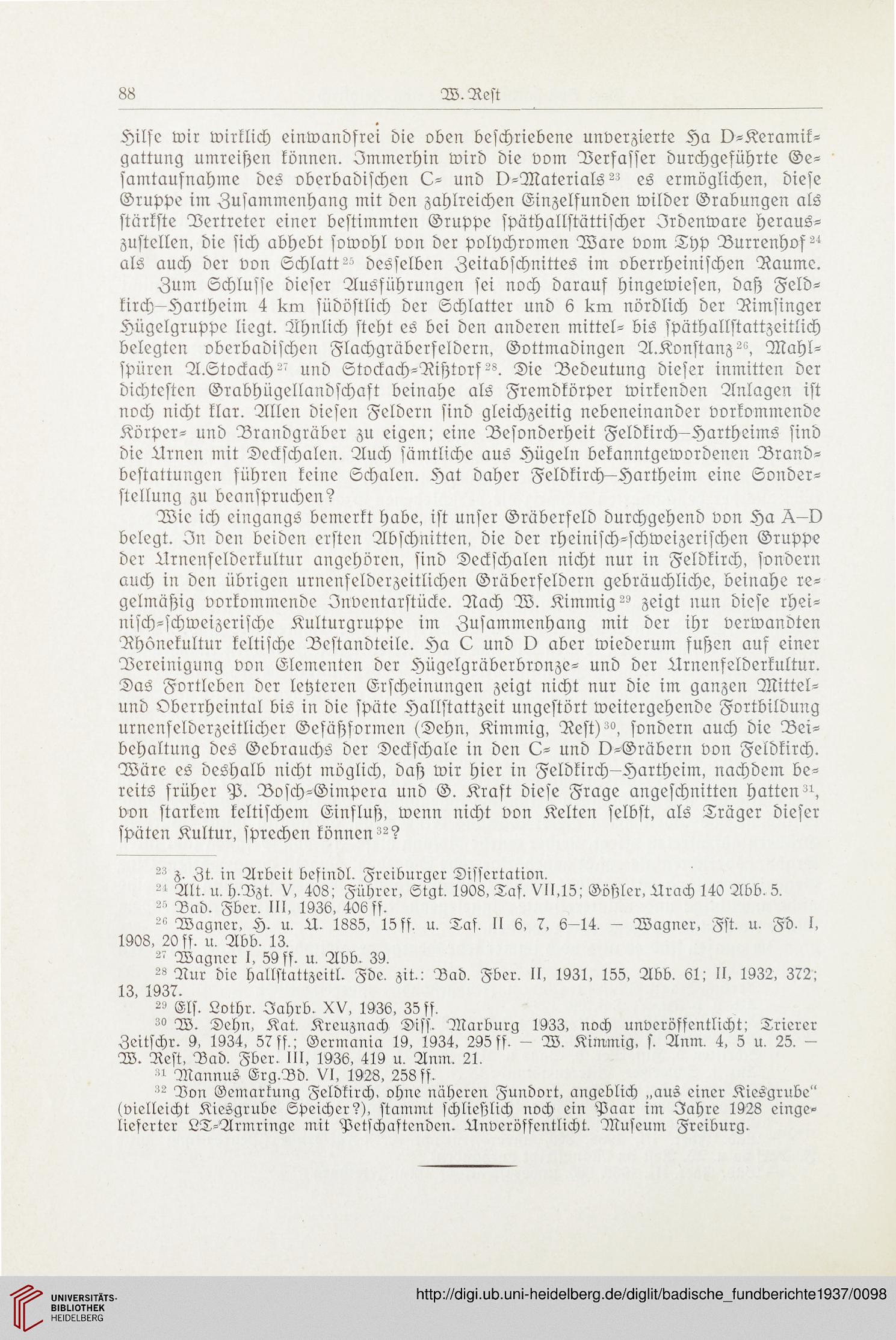88
W. Rest
Hilfe wir wirklich einwandfrei die oben beschriebene unverzierte Ha O-Keramik-
gattung umreißen können. Immerhin wird die vom Verfasser durchgeführte Ge-
famtaufnahme des oberbadischen E- und O-Materials^ es ermöglichen, diese
Gruppe im Zusammenhang mit den zahlreichen Einzelfunöen wilder Grabungen als
stärkste Vertreter einer bestimmten Gruppe späthallstättischer Irdenware heraus-
zustellen, die sich abhebt sowohl von der polychromen Ware vom Typ Burrenhof^
als auch der von Schlatt^ desselben Zeitabschnittes im oberrheinischen Raume.
Zum Schlüsse dieser Ausführungen sei noch darauf hingewiesen, daß Feld-
kirch-Hartheim 4 Irin südöstlich der Schlatter und 6 knr nördlich der Rimsinger
Hügelgruppe liegt. Ähnlich steht es bei den anderen mittel- bis späthallstattzeitlich
belegten oberbadischen Flachgräberfeldern, Gottmadingen A.KonstanzMahl-
spüren A.Stockach^ und Stockach-Rißtorf^. Die Bedeutung dieser inmitten der
dichtesten Grabhügellandschast beinahe als Fremdkörper wirkenden Anlagen ist
noch nicht klar. Allen diesen Feldern sind gleichzeitig nebeneinander vorkommende
Körper- und Brandgräber zu eigen; eine Besonderheit Feldkirch-Hartheims sind
die Armen mit Deckschalen. Auch sämtliche aus Hügeln bekanntgewordenen Brand-
bestattungen führen keine Schalen. Hat daher Feldkirch—Hartheim eine Sonder-
stellung zu beanspruchen?
Wie ich eingangs bemerkt habe, ist unser Gräberfeld durchgehend von Ha Ä.-V
belegt. In den beiden ersten Abschnitten, die der rheinisch-schweizerischen Gruppe
der Arnenselderkultur angehören, sind Deckschalen nicht nur in Feldkirch, sondern
auch in den übrigen urnenfelderzeitlichen Gräberfeldern gebräuchliche, beinahe re-
gelmäßig vorkommende Inventarstücke. Nach W. Kimmig 2» zeigt nun diese rhei-
nisch-schweizerische Kulturgruppe im Zusammenhang mit der ihr verwandten
Rhonekultur keltische Bestandteile. Ha 0 und v aber wiederum fußen aus einer
Vereinigung von Elementen der Hügelgräberbronze- und der Arnenselderkultur.
Das Fortleben der letzteren Erscheinungen zeigt nicht nur die im ganzen Mittel-
und Oberrheintal bis in die späte Hallstattzeit ungestört weitergehende Fortbildung
urnenselderzeitlicher Gesäßformen (Dehn, Kimmig, Rest) 2», sondern auch die Bei-
behaltung des Gebrauchs der Deckschale in den O und O-Gräbern von Feldkirch.
Wäre es deshalb nicht möglich, daß wir hier in Feldkirch-Hartheim, nachdem be-
reits früher P. Bosch-Gimpera und G. Kraft diese Frage angeschnitten hatten^,
von starkem keltischem Einfluß, wenn nicht von Kelten selbst, als Träger dieser
späten Kultur, sprechen können^?
2b A. Zt. in Arbeit befindl. Freiburger Dissertation.
24 Alt. u. H.Bzt. V, 408; Führer, Stgt. 1908, Tas. VII,15; Gößler, Krach 140 Abb. 5.
2" Bad. Fber. III, 1936, 406 ff.
26 Wagner, H. u. K. 1885, 15 ff. u. Tas. II 6, 7, 6-14. - Wagner, Fst. u. Fd. I,
1908, 20 ff. u. Abb. 13.
2" Wagner I, 59 ff. u. Abb. 39.
2« Rur die hallstattzeitl. Fde. zit.: Bad. Fber. II, 1931, 155, Abb. 61; II, 1932, 372;
13, 1937.
2s Els. Lothr. Iahrb. XV, 1936, 35 ff.
bo W. Dehn, Kat. Kreuznach, Diss. Marburg 1933, noch unveröffentlicht; Trierer
Zeitschr. 9, 1934, 57ff.; Germania 19, 1934, 295ff. — W. Kimmig, s. Anm. 4, 5 u. 25. —
W. Rest, Bad. Fber. III, 1936, 419 u. Anm. 21.
bi Maunus Erg.Bö. VI, 1928, 258 ff.
22 Bon Gemarkung Feldkirch, ohne näheren Fundort, angeblich „aus einer Kiesgrube"
(vielleicht Kiesgrube Speicher?), stammt schließlich noch ein Paar im Iahre 1928 einge-
lieferter LT-Armringe mit Petschaftenden. Unveröffentlicht. Museum Freiburg.
W. Rest
Hilfe wir wirklich einwandfrei die oben beschriebene unverzierte Ha O-Keramik-
gattung umreißen können. Immerhin wird die vom Verfasser durchgeführte Ge-
famtaufnahme des oberbadischen E- und O-Materials^ es ermöglichen, diese
Gruppe im Zusammenhang mit den zahlreichen Einzelfunöen wilder Grabungen als
stärkste Vertreter einer bestimmten Gruppe späthallstättischer Irdenware heraus-
zustellen, die sich abhebt sowohl von der polychromen Ware vom Typ Burrenhof^
als auch der von Schlatt^ desselben Zeitabschnittes im oberrheinischen Raume.
Zum Schlüsse dieser Ausführungen sei noch darauf hingewiesen, daß Feld-
kirch-Hartheim 4 Irin südöstlich der Schlatter und 6 knr nördlich der Rimsinger
Hügelgruppe liegt. Ähnlich steht es bei den anderen mittel- bis späthallstattzeitlich
belegten oberbadischen Flachgräberfeldern, Gottmadingen A.KonstanzMahl-
spüren A.Stockach^ und Stockach-Rißtorf^. Die Bedeutung dieser inmitten der
dichtesten Grabhügellandschast beinahe als Fremdkörper wirkenden Anlagen ist
noch nicht klar. Allen diesen Feldern sind gleichzeitig nebeneinander vorkommende
Körper- und Brandgräber zu eigen; eine Besonderheit Feldkirch-Hartheims sind
die Armen mit Deckschalen. Auch sämtliche aus Hügeln bekanntgewordenen Brand-
bestattungen führen keine Schalen. Hat daher Feldkirch—Hartheim eine Sonder-
stellung zu beanspruchen?
Wie ich eingangs bemerkt habe, ist unser Gräberfeld durchgehend von Ha Ä.-V
belegt. In den beiden ersten Abschnitten, die der rheinisch-schweizerischen Gruppe
der Arnenselderkultur angehören, sind Deckschalen nicht nur in Feldkirch, sondern
auch in den übrigen urnenfelderzeitlichen Gräberfeldern gebräuchliche, beinahe re-
gelmäßig vorkommende Inventarstücke. Nach W. Kimmig 2» zeigt nun diese rhei-
nisch-schweizerische Kulturgruppe im Zusammenhang mit der ihr verwandten
Rhonekultur keltische Bestandteile. Ha 0 und v aber wiederum fußen aus einer
Vereinigung von Elementen der Hügelgräberbronze- und der Arnenselderkultur.
Das Fortleben der letzteren Erscheinungen zeigt nicht nur die im ganzen Mittel-
und Oberrheintal bis in die späte Hallstattzeit ungestört weitergehende Fortbildung
urnenselderzeitlicher Gesäßformen (Dehn, Kimmig, Rest) 2», sondern auch die Bei-
behaltung des Gebrauchs der Deckschale in den O und O-Gräbern von Feldkirch.
Wäre es deshalb nicht möglich, daß wir hier in Feldkirch-Hartheim, nachdem be-
reits früher P. Bosch-Gimpera und G. Kraft diese Frage angeschnitten hatten^,
von starkem keltischem Einfluß, wenn nicht von Kelten selbst, als Träger dieser
späten Kultur, sprechen können^?
2b A. Zt. in Arbeit befindl. Freiburger Dissertation.
24 Alt. u. H.Bzt. V, 408; Führer, Stgt. 1908, Tas. VII,15; Gößler, Krach 140 Abb. 5.
2" Bad. Fber. III, 1936, 406 ff.
26 Wagner, H. u. K. 1885, 15 ff. u. Tas. II 6, 7, 6-14. - Wagner, Fst. u. Fd. I,
1908, 20 ff. u. Abb. 13.
2" Wagner I, 59 ff. u. Abb. 39.
2« Rur die hallstattzeitl. Fde. zit.: Bad. Fber. II, 1931, 155, Abb. 61; II, 1932, 372;
13, 1937.
2s Els. Lothr. Iahrb. XV, 1936, 35 ff.
bo W. Dehn, Kat. Kreuznach, Diss. Marburg 1933, noch unveröffentlicht; Trierer
Zeitschr. 9, 1934, 57ff.; Germania 19, 1934, 295ff. — W. Kimmig, s. Anm. 4, 5 u. 25. —
W. Rest, Bad. Fber. III, 1936, 419 u. Anm. 21.
bi Maunus Erg.Bö. VI, 1928, 258 ff.
22 Bon Gemarkung Feldkirch, ohne näheren Fundort, angeblich „aus einer Kiesgrube"
(vielleicht Kiesgrube Speicher?), stammt schließlich noch ein Paar im Iahre 1928 einge-
lieferter LT-Armringe mit Petschaftenden. Unveröffentlicht. Museum Freiburg.