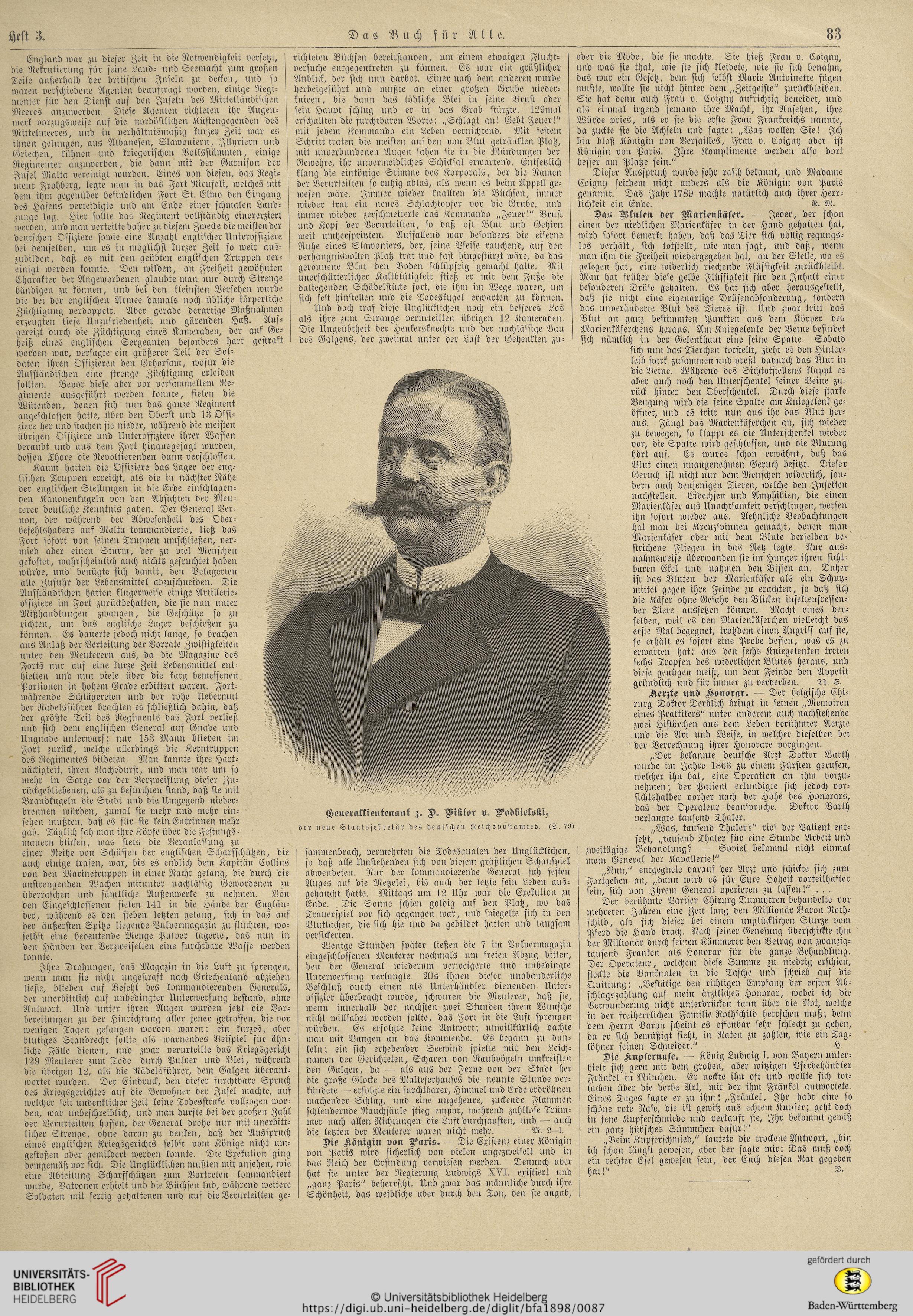Heſt 3.
England war zu dieser Zeit in die Notwendigkeit versett,
die Rekrutierung für seine Land- und Seemacht zum großen
Teile außerhalb der britiſchen Jnseln zu decken, und so
waren verſchiedene Agenten beauftragt worden, einige Regi-
menter für den Dienſt auf den Inseln des Mittelländiſchen
Meeres anzuwerben. Dieſe Agenten richteten ihr Augen-
merk vorzugsweise auf die nordöſtlichen Küſtengegenden des
Mittelmeeres, und in verhältnismäßig kurzer Zeit war es
ihnen gelungen, aus Albanesen, Slawoniern, Illyriern und
Griechen, kühnen und kriegeriſchen Volksſtämmen, einige
Regimenter anzuwerben, die dann mit der Garniſon der
Insel Malta vereinigt wurden. Cines von diesen, das Regi-
ment Frohberg, legte man in das Fort Ricufoli, welches mit
dem ihm gegenüber befindlichen Fort St. Elmo den Eingang
des Hafens verteidigte und am Ende einer ſchmalen Land-
zunge lag. Hier ſollte das Regiment vollständig einexerziert
werden, und man verteilte daher zu diesem Zwecke die meiſten der
deutſchen Offiziere ſowie eine Anzahl engliſcher Unteroffiziere
bei demſelben, um es in möglichſt kurzer Zeit ſo weit aus-
zubilden, daß es mit den geübten engliſchen Truppen ver-
einigt werden konnte. Den wilden, an Freiheit gewöhnten
Charakter der Angeworbenen glaubte man nur durch Strenge
bändigen zu können, und bei den kleinſten Verſehen wurde
die bei der engliſchen Armee damals noch übliche körperliche
Züchtigung verdoppelt. Aber gerade derartige Maßnahmen
erzeugten tiefe Unzufriedenheit und gärenden Haß. Auf-
gereizt durch die Züchtigung eines Kameraden, der auf Ge-
heiß eines englischen Sergeanten besonders hart gestraft
worden war, verſagte ein größerer Teil der Sol-:
daten ihren Offizieren den Gehorsam, wofür die
Aufständiſchen eine strenge Züchtigung erleiden
sollten. Bevor dieſe aber vor verſammeltem Re-
gimente ausgeführt werden konnte, fielen die
Wütenden, denen ſich nun das ganze Regiment
angeſchloſſen hatte, über den Oberſt und 18 Offi-
ziere her und stachen sie nieder, während die meisten
üölbrigen Offiziere und Unteroffiziere ihrer Waffen
beraubt und aus dem Fort hinausgejagt wurden,
deſſen Thore die Revoltierenden dann verſchloſsen.
Kaum hatten die Offiziere das Lager der eng-
liſchen Truppen erreicht, als die in nächſter Nähe
der engliſchen Stellungen in die Erde einſchlagen-
den Kanonenkugeln von den Absichten der Meu-
terer deutliche Kenntnis gaben. Der General Ver-
non, der während der Abwesenheit des Ober-
befehlshabers auf Malta kommandierte, ließ das
Fort sofort von seinen Truppen umſchließen, ver-
mied aber einen Sturm, der zu viel Menſchen
gekoſtet, wahrſcheinlich auch nichts gefruchtet haben
würde, und benügte sich damit, den Belagerten
alle Zufuhr der Lebensmittel abzuſchneiden. Die
Aufständiſchen hatten klugerweise einige Artillerie-
offiziere im Fort zurückbehalten, die ſie nun unter
Mißhandlungen zwangen, die Geſchüte so zu
richten, um das engliſche Lager beschießen zu
können. Es dauerte jedoch nicht lange, so brachen
aus Anlaß der Verteilung der Vorräte Zwistigkeiten
unter den Meuterern aus, da die Magazine des
Forts nur auf eine kurze Zeit Lebensmittel ent- //
hielten und nun viele über die karg bemeſſeeen.
Portionen in hohem Grade erbittert waren. Fort:
währende Schlägereien und der rohe Uebermut
der Rädelsführer brachten es ſchließlich dahin, daß
der größte Teil des Regiments das Fort verließ
und sich dem engliſchen General auf Gnade und
Ungnade unterwarf; nur 153 Mann blieben im
Fort zurück, welche allerdings die Kerntruppen
~ des Regimentes bildeten. Man kannte ihre Hart-
näckigkeit, ihren Rachedurſt, und man war um so
mehr in Sorge vor der Verzweiflung dieser Zu-
rückgebliebenen, als zu befürchten stand, daß ſiemt.
Brandkugeln die Stadt und die Umgegend nieder-
brennen würden, zumal sie mehr und mehr ein-
sehen mußten, daß es für sie kein Entrinnen mehr
gab. Täglich sah man ihre Köpfe über die Feſtunggze
mauern blicken, was ſtets die Veranlaſſung zu
einer Reihe von Schüssen der engliſchen Scharfschützen, die
auch einige trafen, war, bis es endlich dem Kapitän Collins
von den Marinetruppen in einer Nacht gelang, die durch die
anstrengenden Wachen mitunter nachläſſig Gewordenen zu
überraſchen und sämtliche Außenwerke zu nehmen. Von
den Eingeſchloſſenen fielen 141 in die Hände der Englän-
der, während es den sieben letzten gelang, ſich in das auf
der äußersten Spitze liegende Pulvermagazin zu flüchten, wo-
selbſt eine bedeutende Menge Pulver lagerte, das nun in
pet Händen der. Verzweifelten eine furchtbare Waffe werden
onnte. :
Ihre Drohungen, das Magazin in die Luft zu ſprengen,
wenn man ſie nicht ungestraft nach Griechenland abziehen
ließe, blieben auf Befehl des kommandierenden Generals,
der unerbittlich auf unbedingter Unterwerfung bestand, ohne
Antwort. Und unter ihren Augen wurden jett die Vor-
bereitungen zu der Hinrichtung aller jener getroffen, die vor
wenigen Tagen gefangen worden waren: ein kurzes, aber
blutiges Standrecht sollte als warnendes Beiſpiel für ähn-
liche Fälle dienen, und zwar verurteilte das Kriegsgericht
129 Meuterer zum Tode durch Pulver und Blei, während
die übrigen 12, als die Rädelsführer, dem Galgen überant-
wortet wurden. Der Eindruck, den dieser furchtbare Spruch
des Kriegsgerichtes auf die Bewohner der Inſel machte, auf
welcher seit undenklicher Zeit keine Todesstrafe vollzogen wor-
den, war unbeschreiblich, und man durfte bei der großen Zahl
der Verurteilten hoffen, der General drohe nur mit unerbitt-
licher Strenge, ohne daran zu denken, daß der Ausspruch
eines engliſchen Kriegsgerichts selbſt vom Könige nicht um-
geſtoßen oder gemildert werden konnte. Die Exekution ging
demgemäß vor ſich. Die Unglücklichen mußten mit ansehen, wie
eine Abteilung Scharfschüten zum Vortreten kommandiert
wurde, Patronen erhielt und die Büchſen lud, während weitere
Soldaten mit fertig gehaltenen und auf die Verurteilten ge-
D as B u < f ür Alle.
richteten Büchſen bereitsſtanden, um einem etwaigen Flucht-
verſuche entgegentreten zu können. Es war ein gräßlicher
Anblick, der sich nun darbot. Einer nach dem anderen wurde
herbeigeführt und mußte an einer großen Grube nieder-
knieen, bis dann das tödliche Blei in seine Bruſt oder
sein Haupt ſchlug und er in das Grab ſtürzte. 129mal
ersſchallten die furchtbaren Worte: „Schlagt an! Gebt Feuer!"
mit jedem Kommando ein Leben vernichtend. Mit festem
Schritt traten die meiſten auf den von Blut getränkten Play,
mit unverbundenen Augen sahen sie in die Mündungen der
Gewehre, ihr unvermeidliches Schickſal erwartend. Entsetlich
klang die eintönige Stimme des Korporals, der die Namen
der Verurteilten so ruhig ablas, als wenn es beim Appell ge-
wesen wäre. Immer wieder knallten die Büchſen, immer
wieder trat ein neues Schlachtopfer vor die Grube, und
immer wieder zerſchmetterte das Kommando ,„JFeuer!" Bruſt
und Kopf der Verurteilten, ſo daß oft Blut und Gehirn
weit umherſpritkten. Auffallend war besonders die eiſerne
Ruhe eines Slawoniers, der, ſeine Pfeife rauchend, auf den
verhängnisvollen Platz trat und fast hingeſstürzt wäre, da das
geronnene Blut den Boden ſchlüpfrig gemacht hatte. Mit
unerſchütterlicher Kaltblütigkeit stieß er mit dem Juße die
daliegenden Schädelstücke fort, die ihm im Wege waren, um
ſich feſt hinstellen und die Todeskugel erwarten zu können.
Und doch traf dieſe Unglücklichen noch ein besseres Los
als ihre zum Strange verurteilten übrigen 12 Kameraden.
Die Ungeùübtheit der Henkersknechte und der nachlässige Bau
des Galgens, der zweimal unter der Laſt der Gehenkten zu-
Generallieutenant z. D. Viktor v. Dodbielski,
_ der neue Staatsſekretär des deutſchen Reichspoſtamtes. (S. 79)
sammenbrach, vermehrten die Todesqualen der Unglütcklichen,
so daß alle Umſtehenden ſich von dieſem gräßlichen Schauſpiel
abwendeten. Nur der kommandierende General ſah festen
Auges auf die Meyelei, bis auch der letzte ſein Leben aus-
gehaucht hatte. Mittags um 12 Uhr war die Exekution zu
Ende. . Die Sonne ſchien goldig auf den Platz, wo das
Trauerspiel vor ſich gegangen war, und ſpiegelte ſich in den
Blutlachen, die sich hie und da gebildet hatten und langsam
versickerten.
Wenige Stunden später ließen die 7 im Pulvermagazin
eingeſchloſsſsenen Meuterer nochmals um freien Abzug bitten,
den der General wiederum verweigerte und unbedingte
Unterwerfung verlangte Als ihnen dieser unabänderliche
Beschluß durch einen als Unterhändler dienenden Unter-
offizier überbracht wurde, ſchwuren die Meuterer, daß ſie,
wenn innerhalb der nächsten zwei Stunden ihrem Wunſche
nicht willfahrt werden sollte, das Fort in die Luft ſprengen
würden. Es erfolgte keine Antwort; unwillkürlich dachte
man mit Bangen an das Kommende. Es begann zu dun-
keln; ein sich erhebender Seewind spielte mit den Leich:
namen der Gerichteten, Scharen von Raubvögeln umtkreiſten
den Galgen, da + als aus der Ferne von der Stadt her
die große Glocke des Malteſerhauſes die neunte Stunde ver-
kündete - erfolgte ein furchtbarer, Himmel und Erde erdröhnen
machender Schlag, und eine ungeheure, zuckende Flammen
schleudernde Rauchsäule stieg empor, während zahlloſe Trüm-
mer nach allen Richtungen die Luft durchſauſten, und ~ auch
die letzten der Meuterer waren nicht mehr. M. L-.
Die Königin von Haris. - Die Exiſtenz einer Königin
von Paris wird ſicherlich von vielen angezweifelt und in
das Reich der Erfindung verwieſen werden. Dennoch aber
hat sie unter der Regierung Ludwigs XVI. existiert und
„ganz Paris“ beherrſcht. Und zwar das männliche durch ihre
Schönheit, das weibliche aber durch den Ton, den ſie angab,
g3
oder die Mode, die ſie machte. Sie hieß Frau v. Coigny,
und was ſie that, wie ſie ſich kleidete, wie sie ſich benahm,
das war ein Gesetß, dem ſich ſelbſt Marie Antoinette fügen
mußte, wollte sie nicht hinter dem ,„Zeitgeiſte" zurückbleiben.
Sie hat denn auch Frau v. Coigny aufrichtig beneidet, und
als einmal irgend jemand ihre Macht, ihr Ansehen, ihre
Würde pries, als er sie die erſte Frau Frankreichs nannte,
da zuckte ſie die Achſeln und sagte: „Was wollen Sie! Ich
bin bloß Königin von Versailles, Frau v. Coigny aber iſt
Königin von Paris. Ihre Komplimente werden also dort
beſſer am Plate ſein." ;
Dieser Ausspruch wurde ſehr raſch bekannt, und Madame
Coigny seitdem nicht anders als die Königin von Paris
genannt. Das Jahr 1789 machte natürlich auch ihrer Herr
lichkeit ein Ende. R. M.
Das BYBlulen der Marienkäfer. + Jeder, der ſchon
einen der niedlichen Marienkäfer in der Hand gehalten hat,
wird sofort bemerkt haben, daß das Tier sich völlig regungs-
los verhält, sich totſtellt, wie man sagt, und daß, wenn
man ihm die Freiheit wiedergegeben hat, an der Stelle, wo es
gelegen hat, eine widerlich riechende Flüssigkeit zurückbleibl.
Man hat früher diese gelbe Flüssigkeit für den Inhalt einer
beſonderen Drüſe gehalten. Es hat sich aber herausgestellt,
daß sie nicht eine eigenartige Drüſenabſonderung, sondern
das unveränderte Blut des Tieres iſt. Und zwar lritt das
Blut an ganz bestimmten Punkten aus dem Körper des
Marienkäferchens heraus. Am Kniegelenke der Beine befindet
ſich nämlich in der Gelenkhaut eine feine Spalte. Sobald
ſich nun das Tierchen totſtellt, zieht es den Hinter-
leib stark zuſammen und preßt dadurch das Blut in
die Beine. Während des Sichtotſtellens klappt es
aber auch noch den Unterschenkel seiner Beine zu-
rück hinter den Oberschenkel. Durch diese ſtarke
Beugung wird die feine Spalte am Kniegelenk ge-
öffnet, und es tritt nun aus ihr das Blut her-
aus. Fängt das Marienkäferchen an, ſich wieder
zu bewegen, so klappt es die Unterſchenkel wieder
vor, die Spalte wird gesſchloſſen, und die Blutung
hört auf. Es wurde ſchon erwähnt, daß das
Blut einen unangenehmen Geruch besitzt. Dieser
Geruch ist nicht nur dem Menſchen widerlich, ſon-
dern auch denjenigen Tieren, welche den JInſekten
nachſstellen. Eidechſen und Amphibien, die einen
Marienkäfer aus Unachtſamkeit verſchlingen, werfen
ihn sofort wieder aus. Aehnliche Beobachtungen
hat man bei Kreuzſpinnen gemacht, denen man
Marienkäfer oder mit dem Blute derselben be-
strichene Fliegen in das Net, legte. Nur aus-
nahmsweise überwanden sie im Hunger ihren ſicht-
baren Ekel und nahmen den Biſſen an. Daher
iſt das Bluten der Marienkäfer als ein Schut-
mittel gegen ihre Feinde zu erachten, so daß ſich
die Käfer ohne Gefahr den Blicken insektenfressen-
der Tiere aussſegzen können. Macht eines der-
selben, weil es den Marienkäferchen vielleicht das
erſte Mal begegnet, troßdem einen Angriff auf sie,
so erhält es sofort eine Probe desſſen, was es zu
erwarten hat: aus den ſechs Kniegelenken treten
sechs Tropfen des widerlichen Blutes heraus, und
dieſe genügen meist, um dem Feinde den Appetit
gründlich und für immer zu verderben. Th. S.
Aerzte und Honorar. + Der belgiſche Chi-
rurg Doktor Derblich bringt in seinen „Memoiren
eines Praktikers“" unter anderem auch nachſtehende
lt H t t Ut ts
' der Verrechnung ihrer Honorare vorgingen. j
„Der bekannte deutſche Arzt Doktor Barth
wurde im Jahre 1868 zu einem Fürſten gerufen,
welcher ihn bat, eine Operation an ihm vorzu-
nehmen; der Patient erkundigle ſich jedoch vor-
ſichtshalber vorher nach der Höhe des Honorars,
das der Operateur beanspruche. Doktor Barth
verlangte tauſend Thaler. ;
„Was, tauſend Thaler?" rief der Patient ent-
setzt, „tauſend Thaler für eine Stunde Arbeit und
zweitägige Behandlung? + Soviel bekommt nicht einmal
mein General der Kavallerie!"
„Nun," entgegnete darauf der Arzt und ſchickte ſich zum
Fortgehen an, „dann wird es für Eure Hoheit vorteilhafter
sein, ſich von Ihrem General operieren zu lassen!“ ...
Der berühmte Pariſer Chirurg Dupuytren behandelte vor
mehreren Jahren eine Zeit lang den Millionär Baron Roth-
schild, als ſich dieſer bei einem unglücklichen Sturze vom
Pferd die Hand brach. Nach seiner Geneſung überſchickte im
der Millionär durch seinen Kämmerer den Betrag von zwanzig-
tauſend Franken als Honorar für die ganze Behandlung.
Der Operateur, welchem dieſe Summe zu niedrig erſchieen.
steckte die Banknoten in die Taſche und ſchrieb auf die
Quittung: „Bestätige den richtigen Empfang der ersten Ab-
ſchlagszahlung auf mein ärztliches Honorar, wobei ich die
Verwunderung nicht unlerdrücken kann über die Not, welche
in der freiherrlichen Familie Rothſchild herrschen muß; denn
dem Herrn Baron ſcheint es offenbar sehr ſchlecht zu gehen,
da er sich bemüßigt sieht, in Raten zu zahlen, wie ein Tag-
löhner seinen Schneider." H.
Die Kupfernaſe. + König Ludwig I. von Bayern unter-
hielt sich gern mit dem groben, aber witzigen Pferdehändler
Fränkel in München. Er neckte ihn oft und wollte sich tot-
lachen über die derbe Art, mit der ihm Fränkel antwortete.
Eines Tages ſagte er zu ihm: „Fränkel, Ihr habt eine ſo
schöne rote Nase, die iſt gewiß aus echtem Kupfer; geht doch
in jene Kupferſchmiede und verkauft ſie, Ihr bekommt gewiß
ein ganz hübſches Sümmdchen dafür!“
„Beim Kupferſchmied,“" lautete die trockene Antwort, ,bin
ich ſchon längst geweſen, aber der sagte mir: Das muß doch
ein rechter Eſel gewesen sein, der Euch dieſen Rat gegeben
hat !“ “ D,
England war zu dieser Zeit in die Notwendigkeit versett,
die Rekrutierung für seine Land- und Seemacht zum großen
Teile außerhalb der britiſchen Jnseln zu decken, und so
waren verſchiedene Agenten beauftragt worden, einige Regi-
menter für den Dienſt auf den Inseln des Mittelländiſchen
Meeres anzuwerben. Dieſe Agenten richteten ihr Augen-
merk vorzugsweise auf die nordöſtlichen Küſtengegenden des
Mittelmeeres, und in verhältnismäßig kurzer Zeit war es
ihnen gelungen, aus Albanesen, Slawoniern, Illyriern und
Griechen, kühnen und kriegeriſchen Volksſtämmen, einige
Regimenter anzuwerben, die dann mit der Garniſon der
Insel Malta vereinigt wurden. Cines von diesen, das Regi-
ment Frohberg, legte man in das Fort Ricufoli, welches mit
dem ihm gegenüber befindlichen Fort St. Elmo den Eingang
des Hafens verteidigte und am Ende einer ſchmalen Land-
zunge lag. Hier ſollte das Regiment vollständig einexerziert
werden, und man verteilte daher zu diesem Zwecke die meiſten der
deutſchen Offiziere ſowie eine Anzahl engliſcher Unteroffiziere
bei demſelben, um es in möglichſt kurzer Zeit ſo weit aus-
zubilden, daß es mit den geübten engliſchen Truppen ver-
einigt werden konnte. Den wilden, an Freiheit gewöhnten
Charakter der Angeworbenen glaubte man nur durch Strenge
bändigen zu können, und bei den kleinſten Verſehen wurde
die bei der engliſchen Armee damals noch übliche körperliche
Züchtigung verdoppelt. Aber gerade derartige Maßnahmen
erzeugten tiefe Unzufriedenheit und gärenden Haß. Auf-
gereizt durch die Züchtigung eines Kameraden, der auf Ge-
heiß eines englischen Sergeanten besonders hart gestraft
worden war, verſagte ein größerer Teil der Sol-:
daten ihren Offizieren den Gehorsam, wofür die
Aufständiſchen eine strenge Züchtigung erleiden
sollten. Bevor dieſe aber vor verſammeltem Re-
gimente ausgeführt werden konnte, fielen die
Wütenden, denen ſich nun das ganze Regiment
angeſchloſſen hatte, über den Oberſt und 18 Offi-
ziere her und stachen sie nieder, während die meisten
üölbrigen Offiziere und Unteroffiziere ihrer Waffen
beraubt und aus dem Fort hinausgejagt wurden,
deſſen Thore die Revoltierenden dann verſchloſsen.
Kaum hatten die Offiziere das Lager der eng-
liſchen Truppen erreicht, als die in nächſter Nähe
der engliſchen Stellungen in die Erde einſchlagen-
den Kanonenkugeln von den Absichten der Meu-
terer deutliche Kenntnis gaben. Der General Ver-
non, der während der Abwesenheit des Ober-
befehlshabers auf Malta kommandierte, ließ das
Fort sofort von seinen Truppen umſchließen, ver-
mied aber einen Sturm, der zu viel Menſchen
gekoſtet, wahrſcheinlich auch nichts gefruchtet haben
würde, und benügte sich damit, den Belagerten
alle Zufuhr der Lebensmittel abzuſchneiden. Die
Aufständiſchen hatten klugerweise einige Artillerie-
offiziere im Fort zurückbehalten, die ſie nun unter
Mißhandlungen zwangen, die Geſchüte so zu
richten, um das engliſche Lager beschießen zu
können. Es dauerte jedoch nicht lange, so brachen
aus Anlaß der Verteilung der Vorräte Zwistigkeiten
unter den Meuterern aus, da die Magazine des
Forts nur auf eine kurze Zeit Lebensmittel ent- //
hielten und nun viele über die karg bemeſſeeen.
Portionen in hohem Grade erbittert waren. Fort:
währende Schlägereien und der rohe Uebermut
der Rädelsführer brachten es ſchließlich dahin, daß
der größte Teil des Regiments das Fort verließ
und sich dem engliſchen General auf Gnade und
Ungnade unterwarf; nur 153 Mann blieben im
Fort zurück, welche allerdings die Kerntruppen
~ des Regimentes bildeten. Man kannte ihre Hart-
näckigkeit, ihren Rachedurſt, und man war um so
mehr in Sorge vor der Verzweiflung dieser Zu-
rückgebliebenen, als zu befürchten stand, daß ſiemt.
Brandkugeln die Stadt und die Umgegend nieder-
brennen würden, zumal sie mehr und mehr ein-
sehen mußten, daß es für sie kein Entrinnen mehr
gab. Täglich sah man ihre Köpfe über die Feſtunggze
mauern blicken, was ſtets die Veranlaſſung zu
einer Reihe von Schüssen der engliſchen Scharfschützen, die
auch einige trafen, war, bis es endlich dem Kapitän Collins
von den Marinetruppen in einer Nacht gelang, die durch die
anstrengenden Wachen mitunter nachläſſig Gewordenen zu
überraſchen und sämtliche Außenwerke zu nehmen. Von
den Eingeſchloſſenen fielen 141 in die Hände der Englän-
der, während es den sieben letzten gelang, ſich in das auf
der äußersten Spitze liegende Pulvermagazin zu flüchten, wo-
selbſt eine bedeutende Menge Pulver lagerte, das nun in
pet Händen der. Verzweifelten eine furchtbare Waffe werden
onnte. :
Ihre Drohungen, das Magazin in die Luft zu ſprengen,
wenn man ſie nicht ungestraft nach Griechenland abziehen
ließe, blieben auf Befehl des kommandierenden Generals,
der unerbittlich auf unbedingter Unterwerfung bestand, ohne
Antwort. Und unter ihren Augen wurden jett die Vor-
bereitungen zu der Hinrichtung aller jener getroffen, die vor
wenigen Tagen gefangen worden waren: ein kurzes, aber
blutiges Standrecht sollte als warnendes Beiſpiel für ähn-
liche Fälle dienen, und zwar verurteilte das Kriegsgericht
129 Meuterer zum Tode durch Pulver und Blei, während
die übrigen 12, als die Rädelsführer, dem Galgen überant-
wortet wurden. Der Eindruck, den dieser furchtbare Spruch
des Kriegsgerichtes auf die Bewohner der Inſel machte, auf
welcher seit undenklicher Zeit keine Todesstrafe vollzogen wor-
den, war unbeschreiblich, und man durfte bei der großen Zahl
der Verurteilten hoffen, der General drohe nur mit unerbitt-
licher Strenge, ohne daran zu denken, daß der Ausspruch
eines engliſchen Kriegsgerichts selbſt vom Könige nicht um-
geſtoßen oder gemildert werden konnte. Die Exekution ging
demgemäß vor ſich. Die Unglücklichen mußten mit ansehen, wie
eine Abteilung Scharfschüten zum Vortreten kommandiert
wurde, Patronen erhielt und die Büchſen lud, während weitere
Soldaten mit fertig gehaltenen und auf die Verurteilten ge-
D as B u < f ür Alle.
richteten Büchſen bereitsſtanden, um einem etwaigen Flucht-
verſuche entgegentreten zu können. Es war ein gräßlicher
Anblick, der sich nun darbot. Einer nach dem anderen wurde
herbeigeführt und mußte an einer großen Grube nieder-
knieen, bis dann das tödliche Blei in seine Bruſt oder
sein Haupt ſchlug und er in das Grab ſtürzte. 129mal
ersſchallten die furchtbaren Worte: „Schlagt an! Gebt Feuer!"
mit jedem Kommando ein Leben vernichtend. Mit festem
Schritt traten die meiſten auf den von Blut getränkten Play,
mit unverbundenen Augen sahen sie in die Mündungen der
Gewehre, ihr unvermeidliches Schickſal erwartend. Entsetlich
klang die eintönige Stimme des Korporals, der die Namen
der Verurteilten so ruhig ablas, als wenn es beim Appell ge-
wesen wäre. Immer wieder knallten die Büchſen, immer
wieder trat ein neues Schlachtopfer vor die Grube, und
immer wieder zerſchmetterte das Kommando ,„JFeuer!" Bruſt
und Kopf der Verurteilten, ſo daß oft Blut und Gehirn
weit umherſpritkten. Auffallend war besonders die eiſerne
Ruhe eines Slawoniers, der, ſeine Pfeife rauchend, auf den
verhängnisvollen Platz trat und fast hingeſstürzt wäre, da das
geronnene Blut den Boden ſchlüpfrig gemacht hatte. Mit
unerſchütterlicher Kaltblütigkeit stieß er mit dem Juße die
daliegenden Schädelstücke fort, die ihm im Wege waren, um
ſich feſt hinstellen und die Todeskugel erwarten zu können.
Und doch traf dieſe Unglücklichen noch ein besseres Los
als ihre zum Strange verurteilten übrigen 12 Kameraden.
Die Ungeùübtheit der Henkersknechte und der nachlässige Bau
des Galgens, der zweimal unter der Laſt der Gehenkten zu-
Generallieutenant z. D. Viktor v. Dodbielski,
_ der neue Staatsſekretär des deutſchen Reichspoſtamtes. (S. 79)
sammenbrach, vermehrten die Todesqualen der Unglütcklichen,
so daß alle Umſtehenden ſich von dieſem gräßlichen Schauſpiel
abwendeten. Nur der kommandierende General ſah festen
Auges auf die Meyelei, bis auch der letzte ſein Leben aus-
gehaucht hatte. Mittags um 12 Uhr war die Exekution zu
Ende. . Die Sonne ſchien goldig auf den Platz, wo das
Trauerspiel vor ſich gegangen war, und ſpiegelte ſich in den
Blutlachen, die sich hie und da gebildet hatten und langsam
versickerten.
Wenige Stunden später ließen die 7 im Pulvermagazin
eingeſchloſsſsenen Meuterer nochmals um freien Abzug bitten,
den der General wiederum verweigerte und unbedingte
Unterwerfung verlangte Als ihnen dieser unabänderliche
Beschluß durch einen als Unterhändler dienenden Unter-
offizier überbracht wurde, ſchwuren die Meuterer, daß ſie,
wenn innerhalb der nächsten zwei Stunden ihrem Wunſche
nicht willfahrt werden sollte, das Fort in die Luft ſprengen
würden. Es erfolgte keine Antwort; unwillkürlich dachte
man mit Bangen an das Kommende. Es begann zu dun-
keln; ein sich erhebender Seewind spielte mit den Leich:
namen der Gerichteten, Scharen von Raubvögeln umtkreiſten
den Galgen, da + als aus der Ferne von der Stadt her
die große Glocke des Malteſerhauſes die neunte Stunde ver-
kündete - erfolgte ein furchtbarer, Himmel und Erde erdröhnen
machender Schlag, und eine ungeheure, zuckende Flammen
schleudernde Rauchsäule stieg empor, während zahlloſe Trüm-
mer nach allen Richtungen die Luft durchſauſten, und ~ auch
die letzten der Meuterer waren nicht mehr. M. L-.
Die Königin von Haris. - Die Exiſtenz einer Königin
von Paris wird ſicherlich von vielen angezweifelt und in
das Reich der Erfindung verwieſen werden. Dennoch aber
hat sie unter der Regierung Ludwigs XVI. existiert und
„ganz Paris“ beherrſcht. Und zwar das männliche durch ihre
Schönheit, das weibliche aber durch den Ton, den ſie angab,
g3
oder die Mode, die ſie machte. Sie hieß Frau v. Coigny,
und was ſie that, wie ſie ſich kleidete, wie sie ſich benahm,
das war ein Gesetß, dem ſich ſelbſt Marie Antoinette fügen
mußte, wollte sie nicht hinter dem ,„Zeitgeiſte" zurückbleiben.
Sie hat denn auch Frau v. Coigny aufrichtig beneidet, und
als einmal irgend jemand ihre Macht, ihr Ansehen, ihre
Würde pries, als er sie die erſte Frau Frankreichs nannte,
da zuckte ſie die Achſeln und sagte: „Was wollen Sie! Ich
bin bloß Königin von Versailles, Frau v. Coigny aber iſt
Königin von Paris. Ihre Komplimente werden also dort
beſſer am Plate ſein." ;
Dieser Ausspruch wurde ſehr raſch bekannt, und Madame
Coigny seitdem nicht anders als die Königin von Paris
genannt. Das Jahr 1789 machte natürlich auch ihrer Herr
lichkeit ein Ende. R. M.
Das BYBlulen der Marienkäfer. + Jeder, der ſchon
einen der niedlichen Marienkäfer in der Hand gehalten hat,
wird sofort bemerkt haben, daß das Tier sich völlig regungs-
los verhält, sich totſtellt, wie man sagt, und daß, wenn
man ihm die Freiheit wiedergegeben hat, an der Stelle, wo es
gelegen hat, eine widerlich riechende Flüssigkeit zurückbleibl.
Man hat früher diese gelbe Flüssigkeit für den Inhalt einer
beſonderen Drüſe gehalten. Es hat sich aber herausgestellt,
daß sie nicht eine eigenartige Drüſenabſonderung, sondern
das unveränderte Blut des Tieres iſt. Und zwar lritt das
Blut an ganz bestimmten Punkten aus dem Körper des
Marienkäferchens heraus. Am Kniegelenke der Beine befindet
ſich nämlich in der Gelenkhaut eine feine Spalte. Sobald
ſich nun das Tierchen totſtellt, zieht es den Hinter-
leib stark zuſammen und preßt dadurch das Blut in
die Beine. Während des Sichtotſtellens klappt es
aber auch noch den Unterschenkel seiner Beine zu-
rück hinter den Oberschenkel. Durch diese ſtarke
Beugung wird die feine Spalte am Kniegelenk ge-
öffnet, und es tritt nun aus ihr das Blut her-
aus. Fängt das Marienkäferchen an, ſich wieder
zu bewegen, so klappt es die Unterſchenkel wieder
vor, die Spalte wird gesſchloſſen, und die Blutung
hört auf. Es wurde ſchon erwähnt, daß das
Blut einen unangenehmen Geruch besitzt. Dieser
Geruch ist nicht nur dem Menſchen widerlich, ſon-
dern auch denjenigen Tieren, welche den JInſekten
nachſstellen. Eidechſen und Amphibien, die einen
Marienkäfer aus Unachtſamkeit verſchlingen, werfen
ihn sofort wieder aus. Aehnliche Beobachtungen
hat man bei Kreuzſpinnen gemacht, denen man
Marienkäfer oder mit dem Blute derselben be-
strichene Fliegen in das Net, legte. Nur aus-
nahmsweise überwanden sie im Hunger ihren ſicht-
baren Ekel und nahmen den Biſſen an. Daher
iſt das Bluten der Marienkäfer als ein Schut-
mittel gegen ihre Feinde zu erachten, so daß ſich
die Käfer ohne Gefahr den Blicken insektenfressen-
der Tiere aussſegzen können. Macht eines der-
selben, weil es den Marienkäferchen vielleicht das
erſte Mal begegnet, troßdem einen Angriff auf sie,
so erhält es sofort eine Probe desſſen, was es zu
erwarten hat: aus den ſechs Kniegelenken treten
sechs Tropfen des widerlichen Blutes heraus, und
dieſe genügen meist, um dem Feinde den Appetit
gründlich und für immer zu verderben. Th. S.
Aerzte und Honorar. + Der belgiſche Chi-
rurg Doktor Derblich bringt in seinen „Memoiren
eines Praktikers“" unter anderem auch nachſtehende
lt H t t Ut ts
' der Verrechnung ihrer Honorare vorgingen. j
„Der bekannte deutſche Arzt Doktor Barth
wurde im Jahre 1868 zu einem Fürſten gerufen,
welcher ihn bat, eine Operation an ihm vorzu-
nehmen; der Patient erkundigle ſich jedoch vor-
ſichtshalber vorher nach der Höhe des Honorars,
das der Operateur beanspruche. Doktor Barth
verlangte tauſend Thaler. ;
„Was, tauſend Thaler?" rief der Patient ent-
setzt, „tauſend Thaler für eine Stunde Arbeit und
zweitägige Behandlung? + Soviel bekommt nicht einmal
mein General der Kavallerie!"
„Nun," entgegnete darauf der Arzt und ſchickte ſich zum
Fortgehen an, „dann wird es für Eure Hoheit vorteilhafter
sein, ſich von Ihrem General operieren zu lassen!“ ...
Der berühmte Pariſer Chirurg Dupuytren behandelte vor
mehreren Jahren eine Zeit lang den Millionär Baron Roth-
schild, als ſich dieſer bei einem unglücklichen Sturze vom
Pferd die Hand brach. Nach seiner Geneſung überſchickte im
der Millionär durch seinen Kämmerer den Betrag von zwanzig-
tauſend Franken als Honorar für die ganze Behandlung.
Der Operateur, welchem dieſe Summe zu niedrig erſchieen.
steckte die Banknoten in die Taſche und ſchrieb auf die
Quittung: „Bestätige den richtigen Empfang der ersten Ab-
ſchlagszahlung auf mein ärztliches Honorar, wobei ich die
Verwunderung nicht unlerdrücken kann über die Not, welche
in der freiherrlichen Familie Rothſchild herrschen muß; denn
dem Herrn Baron ſcheint es offenbar sehr ſchlecht zu gehen,
da er sich bemüßigt sieht, in Raten zu zahlen, wie ein Tag-
löhner seinen Schneider." H.
Die Kupfernaſe. + König Ludwig I. von Bayern unter-
hielt sich gern mit dem groben, aber witzigen Pferdehändler
Fränkel in München. Er neckte ihn oft und wollte sich tot-
lachen über die derbe Art, mit der ihm Fränkel antwortete.
Eines Tages ſagte er zu ihm: „Fränkel, Ihr habt eine ſo
schöne rote Nase, die iſt gewiß aus echtem Kupfer; geht doch
in jene Kupferſchmiede und verkauft ſie, Ihr bekommt gewiß
ein ganz hübſches Sümmdchen dafür!“
„Beim Kupferſchmied,“" lautete die trockene Antwort, ,bin
ich ſchon längst geweſen, aber der sagte mir: Das muß doch
ein rechter Eſel gewesen sein, der Euch dieſen Rat gegeben
hat !“ “ D,