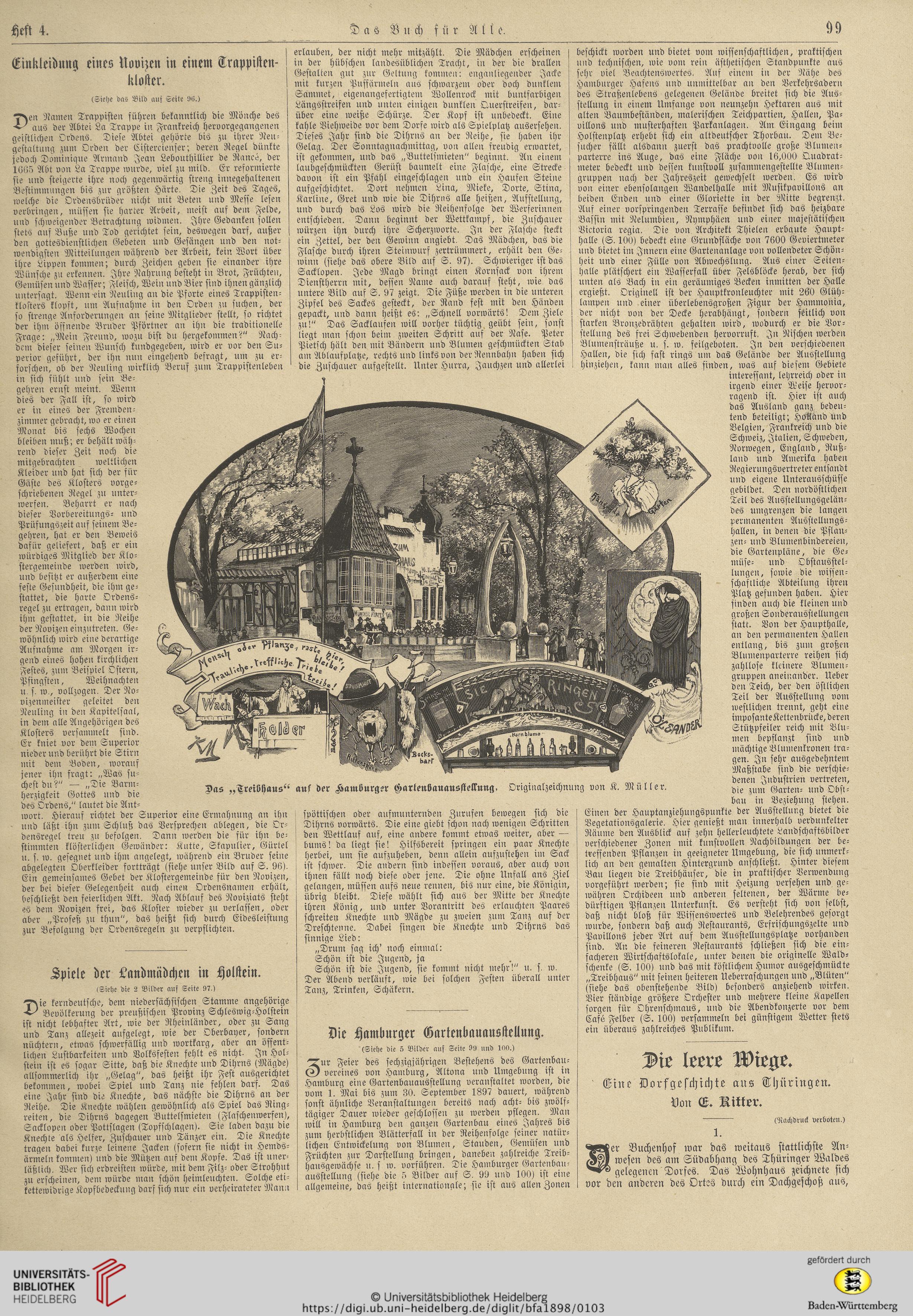Heft 4.
kloſter.
(Siehe das Bild auf Seite 96.)
en Namen Trappiſten führen bekanntlich die Mönche des
aus der Abtei La Trappe in Frankreich hervorgegangenen
geiſtlichen Ordens. Diese Abtei gehörte bis zu ihrer Neu-
gestaltung zum Orden der Ciſtercienſer; deren Regel dünkte
jedoch Dominique Armand Jean Lebouthillier de Rancé, der
1665 Abt von La Trappe wurde, viel zu mild. Er reformierte
sie und steigerte ihre noch gegenwärtig streng innegehaltenen
Bestimmungen bis zur größten Härte. Die Zeit des Tages,
welche die Ordensbrüder nicht mit Beten und Messe lesen
verbringen, müſsen sie harter Arbeit, meiſt auf dem Felde,
und ſchweigender Betrachtung widmen. Ihre Gedanken sollen
stets auf Buße und Tod gerichtet sein, deswegen darf, außer
den gottesdienstlichen Gebeten und Gesängen und den not-
wendigsten Mitteilungen während der Arbeit, kein Wort über
ihre Lippen kommen; durch Zeichen geben sie einander ihre
Wünſche zu erkennen. Ihre Nahrung besteht in Brot, Früchten,
Gemüsen und Wasser; Fleiſch, Wein und Bier ſind ihnen gänzlich
untersagt. Wenn ein Neuling an die Pforte eines Trappiſten-
kloſters klopft, um Aufnahme in den Orden zu ſuchen, der
ſo strenge Anforderungen an ſeine Mitglieder stellt, so richtet
der ihm öffnende Bruder Pförtner an ihn die traditionelle
Frage: „Mein Freund, wozu bist du hergekommen?!" Nach-
dem dieser seinen Wunſch kundgegeben, wird er vor den Su-
perior geführt, der ihn nun eingehend befragt, um zu er-
forſchen, ob der Neuling wirklich Beruf zum Trappiſtenleben
in sich fühlt und sein Be-
. gehren ernſt meint. Wenn
dies der Fall iſt, so wird
er in eines der Fremden-
zimmer gebracht, wo er inen
Monat bis sechs Wochen
bleiben muß; er behält wähe
rend dieser Zeit noch die
mitgebrachten. weltlichen
Kleider und hat ſich der für
Güſte des Klosters vorge-
ſchriebenen Regel zu unter-
werfen. Beharrt er nach
dieſer Vorbereitungs- und
Prüfungszeit auf seinem Be-
gehren, hat er den Beweis
dafür geliefert, daß er ein
würdiges Mitglied der Klo-
stergemeinde werden wird,
und besitzt er außerdem eine
feſte Geſundheit, die ihm ge-
ſtattet, die harte Ordens-
regel zu ertragen, dann wird
ihm gestattet, in die Reihe
der Novizen einzutreten. Ge-
wöhnlich wird eine derartige
Aufnahme am Morgen ir-
gend eines hohen kirchlichen
Festes, zum Beiſpiel Ostern,
Pfingsten, Weihnachten
u. s. w., vollzogen. Der No-
vizenmeiſter geleitet den
Neuling in den Kapitelsaal,
in dem alle Angehörigen des
Klosters versammelt ſsind.
Er kniet vor dem Superior
nieder und berührt die Stirn
mit dem Boden, worauf
jener ihn fragt: „Was ſu-
cheſt du ?’ — „Die Barm-
herzigkeit Gottes und die
des Ordens,“ lautet die Ant-
wort. Hierauf richtet der Superior eine Ermahnung an ihn
- und läßt ihn zum Schluß das Versprechen ablegen, die Or-
densregel treu zu befolgen. Dann werden die für ihn be:
stimmten klösterlichen Gewänder: Kutte, Skapulier, Gürtel
u. s. w. gesegnet und ihm angelegt, während ein Bruder seine
abgelegten Oberkleider fortträgt (siehe unser Bild auf S. 96).
Ein gemeinsames Gebet der Kloſtergemeinde für den Novizen,
der bei dieſer Gelegenheit auch einen Ordensnamen erhält,
beschließt den feierlichen Akt. Nach Ablauf des Noviziats steht
es dem Novizen frei, das Kloster wieder zu verlassen, oder
aber ,„Profeß zu thun“, das heißt sich durch Eidesleiſtung
zur Befolgung der Ordensregeln zu verpflichten.
Spiele der Landmädchen in Holltein.
(Siehe die 2 Bilder auf Seite 97.)
D'! kerndeutsche, dem niedersächſiſchen Stamme angehörige
Bevölkerung der preußiſchen Provinz Schleswig-Holstein
iſt nicht lebhafter Art, wie der Rheinländer, oder zu Sang
und Tanz allezeit aufgelegt, wie der Oberbayer, sondern
nüchtern, etwas schwerfällig und wortkarg, aber an öffent-
lichen Luſtbarkeiten und Volksfesten fehlt es nicht. Jn Hol-
stein iſt es ſogar Sitte, daß die Knechte und Dihrns (Mägde)
allſommerlich ihr „Gelag", das heißt ihr Fest ausgerichtet
bekommen, wobei Spiel und Tanz nie fehlen darf. Das
eine Jahr sind die Knechte, das nächste die Dihrns an der
Reihe. Die Knechte wählen gewöhnlich als Spiel das Ring-
reiten, die Dihrns dagegen Buttelſmieten (Flaſchenwerfen),
Satcklopen oder Pottsſlagen (Topfschlagen). Sie laden dazu die
Knechte als Helfer, Zuſchauer und Tänzer ein. Die Knechte
tragen dabei kurze leinene Jacken (sofern sie nicht in Hemds-
ärmeln kommen) und die Mützen auf dem Kopfe. Das ist uner-
läßlich. Wer sich erdreiſten würde, mit dem Filz- oder Strohhut
zu erscheinen, dem würde man ſchön heimleuchten. Solche eti-
kettewidrige Kopfbedeckung darf ſich nur ein verheirateter Mann
Das Buch für Alle.
: . . .: .. {, . | erlauben, der nicht mehr mitzählt. Die Mädchen erscheinen
Einkleidung eines Novizen in einem Trappiſten-
in der hübſchen landesüblichen Tracht, in der die drallen
Gestalten gut zur Geltung kommen: enganliegender Jacke
mit kurzen Puffärmeln aus schwarzem oder doch dunklem
Sammet, eigenangefertigtem Wollenrock mit buntfarbigen
Längsstreifen und unten einigen dunklen Querstreifen, dar-
über eine weiße Schürze. Der Kopf ist unbedeckt. Eine
kahle Viehweide vor dem Dorfe wird als Spielplay ausersehen.
Dieses Jahr sind die Dihrns an der Reihe, sie haben ihr
Gelag. Der Sonntagnachmittag, von allen freudig erwartet,
iſt gekommen, und das ,„Buttelſmieten“ beginnt. An einem
laubgeschmückten Gerüſt baumelt eine Flaſche, eine Strecke
davon iſt ein Pfahl eingeſchlagen und ein Haufen Steine
aufgeſchichte. Dort nehmen Lina, Mieke, Dorte, Stina,
Karline, Gret und wie die Dihrns alle heißen, Aufstellung,
und durch das Los wird die Reihenfolge der Werferinnen
entschieden. Dann beginnt der Wettkampf, die Zuſchauer
würzen ihn durch ihre Scherzworte. In der Flaſche ſteckt
ein Zettel, der den Gewinn angiebt. Das Mädchen, das die
Flaſche durch ihren Steinwurf zertrümmert, erhält den Ge-
winn (siehe das obere Bild auf S. 97). Schwieriger ist das
Sacklopen. Jede Magd bringt einen Kornsſack von ihrem
Dienstherrn mit, deſſen Name auch darauf steht, wie das
untere Bild auf S. 97 zeigt. Die Füße werden in die unteren
Zipfel des Sackes gesteckt, der Rand feſt mit den Händen
gepackt, und dann heißt es: „Schnell vorwärts! Dem Ziele
zu!“ Das Sacklaufen will vorher tüchtig geübt ſein, ſonſt
liegt man schon beim zweiten Schritt auf der Nase. Peter
Pietſch hält den mit Bändern und Blumen geschmückten Stab
am Ablaufplatze, rechts und links von der Rennbahn haben ſich
die Zuſchauer aufgestellt. Unter Hurra, Jauchzen und allerlei
| s
raste S LV H |
§. D; tet: r
e ;
f M
Das ,„„Treibhaus‘“' auf der Hamburger Gartenbauausſtellung, Originalzeichnung von K. Müller.
ſpöttiſchen oder aufmunternden Zurufen bewegen sich die
Ez! tz. LUteuealceelum matutge equles
bums ! da liegt sie! Hilfsbereit springen ein paar Knechte
herbei, um sie aufzuheben, denn allein aufzustehen im Sack
iſt ſchwer. Die andern sind indessen voraus, aber auch von
ihnen fällt noch diese oder jene. Die ohne Unfall ans Ziel
gelangen, müssen aufs neue rennen, bis nur eine, die Königin,
übrig bleibt. Diese wählt sich aus der Mitte der Knechte
ihren König, und unter Voraniritt des erlauchten Paares
ſchreiten Knechte und Mägde zu zweien zum Tanz auf der
Frust Dabei singen die Knechte und Dihrns das
innige Lied:
„Drum sag ich’ noch einmal:
Schön iſt die Jugend, ja ;
Schön iſt die Jugend, sie kommt nicht mehr!“ u. s. w.
Der Abend verläuft, wie bei solchen Festen überall unter
Tanz, Trinken, Schäkern.
Die Hamburger Gartenbauausktellung.
(Siehe die 5 Bilder auf Seite 99 und 100.) ;
S" Feier des ſechzigjährigen Bestehens des Gartenbau-
vereines von Hamburg, Altona und Umgebung ist in
Hamburg eine Gartenbauausſtellung veranstaltet worden, die
vom 1. Mai bis zum 30. September 1897 dauert, während
sonst ähnliche Veranstaltungen bereits nach acht- bis zwölf-
tägiger Dauer wieder geschloſſen zu werden pflegen. Man
will in Hamburg den ganzen Gartenbau eines Jahres bis
zum herbstlichen Blätterfall in der Reihenfolge seiner natür-
lichen Entwickelung von Blumen, Stauden, Gemüſen und
Früchten zur Darstellung bringen, daneben zahlreiche Treib-
hausgewächse u. \ w. vorführen. Die Hamburger Gartenbau-
ausstellung (siehe die 5 Bilder auf S. 99 und 100) ist eine
allgemeine, das heißt internationale; sie iſt aus allen Zonen
9 9
beschickt worden und bietet vom wissenſchaftlichen, praktischen
und techniſchen, wie vom rein äſthetiſchen Standpunkte aus
sehr viel Beachtenswertes. Auf einem in der Nähe des
Hamburger Hafens und unmittelbar an den Verkehrsadern
des Straßenlebens gelegenen Gelände breitet ſich die Aus-
stellung in einem Umfange von neunzehn Hektaren aus mit
alten Baumbeständen, maleriſchen Teichpartien, Hallen, Pa-
villons und muſterhaften Parkanlagen. Am Eingang beim
Holstenplatz erhebt sich ein altdeutſcher Thorbau. Dem Be-
ſucher fällt alsdann zuerſt das prachtvolle große Blumen-
parterre ins Auge, das eine Fläche von 16,000 Quadrat-
meter bedeckt und dessen kunstvoll zusſammengestellte Blumen-
gruppen nach der Jahreszeit gewechſelt werden. Es wird
von einer ebenſolangen Wandelhalle mit Musikpavillons an
beiden Enden und einer Gloriette in der Mitte begrenzt.
Auf einer vorſpringenden Terrasse befindet ſich das heizbare
Baſsin mit Nelumbien, Nymphäen und einer majestätiſchen
Victoria regia. Die von Architekt Thielen erbqute Haupt-
halle (S. 100) bedeckt eine Grundfläche von 7600 Geviertmeter
und bietet im Innern eine Gartenanlage von vollendeter Schön-
heit und einer Fülle von Abwechslung. Aus einer Seiten-
halle plätſchert ein Wasserfall über Felsblöcke herab, der ſich
unten als Bach in ein geräumiges Becken inmitten der Halle
rg!t Irouet. qt ee ut h qu zs. uu
der nicht von der Decke herabhängt, sondern feitlich von
ſtarken Bronzedrähten gehalten wird, wodurch er die Vor-
stellung des frei Schwebenden hervorruft. Jn Niſchen werden
Blumensträuße u. s. w. feilgeboten. In den verschiedenen
Hallen, die sich faſt rings um das Gelände der Ausſtellung
| hinziehen, kann man alles finden, was auf dieſem Gebiete
interessant, lehrreich oder in
irgend einer Weiſe hervor-
vagend ist. Hier iſt auch
das Ausland ganz bedeu-
tend beteiligt; Holland und
Belgien, Frankreich und die
Schweiz, Italien, Schweden,
Norwegen, England, Ruß-
land und Amerika haben
Regierungsvertreter entſandt
und eigene Unterausſchüsse
gebildet. Den nordöſtlichen
Teil des Ausstellungsgelän-
des umgrenzen die langen
permanenten Ausſtellungs-
hallen, in denen die Pflan-
die Gartenpläne, die Ge-
müsſe: und HObſstausſtele.
lungen, sowie die wissen-
ſſchaftliche Abteilung ihren
Platz gefunden haben. Hier
großen Sonderaussiellungen
ſtatt. Von der Haupthalle,
an den permanenten Hallen
entlang, bis zum großen
Blumenparterre reihen ſich
zahlloſe kleinere Blumen-
gruppen aneinander. Ueber
den Teich, der den öſtlichen
Teil der Ausstellung vom
westlichen trennt, geht eine
imposanteKettenbrücke, deren
Stützpfeiler reich mit Blu-
men bepflanzt ſind und
mächtige Blumenkronen tra-
gen. In sehr ausgedehntem
Maßſtabe sind die verschie-
denen Induſtrien vertreten,
die zum Garten- und Obſt-
bau in Beziehung stehen.
Einen der Hauptanziehungspunkte der Ausstellung bietet die
Vegetationsgalerie. Hier genießt man innerhalb verdunkelter
Räume den Ausblick auf zehn hellerleuchtete Landſchaftsbilder
verschiedener Zonen mit kunstvollen Nachbildungen der be-
treffenden Pflanzen in geeigneter Umgebung, die sich unmerk-
lich an den gemalten Hintergrund anschließt. Hinter dieſem
Bau liegen die Treibhäuſer, die in praktiſcher Verwendung
vorgeführt werden; sie ſind mit Heizung versehen und ge-
währen Orchideen und anderen seltenen, der Wärme be-
dürftigen Pflanzen Unterkunst. Es versteht sich von selbst,
daß nicht bloß für Wissenswertes und Belehrendes gesorgt
wurde, fondern daß auch Restaurants, Erfriſchungszelte und
Pavillons jeder Art auf dem Ausstellungsplate vorhanden
sind. An die feineren Restaurants schließen ſich die ein-
facheren Wirtschaftslokale, unter denen die originelle Wald-
schenke (S. 100) und das mit köstlichem Humor ausgeſchmüctte
„Treibhaus“ mit seinen heiteren Ueberraſchungen und „Blüten“
(ſiehe das obenstehende Bild) besonders anziehend wirken.
Vier ständige größere Orcheſter und mehrere kleine Kapellen
sorgen für Ohrenschmaus, und die Abendkonzerte vor dem
Café Felber (S. 100) versammeln bei günstigem Wetter stets
ein überaus zahlreiches Publikum.
Dir lrere Wiege.
' Cine Dorfgeſchichte aus Thüringen.
Von E. Ritter.
er Buchenhof war das weitaus ſtattlichſte An-
wesen des am Südabhang des Thüringer Waldes
gelegenen Dorfes. Das Wohnhaus zeichnete sich
vor den anderen des Ortes durch ein Dachgeſchoß aus,
(Nachdruck verboten.)
zen- und Blumenbindereien.
ſinden auch die kleinen unn
kloſter.
(Siehe das Bild auf Seite 96.)
en Namen Trappiſten führen bekanntlich die Mönche des
aus der Abtei La Trappe in Frankreich hervorgegangenen
geiſtlichen Ordens. Diese Abtei gehörte bis zu ihrer Neu-
gestaltung zum Orden der Ciſtercienſer; deren Regel dünkte
jedoch Dominique Armand Jean Lebouthillier de Rancé, der
1665 Abt von La Trappe wurde, viel zu mild. Er reformierte
sie und steigerte ihre noch gegenwärtig streng innegehaltenen
Bestimmungen bis zur größten Härte. Die Zeit des Tages,
welche die Ordensbrüder nicht mit Beten und Messe lesen
verbringen, müſsen sie harter Arbeit, meiſt auf dem Felde,
und ſchweigender Betrachtung widmen. Ihre Gedanken sollen
stets auf Buße und Tod gerichtet sein, deswegen darf, außer
den gottesdienstlichen Gebeten und Gesängen und den not-
wendigsten Mitteilungen während der Arbeit, kein Wort über
ihre Lippen kommen; durch Zeichen geben sie einander ihre
Wünſche zu erkennen. Ihre Nahrung besteht in Brot, Früchten,
Gemüsen und Wasser; Fleiſch, Wein und Bier ſind ihnen gänzlich
untersagt. Wenn ein Neuling an die Pforte eines Trappiſten-
kloſters klopft, um Aufnahme in den Orden zu ſuchen, der
ſo strenge Anforderungen an ſeine Mitglieder stellt, so richtet
der ihm öffnende Bruder Pförtner an ihn die traditionelle
Frage: „Mein Freund, wozu bist du hergekommen?!" Nach-
dem dieser seinen Wunſch kundgegeben, wird er vor den Su-
perior geführt, der ihn nun eingehend befragt, um zu er-
forſchen, ob der Neuling wirklich Beruf zum Trappiſtenleben
in sich fühlt und sein Be-
. gehren ernſt meint. Wenn
dies der Fall iſt, so wird
er in eines der Fremden-
zimmer gebracht, wo er inen
Monat bis sechs Wochen
bleiben muß; er behält wähe
rend dieser Zeit noch die
mitgebrachten. weltlichen
Kleider und hat ſich der für
Güſte des Klosters vorge-
ſchriebenen Regel zu unter-
werfen. Beharrt er nach
dieſer Vorbereitungs- und
Prüfungszeit auf seinem Be-
gehren, hat er den Beweis
dafür geliefert, daß er ein
würdiges Mitglied der Klo-
stergemeinde werden wird,
und besitzt er außerdem eine
feſte Geſundheit, die ihm ge-
ſtattet, die harte Ordens-
regel zu ertragen, dann wird
ihm gestattet, in die Reihe
der Novizen einzutreten. Ge-
wöhnlich wird eine derartige
Aufnahme am Morgen ir-
gend eines hohen kirchlichen
Festes, zum Beiſpiel Ostern,
Pfingsten, Weihnachten
u. s. w., vollzogen. Der No-
vizenmeiſter geleitet den
Neuling in den Kapitelsaal,
in dem alle Angehörigen des
Klosters versammelt ſsind.
Er kniet vor dem Superior
nieder und berührt die Stirn
mit dem Boden, worauf
jener ihn fragt: „Was ſu-
cheſt du ?’ — „Die Barm-
herzigkeit Gottes und die
des Ordens,“ lautet die Ant-
wort. Hierauf richtet der Superior eine Ermahnung an ihn
- und läßt ihn zum Schluß das Versprechen ablegen, die Or-
densregel treu zu befolgen. Dann werden die für ihn be:
stimmten klösterlichen Gewänder: Kutte, Skapulier, Gürtel
u. s. w. gesegnet und ihm angelegt, während ein Bruder seine
abgelegten Oberkleider fortträgt (siehe unser Bild auf S. 96).
Ein gemeinsames Gebet der Kloſtergemeinde für den Novizen,
der bei dieſer Gelegenheit auch einen Ordensnamen erhält,
beschließt den feierlichen Akt. Nach Ablauf des Noviziats steht
es dem Novizen frei, das Kloster wieder zu verlassen, oder
aber ,„Profeß zu thun“, das heißt sich durch Eidesleiſtung
zur Befolgung der Ordensregeln zu verpflichten.
Spiele der Landmädchen in Holltein.
(Siehe die 2 Bilder auf Seite 97.)
D'! kerndeutsche, dem niedersächſiſchen Stamme angehörige
Bevölkerung der preußiſchen Provinz Schleswig-Holstein
iſt nicht lebhafter Art, wie der Rheinländer, oder zu Sang
und Tanz allezeit aufgelegt, wie der Oberbayer, sondern
nüchtern, etwas schwerfällig und wortkarg, aber an öffent-
lichen Luſtbarkeiten und Volksfesten fehlt es nicht. Jn Hol-
stein iſt es ſogar Sitte, daß die Knechte und Dihrns (Mägde)
allſommerlich ihr „Gelag", das heißt ihr Fest ausgerichtet
bekommen, wobei Spiel und Tanz nie fehlen darf. Das
eine Jahr sind die Knechte, das nächste die Dihrns an der
Reihe. Die Knechte wählen gewöhnlich als Spiel das Ring-
reiten, die Dihrns dagegen Buttelſmieten (Flaſchenwerfen),
Satcklopen oder Pottsſlagen (Topfschlagen). Sie laden dazu die
Knechte als Helfer, Zuſchauer und Tänzer ein. Die Knechte
tragen dabei kurze leinene Jacken (sofern sie nicht in Hemds-
ärmeln kommen) und die Mützen auf dem Kopfe. Das ist uner-
läßlich. Wer sich erdreiſten würde, mit dem Filz- oder Strohhut
zu erscheinen, dem würde man ſchön heimleuchten. Solche eti-
kettewidrige Kopfbedeckung darf ſich nur ein verheirateter Mann
Das Buch für Alle.
: . . .: .. {, . | erlauben, der nicht mehr mitzählt. Die Mädchen erscheinen
Einkleidung eines Novizen in einem Trappiſten-
in der hübſchen landesüblichen Tracht, in der die drallen
Gestalten gut zur Geltung kommen: enganliegender Jacke
mit kurzen Puffärmeln aus schwarzem oder doch dunklem
Sammet, eigenangefertigtem Wollenrock mit buntfarbigen
Längsstreifen und unten einigen dunklen Querstreifen, dar-
über eine weiße Schürze. Der Kopf ist unbedeckt. Eine
kahle Viehweide vor dem Dorfe wird als Spielplay ausersehen.
Dieses Jahr sind die Dihrns an der Reihe, sie haben ihr
Gelag. Der Sonntagnachmittag, von allen freudig erwartet,
iſt gekommen, und das ,„Buttelſmieten“ beginnt. An einem
laubgeschmückten Gerüſt baumelt eine Flaſche, eine Strecke
davon iſt ein Pfahl eingeſchlagen und ein Haufen Steine
aufgeſchichte. Dort nehmen Lina, Mieke, Dorte, Stina,
Karline, Gret und wie die Dihrns alle heißen, Aufstellung,
und durch das Los wird die Reihenfolge der Werferinnen
entschieden. Dann beginnt der Wettkampf, die Zuſchauer
würzen ihn durch ihre Scherzworte. In der Flaſche ſteckt
ein Zettel, der den Gewinn angiebt. Das Mädchen, das die
Flaſche durch ihren Steinwurf zertrümmert, erhält den Ge-
winn (siehe das obere Bild auf S. 97). Schwieriger ist das
Sacklopen. Jede Magd bringt einen Kornsſack von ihrem
Dienstherrn mit, deſſen Name auch darauf steht, wie das
untere Bild auf S. 97 zeigt. Die Füße werden in die unteren
Zipfel des Sackes gesteckt, der Rand feſt mit den Händen
gepackt, und dann heißt es: „Schnell vorwärts! Dem Ziele
zu!“ Das Sacklaufen will vorher tüchtig geübt ſein, ſonſt
liegt man schon beim zweiten Schritt auf der Nase. Peter
Pietſch hält den mit Bändern und Blumen geschmückten Stab
am Ablaufplatze, rechts und links von der Rennbahn haben ſich
die Zuſchauer aufgestellt. Unter Hurra, Jauchzen und allerlei
| s
raste S LV H |
§. D; tet: r
e ;
f M
Das ,„„Treibhaus‘“' auf der Hamburger Gartenbauausſtellung, Originalzeichnung von K. Müller.
ſpöttiſchen oder aufmunternden Zurufen bewegen sich die
Ez! tz. LUteuealceelum matutge equles
bums ! da liegt sie! Hilfsbereit springen ein paar Knechte
herbei, um sie aufzuheben, denn allein aufzustehen im Sack
iſt ſchwer. Die andern sind indessen voraus, aber auch von
ihnen fällt noch diese oder jene. Die ohne Unfall ans Ziel
gelangen, müssen aufs neue rennen, bis nur eine, die Königin,
übrig bleibt. Diese wählt sich aus der Mitte der Knechte
ihren König, und unter Voraniritt des erlauchten Paares
ſchreiten Knechte und Mägde zu zweien zum Tanz auf der
Frust Dabei singen die Knechte und Dihrns das
innige Lied:
„Drum sag ich’ noch einmal:
Schön iſt die Jugend, ja ;
Schön iſt die Jugend, sie kommt nicht mehr!“ u. s. w.
Der Abend verläuft, wie bei solchen Festen überall unter
Tanz, Trinken, Schäkern.
Die Hamburger Gartenbauausktellung.
(Siehe die 5 Bilder auf Seite 99 und 100.) ;
S" Feier des ſechzigjährigen Bestehens des Gartenbau-
vereines von Hamburg, Altona und Umgebung ist in
Hamburg eine Gartenbauausſtellung veranstaltet worden, die
vom 1. Mai bis zum 30. September 1897 dauert, während
sonst ähnliche Veranstaltungen bereits nach acht- bis zwölf-
tägiger Dauer wieder geschloſſen zu werden pflegen. Man
will in Hamburg den ganzen Gartenbau eines Jahres bis
zum herbstlichen Blätterfall in der Reihenfolge seiner natür-
lichen Entwickelung von Blumen, Stauden, Gemüſen und
Früchten zur Darstellung bringen, daneben zahlreiche Treib-
hausgewächse u. \ w. vorführen. Die Hamburger Gartenbau-
ausstellung (siehe die 5 Bilder auf S. 99 und 100) ist eine
allgemeine, das heißt internationale; sie iſt aus allen Zonen
9 9
beschickt worden und bietet vom wissenſchaftlichen, praktischen
und techniſchen, wie vom rein äſthetiſchen Standpunkte aus
sehr viel Beachtenswertes. Auf einem in der Nähe des
Hamburger Hafens und unmittelbar an den Verkehrsadern
des Straßenlebens gelegenen Gelände breitet ſich die Aus-
stellung in einem Umfange von neunzehn Hektaren aus mit
alten Baumbeständen, maleriſchen Teichpartien, Hallen, Pa-
villons und muſterhaften Parkanlagen. Am Eingang beim
Holstenplatz erhebt sich ein altdeutſcher Thorbau. Dem Be-
ſucher fällt alsdann zuerſt das prachtvolle große Blumen-
parterre ins Auge, das eine Fläche von 16,000 Quadrat-
meter bedeckt und dessen kunstvoll zusſammengestellte Blumen-
gruppen nach der Jahreszeit gewechſelt werden. Es wird
von einer ebenſolangen Wandelhalle mit Musikpavillons an
beiden Enden und einer Gloriette in der Mitte begrenzt.
Auf einer vorſpringenden Terrasse befindet ſich das heizbare
Baſsin mit Nelumbien, Nymphäen und einer majestätiſchen
Victoria regia. Die von Architekt Thielen erbqute Haupt-
halle (S. 100) bedeckt eine Grundfläche von 7600 Geviertmeter
und bietet im Innern eine Gartenanlage von vollendeter Schön-
heit und einer Fülle von Abwechslung. Aus einer Seiten-
halle plätſchert ein Wasserfall über Felsblöcke herab, der ſich
unten als Bach in ein geräumiges Becken inmitten der Halle
rg!t Irouet. qt ee ut h qu zs. uu
der nicht von der Decke herabhängt, sondern feitlich von
ſtarken Bronzedrähten gehalten wird, wodurch er die Vor-
stellung des frei Schwebenden hervorruft. Jn Niſchen werden
Blumensträuße u. s. w. feilgeboten. In den verschiedenen
Hallen, die sich faſt rings um das Gelände der Ausſtellung
| hinziehen, kann man alles finden, was auf dieſem Gebiete
interessant, lehrreich oder in
irgend einer Weiſe hervor-
vagend ist. Hier iſt auch
das Ausland ganz bedeu-
tend beteiligt; Holland und
Belgien, Frankreich und die
Schweiz, Italien, Schweden,
Norwegen, England, Ruß-
land und Amerika haben
Regierungsvertreter entſandt
und eigene Unterausſchüsse
gebildet. Den nordöſtlichen
Teil des Ausstellungsgelän-
des umgrenzen die langen
permanenten Ausſtellungs-
hallen, in denen die Pflan-
die Gartenpläne, die Ge-
müsſe: und HObſstausſtele.
lungen, sowie die wissen-
ſſchaftliche Abteilung ihren
Platz gefunden haben. Hier
großen Sonderaussiellungen
ſtatt. Von der Haupthalle,
an den permanenten Hallen
entlang, bis zum großen
Blumenparterre reihen ſich
zahlloſe kleinere Blumen-
gruppen aneinander. Ueber
den Teich, der den öſtlichen
Teil der Ausstellung vom
westlichen trennt, geht eine
imposanteKettenbrücke, deren
Stützpfeiler reich mit Blu-
men bepflanzt ſind und
mächtige Blumenkronen tra-
gen. In sehr ausgedehntem
Maßſtabe sind die verschie-
denen Induſtrien vertreten,
die zum Garten- und Obſt-
bau in Beziehung stehen.
Einen der Hauptanziehungspunkte der Ausstellung bietet die
Vegetationsgalerie. Hier genießt man innerhalb verdunkelter
Räume den Ausblick auf zehn hellerleuchtete Landſchaftsbilder
verschiedener Zonen mit kunstvollen Nachbildungen der be-
treffenden Pflanzen in geeigneter Umgebung, die sich unmerk-
lich an den gemalten Hintergrund anschließt. Hinter dieſem
Bau liegen die Treibhäuſer, die in praktiſcher Verwendung
vorgeführt werden; sie ſind mit Heizung versehen und ge-
währen Orchideen und anderen seltenen, der Wärme be-
dürftigen Pflanzen Unterkunst. Es versteht sich von selbst,
daß nicht bloß für Wissenswertes und Belehrendes gesorgt
wurde, fondern daß auch Restaurants, Erfriſchungszelte und
Pavillons jeder Art auf dem Ausstellungsplate vorhanden
sind. An die feineren Restaurants schließen ſich die ein-
facheren Wirtschaftslokale, unter denen die originelle Wald-
schenke (S. 100) und das mit köstlichem Humor ausgeſchmüctte
„Treibhaus“ mit seinen heiteren Ueberraſchungen und „Blüten“
(ſiehe das obenstehende Bild) besonders anziehend wirken.
Vier ständige größere Orcheſter und mehrere kleine Kapellen
sorgen für Ohrenschmaus, und die Abendkonzerte vor dem
Café Felber (S. 100) versammeln bei günstigem Wetter stets
ein überaus zahlreiches Publikum.
Dir lrere Wiege.
' Cine Dorfgeſchichte aus Thüringen.
Von E. Ritter.
er Buchenhof war das weitaus ſtattlichſte An-
wesen des am Südabhang des Thüringer Waldes
gelegenen Dorfes. Das Wohnhaus zeichnete sich
vor den anderen des Ortes durch ein Dachgeſchoß aus,
(Nachdruck verboten.)
zen- und Blumenbindereien.
ſinden auch die kleinen unn