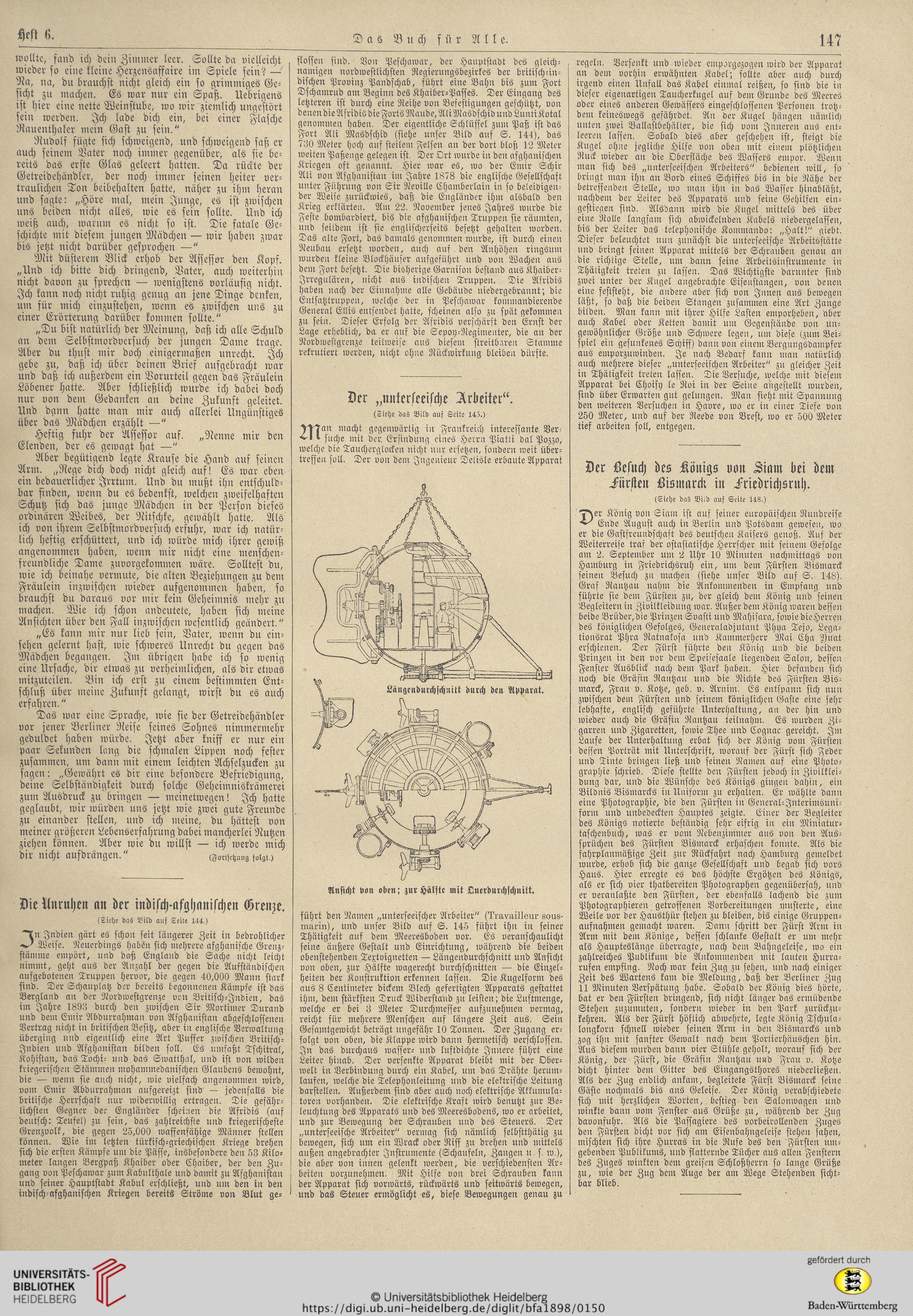Heſt (.
wollte, fand ich dein Zimmer leer. Sollte da vielleicht
wieder so eine kleine Herzensaffaire im Spiele sein? –
Na, na, du brauchſt nicht gleich ein so grimmiges Ge-
ſicht zu machen. Es war nur ein Spaß. Uebrigens
iſt hier eine nette Weinstube, wo wir ziemlich ungestört
sein werden. Ich lade dich ein, bei einer Flaſche
Rauenthaker mein Gaſt zu sein.“
Rudolf fügte ſich ſchweigend, und schweigend saß er
auch seinem Vater noch immer gegenüber, als sie be-
reits das erſte Glas geleert hatten. Da rückte der
Getreidehändler, der noch immer ſeinen heiter ver-
traulichen Ton beibehalten hatte, näher zu ihm heran
und sagte: „Höre mal, mein Junge, es iſt zwiſchen
uns beiden nicht alles, wie es sein ſollte. Und ich
weiß auch, warum es nicht so iſt. Die fatale Ge-
ſchichte mit diesem jungen Mädchen ~ wir haben zwar
bis jetzt nicht darüber gesprochen –
Mit düſterem Blick erhob der Asseſſor den Kopf.
„Und ich bitte dich dringend, Vater, auch weiterhin
nicht davon zu sprechen ~ wenigstens vorläufig nicht.
Ich kann noch nicht ruhig genug an jene Dinge denken,
um für mich einzuſtehen, wenn es zwiſchen uns zu
einer Erörterung darüber kommen ſollte.“
„Du biſt natürlich der Meinung, daß ich alle Schuld
an dem Selbſtmordverſuch der jungen Dame trage.
Aber du thuſt mir doch einigermaßen unrecht. Ich
gebe zu, daß ich über deinen Brief aufgebracht war
und daß ich außerdem ein Vorurteil gegen das Fräulein |
Löbener hatte. Aber ſchließlich wurde ich dabei doch
nur von dem Gedanken an deine Zukunft geleitet.
Und dann hatte man mir auch allerlei Ungünſtiges
über das Mädchen erzählt –“ .
HHeftig fuhr der Aſeſſor auf. „Nenne mir den
Elenden, der es gewagt hat –
Aber begütigend legte Krauſe die Hand auf seinen
î Arm. „Rege dich doch nicht gleich auf! Es war eben
ein bedauerlicher Irrtum. Und du mußt ihn entsſchuld-
bar finden, wenn du es bedenkſt, welchen zweifelhaften
Schutz ſich das junge Mädchen in der Person dieses
_ ordinären Weibes, der Nitſchke, gewählt hatte. Als
ich von ihrem Selbſtmordverſuch erfuhr, war ich natür-
lich heftig erſchüttert, und ich würde mich ihrer gewiß
angenommen haben, wenn mir nicht eine menschen-
freundliche Dame zuvorgekommen wäre. Solltest du,
wie ich beinahe vermute, die alten Beziehungen zu dem
Fräulein inzwiſchen wieder aufgenommen haben, so
brauchſt du daraus vor mir kein Geheimnis mehr zu
machen. Wie ich schon andeutete, haben sich meine
Ansichten über den Fall inzwiſchen wesentlich geändert. “
„Es kann mir nur lieb sein, Vater, wenn du ein-
_ ehen gelernt haſt, wie ſchweres Unrecht du gegen das
Mädchen begangen. Im übrigen habe ich so wenig
eine Urſache, dir etwas zu verheimlichen, als dir etwas
mitzuteilen. Bin ich erſt zu einem bestimmten Ent-
[ls über meine Zukunſt gelangt, wirſt du es auch
erfahren. "
Das war eine Sprache, wie sie der Getreidehändler
vor jener Berliner Reiſe seines Sohnes nimmermehr
geduldet haben würde. Jett aber kniff er nur ein
paar Sekunden lang die ſchmalen Lippen noch fester
zuſammen, um dann mit einem leichten Achſelzucken zu
ſagen: „Gewährt es dir eine besondere Befriedigung,
deine Selbſtändigkeit durch solche Geheimniskrämerei
zum Ausdruck zu bringen ~ meinetwegen! Ich hatte
geglaubt, wir würden uns jetzt wie zwei gute Freunde |.
zu einander stellen, und ich meine, du hättest von
î meiner größeren Lebenserfahrung dabei mancherlei Nuten
ziehen können. Aber wie du willſt ~ ich werde mich
; dir nicht aufdrängen. “ (Fortſegung folgt.)
Die Unruhen an der indiſch-afghaniſchen Grenzt.
(Siehe das Bild auf Seile 144.)
J'ſſfen gärt es ſchon seit längerer Zeit in bedrohlicher
Weise. Neuerdings haben sich mehrere afghanische Grenz-
ſtämme empört, und daß England die Sache nicht leicht
nimmt, geht aus der Anzahl der gegen die Aufständischen
aufgebotenen Truppen hervor, die gegen 40,000 Mann stark
sind. Der Schauplay der bereits begonnenen Kämpfe iſt das
Bergland an der Nordwestgrenze von Britiſch-JIndien, das
im Jahre 1893 durch den zwiſchen Sir Mortimer Durand
und dem Emir Abdurrahman von Afghanistan abgeschlossenen
Vertrag nicht in britiſchen Beſit, aber in englische Verwaltung
überging und eigentlich eine Art Puffer zwiſchen Britisch-
Indien und Afghanistan bilden soll. Es umfaßt Tschitral,
Kohiſtan, das Tochi- und das Swatthal, und ist von wilden
kriegeriſchen Stämmen mohammedaniſchen Glaubens bewohnt,
die ~ wenn ſie auch nicht, wie vielfach angenommen wird,
vom Emir Abdurrahman aufgereizt ſind ~ jedenfalls die
britiſche Herrſchaft nur widerwillig ertragen. Die gefähr-
lichſten Gegner der Engländer scheinen die Afridis (auf
deutſch: Teufel) zu sein, das zahlreichſte und kriegeriſcheste
Grenzvolk, die gegen 25,000 waffenfähige Männer ſtellen
können. Wie im letzten türkiſch-griechiſchen Kriege drehen
ſich die erſten Kämpfe um die Päſsſe, insbesondere den 53 Kilo-
meter langen Bergpaß Khaiber oder Chaiber, der den Zu-
gang von Peſschawar zum Kabulthale und damit zu Afghaniſtan
und ſeiner Hauptſtadt Kabul erſchließt, und um den in den
indiſch-afghaniſchen Kriegen bereits Ströme von Blut ge-
Das B uch für Alle.
floſſen ſind. Von Peschawar, der Hauptstadt des gleich-
namigen nordweſtlichſten Regierungsbezirkes der britisſch-in-
diſchen Provinz Pandſchab, sührt eine Bahn bis zum Fort
Dſchamrud am Beginn des Khaiber-Paſſes. Der Eingang des
letzteren ist durch eine Reihe von Befestigungen geschützt, von
denendie Afridis die Forts Maude, Ali Masdschid und Lunti Kotal
genommen haben. Der eigentliche Schlüssel zum Paß iſt das
Fort Ali Masdschid (ſiehe unser Bild auf S. 144), das
730 Meter hoch auf steilem Felſen an der dort bloß 12 Meter
weiten Paßenge gelegen ist. Der Ort wurde in den afghanischen
Kriegen oft genannt. Hier war es, wo der Emir Schir
Ali von Afghanistan im Jahre 1878 die englische Gesellschaft
unter Führung von Sir Neville Chamberlain in so beleidigen-
der Weiſe zurückwies, daß die Engländer ihm alsbald den
Krieg erklärten. Am 22. November jenes Jahres wurde die
Jeſte bombardiert, bis die afghaniſchen Truppen sie räumten,
und ſeildem ist sie engliſcherseits beseßt gehalten worden.
Das alte Fort, das damals genommen wurde, ist durch einen
Neubau ersſeßt worden, auch auf den Anhöhen ringsum
wurden kleine Blockhäuſer aufgeführt und von Wachen aus
dem Fort beſetßt. Die bisherige Garniſon beſtand aus Khaiber-
Irregulären, nicht aus indiſchen Truppen. Die Afſridis
haben nach der Cinnahme alle Gebäude niedergebrannt; die
Entsatztruppen, welche der in Peschawar kommandierende
General Ellis entsendet hatte, scheinen alſo zu spät gekommen
zu sein. Dieser Erfolg der Afridis verſchärſt den Ernst der
Lage erheblich, da er auf die Sepoy-Regimenter, die an der
Nordwesigrenze teilweiſe aus diesem ſtreitbaren Stamme
rekrutiert werden, nicht ohne Rückwirkung bleiben dürfte.
Der „unterſeeiſche Arbeiter“.
(Siehe das Bild auf Seite 145.)
N" macht gegenwärtig in Frankreich intereſſante Ver:
ſuche mit der. Erfindung eines Herrn Piatti dal Pozzo,
welche die Taucherglocken nicht nur ersſeten, sondern weit über-
treffen ſoll. Der von dem Ingenieur Delisle erbaute Apparat
Anſicht von oben; zur Hälſte mit Querdurchſchnilt.
führt den Namen „unterseeiſcher Arbeiter" (Travailleur sous-
marin), und unser Bild auf S. 145 führt ihn in ſeiner
Thätigkeit auf dem Meeresboden vor. Es veranschaulicht
seine äußere Gestalt und Einrichtung, während die beiden
obenstehenden Textvignetten –~ Längendurchſschnitt und Ansicht
von oben, zur Hälfte wagerecht durchſchnitten – die Einzel-
heiten der Konstruktion erkennen laſſen. Die Kugelform des
aus 8 Centimeter dickem Blech gefertigten Apparats gestattet
ihm, dem stärkſten Druck Widerstand zu leisten; die Luftmenge,
welche er bei 3 Meter Durchmesser aufzunehmen vermag,
reicht für mehrere Menschen auf längere Zeit aus. Sein
Gesamtgewicht beträgt ungefähr 10 Tonnen. Der Zugang er-
folgt von oben, die Klappe wird dann hermetiſch verſchlossen.
In das durchaus wasser- und luftdichte Innere führt eine
Leiter hinab. Der versenkte Apparat bleibt mit der Ober-
welt in Verbindung durch ein Kabel, um das Drähte herum-
laufen, welche die Telephonleitung und die elektriſche Leitung
darstellen. Außerdem ſind aber auch noch elektriſche Akkumula-
toren vorhanden. Die elektriſche Kraft wird benutzt zur Be-
leuchtung des Apparats und des Meeresbodens, wo er arbeitet,
und zur Bewegung der Schrauben und des Steuers. Der
„unterseeiſche Arbeiter" vermag sich nämlich selbſtthätig zu
bewegen, sich um ein Wrack oder Riff zu drehen und mittels
außen angebrachter Instrumente (Schaufeln, Zangen u. s. w.),
die aber von innen gelenkt werden, die verſchiedenſten Ar-
beiten vorzunehmen. Mit Hilfe von drei Schrauben kann
der Apparat ſich vorwärts, rückwärts und seitwärts bewegen,
und das Steuer ermöglicht es, dieſe Bewegungen genau zu |
147
regeln. Verſenkt und wieder emporgezogen wird der Apparat
an dem vorhin erwähnten Kabel; sollte aber auch durch
irgend einen Unfall das Kabel einmal reißen, so sind die in
dieſer eigenartigen Taucherkugel auf dem Grunde des Meeres
oder eines anderen Gewässers eingeschlossenen Personen troyh-
dem keineswegs gefährdet. An der Kugel hängen nämlich
unten zwei Ballastbehälter, die sich vom Jnneren aus ent-
leeren lasſen. Sobald dies aber geschehen iſt, steigt die
Kugel ohne jegliche Hilfe von oben mit einem plötlichen
Ruck wieder an die Oberfläche des Wassers empor. Wenn
man sich des „unterseeiſchen Arbeiters" bedienen will, so
bringt man ihn an Bord eines Schiffes bis in die Nähe der
betreffenden Stelle, wo man ihn in das Wasser hinabläßt,
nachdem der Leiter des Apparats und seine Gehilfen ein-
gestiegen sind. Alsdann wird die Kugel mittels des über
eine Rolle langſam ſich abwickelnden Kabels niedergelassen,
bis der Leiter das telephoniſche Kommando: „Halt!“ giebt.
Dieser beleuchtet nun zunächst die untersſeeiſche Arbeitsſtätte
und bringt seinen Apparat mittels der Schrauben genau an
‘die richtige Stelle, um dann ſeine Arbeitsinstrumente in
Thätigkeit treten zu laſſen. Das Wichtigste darunter sind
zwei unter der Kugel angebrachte Eiſenſtangen, von denen
eine feſtiſteht, die andere aber ſich von Innen aus bewegen
läßt, ſo daß die beiden Stangen zusammen eine Art gange
bilden. Man kann mit ihrer Hilfe Lasten emporheben, aber
auch Kabel oder Ketten damit um Gegenstände von un-
gewöhnlicher Größe und Schwere legen, um diese (zum Bei-
ſpiel ein geſunkenes Schiff) dann von einem Bergungsdampfer
aus emporzuwinden. Je nach Bedarf kann man natürlich
auch mehrere dieser „unterseeiſchen Arbeiter" zu gleicher Zeit
in Thätigkeit treten laſſen. Die Versuche, welche mit diesem
Apparat bei Choiſy le Roi in der Seine angestellt wurden,
ſind über Erwarten gut gelungen. Man sieht mit Spannung
den weiteren Verſuchen in Havre, wo er in einer Tiefe von
250 Meter, und auf der Reede von Brest, wo er 500 Meter
tief arbeiten ſoll, entgegen.
Der Beſuch des Königs von Siam bei dem
Fürſten Bismarck in Friedrichsruh.
(Siehe das Biid auf Seite 148.)
D? König von Siam ist auf seiner europäiſchen Rundreise
Ende Auguſt auch in Berlin und Potsdam gewesen, wo
er die Gastfreundschaft des deutschen Kaiſers genoß. Auf der
Weiterreiſe traf der oſtaſiatiſche Herrſcher mit seinem Gefolge
am 2. September um 2 Uhr 10 Minuten nachmittags von
Hamburg in Friedrichsruh ein, um dem Fürsten Bismarck
seinen Besuch zu machen (siehe unser Bild auf S.. 148).
Graf Ranßau nahm die Ankommenden in Empfang unn
führte ſie dem Fürſten zu, der gleich dem König und ſeinen
Begleitern in Zivilkleidung war. Außer dem König waren deſſen
beide Brüder, die Prinzen Svasti und Mahisara, ſowie die Herren
des königlichen Gefolges, Generaladjutant Phya Tejo, Lega-
tionsrat Phra Ratnakoſa und Kammerherr Mai Cha Yuat
erſchienen. Der Fürst führte den König und die beiden
Prinzen in den vor dem Speiſesaale liegenden Salon, dessen
Fenster Ausblick nach dem Park haben. Hier befanden ſich
noch die Gräfin Rantzau und die Nichte des Fürsten Bis-
marck, Frau v. Kotze, geb. v. Arnim. Es entspann sich nun
zwiſchen dem Fürsten und seinem königlichen Gaſte eine sehr
lebhafte, engliſch geführte Unterhaltung, an der hin und
wieder auch die Gräfin Rantzau teilnahm. Es wurden Zi-
garren und Zigaretten, sowie Thee und Cognac gereicht. Jm
Laufe der Unterhaltung erbat sich der König vom Fürsten
deſſen Porträt mit Unterschrift, worauf der Fürſt ſich Feder
und Tinte bringen ließ und seinen Namen auf eine Photo-
graphie ſchrieb. Diese stellte den Fürsten jedoch in Zivilklei-
dung dar, und die Wünſche des Königs gingen dahin, ein
Bildnis Bismarcks in Uniform zu erhalten. Er wählte dann
eine Photographie, die den Fürsten in General-Interimsuni-
| form und unbedeckten Hauptes zeigte. Einer der Begleiter
des Königs notierte beständig sehr eifrig in ein Miniatur-
taſchenbuch, was er vom Nebenzimmer aus von den Aus-
sprüchen des Fürſten Bismarck erhaſchen konnte. Als die
fahrplanmäßige Zeit zur Rückfahrt nach Hamburg gemeldet
wurde, erhob ſich die ganze Gesellſchaft und begab ſich vors
Haus. Hier erregte es das höchſte Ergößen des Königs,
als er sich vier thatbereiten Photographen gegenübersſah, und
er veranlaßte den Fürſten, der ebenfalls lachend die zum
Photographieren getroffenen Vorbereitungen muſterte, eine
Weile vor der Hausthür ſtehen zu bleiben, bis einige Gruppen-
aufnahmen gemacht waren. Dann ſchritt der Fürſt Arm in
Arm mit dem Könige, dessen ſchlanke Gestalt er um mehr
als Haupteslänge überragte, nach dem Bahngeleiſe, wo ein
zahlreiches Publikum die Ankommenden mit lauten Hurra-
rufen empfing. Noch war kein Zug zu sehen, und nach eingee..
Zeit des Wartens kam die Meldung, daß der Berliner Zug
11 Minuten Verſpätung habe. Sobald der König dies hörte,
bat er den Fürsten dringend, ſich nicht länger das ermüdende
Stehen zuzumuten, sondern wieder in den Park zurückzu-
kehren. Als der Fürst höflich abwehrte, legte König Tſchula-
longkorn schnell wieder seinen Arm in den Bismarcks und
zog ihn mit sanfter Gewalt nach dem Portierhäuschen hin.
Aus diesem wurden dann vier Stühle geholt, worauf sich der
König, der Fürſt, die Gräfin Rantzau und Frau v. Kotze
dicht hinter dem Gitter des Eingangsthores niederließen.
Als der Zug endlich ankam, begleitete Fürſt Bismarck seine
Gäſle nochmals bis ans Geleiſe. Der König verabschiedete
sich mit herzlichen Worten, . beſtieg den Salonwagen und
winkte dann vom Fenster aus Grüße zu, während der zug
davonfuhr. Als die Passagiere des vorbeirollenden Zuges
den Fürſten dicht vor ſich am Eisenbahngeleiſe stehen sahen,
mischten sich ihre Hurras in die Rufe des den Fürsten um-
gebenden Publikums, und flatternde Tücher aus allen Fenſtern
des Zuges winkten dem greiſen Schloßherrn so lange Grüße
zu, wie der Zug dem Auge der am Wege Stehenden ſicht-
bar blieb. t . :
wollte, fand ich dein Zimmer leer. Sollte da vielleicht
wieder so eine kleine Herzensaffaire im Spiele sein? –
Na, na, du brauchſt nicht gleich ein so grimmiges Ge-
ſicht zu machen. Es war nur ein Spaß. Uebrigens
iſt hier eine nette Weinstube, wo wir ziemlich ungestört
sein werden. Ich lade dich ein, bei einer Flaſche
Rauenthaker mein Gaſt zu sein.“
Rudolf fügte ſich ſchweigend, und schweigend saß er
auch seinem Vater noch immer gegenüber, als sie be-
reits das erſte Glas geleert hatten. Da rückte der
Getreidehändler, der noch immer ſeinen heiter ver-
traulichen Ton beibehalten hatte, näher zu ihm heran
und sagte: „Höre mal, mein Junge, es iſt zwiſchen
uns beiden nicht alles, wie es sein ſollte. Und ich
weiß auch, warum es nicht so iſt. Die fatale Ge-
ſchichte mit diesem jungen Mädchen ~ wir haben zwar
bis jetzt nicht darüber gesprochen –
Mit düſterem Blick erhob der Asseſſor den Kopf.
„Und ich bitte dich dringend, Vater, auch weiterhin
nicht davon zu sprechen ~ wenigstens vorläufig nicht.
Ich kann noch nicht ruhig genug an jene Dinge denken,
um für mich einzuſtehen, wenn es zwiſchen uns zu
einer Erörterung darüber kommen ſollte.“
„Du biſt natürlich der Meinung, daß ich alle Schuld
an dem Selbſtmordverſuch der jungen Dame trage.
Aber du thuſt mir doch einigermaßen unrecht. Ich
gebe zu, daß ich über deinen Brief aufgebracht war
und daß ich außerdem ein Vorurteil gegen das Fräulein |
Löbener hatte. Aber ſchließlich wurde ich dabei doch
nur von dem Gedanken an deine Zukunft geleitet.
Und dann hatte man mir auch allerlei Ungünſtiges
über das Mädchen erzählt –“ .
HHeftig fuhr der Aſeſſor auf. „Nenne mir den
Elenden, der es gewagt hat –
Aber begütigend legte Krauſe die Hand auf seinen
î Arm. „Rege dich doch nicht gleich auf! Es war eben
ein bedauerlicher Irrtum. Und du mußt ihn entsſchuld-
bar finden, wenn du es bedenkſt, welchen zweifelhaften
Schutz ſich das junge Mädchen in der Person dieses
_ ordinären Weibes, der Nitſchke, gewählt hatte. Als
ich von ihrem Selbſtmordverſuch erfuhr, war ich natür-
lich heftig erſchüttert, und ich würde mich ihrer gewiß
angenommen haben, wenn mir nicht eine menschen-
freundliche Dame zuvorgekommen wäre. Solltest du,
wie ich beinahe vermute, die alten Beziehungen zu dem
Fräulein inzwiſchen wieder aufgenommen haben, so
brauchſt du daraus vor mir kein Geheimnis mehr zu
machen. Wie ich schon andeutete, haben sich meine
Ansichten über den Fall inzwiſchen wesentlich geändert. “
„Es kann mir nur lieb sein, Vater, wenn du ein-
_ ehen gelernt haſt, wie ſchweres Unrecht du gegen das
Mädchen begangen. Im übrigen habe ich so wenig
eine Urſache, dir etwas zu verheimlichen, als dir etwas
mitzuteilen. Bin ich erſt zu einem bestimmten Ent-
[ls über meine Zukunſt gelangt, wirſt du es auch
erfahren. "
Das war eine Sprache, wie sie der Getreidehändler
vor jener Berliner Reiſe seines Sohnes nimmermehr
geduldet haben würde. Jett aber kniff er nur ein
paar Sekunden lang die ſchmalen Lippen noch fester
zuſammen, um dann mit einem leichten Achſelzucken zu
ſagen: „Gewährt es dir eine besondere Befriedigung,
deine Selbſtändigkeit durch solche Geheimniskrämerei
zum Ausdruck zu bringen ~ meinetwegen! Ich hatte
geglaubt, wir würden uns jetzt wie zwei gute Freunde |.
zu einander stellen, und ich meine, du hättest von
î meiner größeren Lebenserfahrung dabei mancherlei Nuten
ziehen können. Aber wie du willſt ~ ich werde mich
; dir nicht aufdrängen. “ (Fortſegung folgt.)
Die Unruhen an der indiſch-afghaniſchen Grenzt.
(Siehe das Bild auf Seile 144.)
J'ſſfen gärt es ſchon seit längerer Zeit in bedrohlicher
Weise. Neuerdings haben sich mehrere afghanische Grenz-
ſtämme empört, und daß England die Sache nicht leicht
nimmt, geht aus der Anzahl der gegen die Aufständischen
aufgebotenen Truppen hervor, die gegen 40,000 Mann stark
sind. Der Schauplay der bereits begonnenen Kämpfe iſt das
Bergland an der Nordwestgrenze von Britiſch-JIndien, das
im Jahre 1893 durch den zwiſchen Sir Mortimer Durand
und dem Emir Abdurrahman von Afghanistan abgeschlossenen
Vertrag nicht in britiſchen Beſit, aber in englische Verwaltung
überging und eigentlich eine Art Puffer zwiſchen Britisch-
Indien und Afghanistan bilden soll. Es umfaßt Tschitral,
Kohiſtan, das Tochi- und das Swatthal, und ist von wilden
kriegeriſchen Stämmen mohammedaniſchen Glaubens bewohnt,
die ~ wenn ſie auch nicht, wie vielfach angenommen wird,
vom Emir Abdurrahman aufgereizt ſind ~ jedenfalls die
britiſche Herrſchaft nur widerwillig ertragen. Die gefähr-
lichſten Gegner der Engländer scheinen die Afridis (auf
deutſch: Teufel) zu sein, das zahlreichſte und kriegeriſcheste
Grenzvolk, die gegen 25,000 waffenfähige Männer ſtellen
können. Wie im letzten türkiſch-griechiſchen Kriege drehen
ſich die erſten Kämpfe um die Päſsſe, insbesondere den 53 Kilo-
meter langen Bergpaß Khaiber oder Chaiber, der den Zu-
gang von Peſschawar zum Kabulthale und damit zu Afghaniſtan
und ſeiner Hauptſtadt Kabul erſchließt, und um den in den
indiſch-afghaniſchen Kriegen bereits Ströme von Blut ge-
Das B uch für Alle.
floſſen ſind. Von Peschawar, der Hauptstadt des gleich-
namigen nordweſtlichſten Regierungsbezirkes der britisſch-in-
diſchen Provinz Pandſchab, sührt eine Bahn bis zum Fort
Dſchamrud am Beginn des Khaiber-Paſſes. Der Eingang des
letzteren ist durch eine Reihe von Befestigungen geschützt, von
denendie Afridis die Forts Maude, Ali Masdschid und Lunti Kotal
genommen haben. Der eigentliche Schlüssel zum Paß iſt das
Fort Ali Masdschid (ſiehe unser Bild auf S. 144), das
730 Meter hoch auf steilem Felſen an der dort bloß 12 Meter
weiten Paßenge gelegen ist. Der Ort wurde in den afghanischen
Kriegen oft genannt. Hier war es, wo der Emir Schir
Ali von Afghanistan im Jahre 1878 die englische Gesellschaft
unter Führung von Sir Neville Chamberlain in so beleidigen-
der Weiſe zurückwies, daß die Engländer ihm alsbald den
Krieg erklärten. Am 22. November jenes Jahres wurde die
Jeſte bombardiert, bis die afghaniſchen Truppen sie räumten,
und ſeildem ist sie engliſcherseits beseßt gehalten worden.
Das alte Fort, das damals genommen wurde, ist durch einen
Neubau ersſeßt worden, auch auf den Anhöhen ringsum
wurden kleine Blockhäuſer aufgeführt und von Wachen aus
dem Fort beſetßt. Die bisherige Garniſon beſtand aus Khaiber-
Irregulären, nicht aus indiſchen Truppen. Die Afſridis
haben nach der Cinnahme alle Gebäude niedergebrannt; die
Entsatztruppen, welche der in Peschawar kommandierende
General Ellis entsendet hatte, scheinen alſo zu spät gekommen
zu sein. Dieser Erfolg der Afridis verſchärſt den Ernst der
Lage erheblich, da er auf die Sepoy-Regimenter, die an der
Nordwesigrenze teilweiſe aus diesem ſtreitbaren Stamme
rekrutiert werden, nicht ohne Rückwirkung bleiben dürfte.
Der „unterſeeiſche Arbeiter“.
(Siehe das Bild auf Seite 145.)
N" macht gegenwärtig in Frankreich intereſſante Ver:
ſuche mit der. Erfindung eines Herrn Piatti dal Pozzo,
welche die Taucherglocken nicht nur ersſeten, sondern weit über-
treffen ſoll. Der von dem Ingenieur Delisle erbaute Apparat
Anſicht von oben; zur Hälſte mit Querdurchſchnilt.
führt den Namen „unterseeiſcher Arbeiter" (Travailleur sous-
marin), und unser Bild auf S. 145 führt ihn in ſeiner
Thätigkeit auf dem Meeresboden vor. Es veranschaulicht
seine äußere Gestalt und Einrichtung, während die beiden
obenstehenden Textvignetten –~ Längendurchſschnitt und Ansicht
von oben, zur Hälfte wagerecht durchſchnitten – die Einzel-
heiten der Konstruktion erkennen laſſen. Die Kugelform des
aus 8 Centimeter dickem Blech gefertigten Apparats gestattet
ihm, dem stärkſten Druck Widerstand zu leisten; die Luftmenge,
welche er bei 3 Meter Durchmesser aufzunehmen vermag,
reicht für mehrere Menschen auf längere Zeit aus. Sein
Gesamtgewicht beträgt ungefähr 10 Tonnen. Der Zugang er-
folgt von oben, die Klappe wird dann hermetiſch verſchlossen.
In das durchaus wasser- und luftdichte Innere führt eine
Leiter hinab. Der versenkte Apparat bleibt mit der Ober-
welt in Verbindung durch ein Kabel, um das Drähte herum-
laufen, welche die Telephonleitung und die elektriſche Leitung
darstellen. Außerdem ſind aber auch noch elektriſche Akkumula-
toren vorhanden. Die elektriſche Kraft wird benutzt zur Be-
leuchtung des Apparats und des Meeresbodens, wo er arbeitet,
und zur Bewegung der Schrauben und des Steuers. Der
„unterseeiſche Arbeiter" vermag sich nämlich selbſtthätig zu
bewegen, sich um ein Wrack oder Riff zu drehen und mittels
außen angebrachter Instrumente (Schaufeln, Zangen u. s. w.),
die aber von innen gelenkt werden, die verſchiedenſten Ar-
beiten vorzunehmen. Mit Hilfe von drei Schrauben kann
der Apparat ſich vorwärts, rückwärts und seitwärts bewegen,
und das Steuer ermöglicht es, dieſe Bewegungen genau zu |
147
regeln. Verſenkt und wieder emporgezogen wird der Apparat
an dem vorhin erwähnten Kabel; sollte aber auch durch
irgend einen Unfall das Kabel einmal reißen, so sind die in
dieſer eigenartigen Taucherkugel auf dem Grunde des Meeres
oder eines anderen Gewässers eingeschlossenen Personen troyh-
dem keineswegs gefährdet. An der Kugel hängen nämlich
unten zwei Ballastbehälter, die sich vom Jnneren aus ent-
leeren lasſen. Sobald dies aber geschehen iſt, steigt die
Kugel ohne jegliche Hilfe von oben mit einem plötlichen
Ruck wieder an die Oberfläche des Wassers empor. Wenn
man sich des „unterseeiſchen Arbeiters" bedienen will, so
bringt man ihn an Bord eines Schiffes bis in die Nähe der
betreffenden Stelle, wo man ihn in das Wasser hinabläßt,
nachdem der Leiter des Apparats und seine Gehilfen ein-
gestiegen sind. Alsdann wird die Kugel mittels des über
eine Rolle langſam ſich abwickelnden Kabels niedergelassen,
bis der Leiter das telephoniſche Kommando: „Halt!“ giebt.
Dieser beleuchtet nun zunächst die untersſeeiſche Arbeitsſtätte
und bringt seinen Apparat mittels der Schrauben genau an
‘die richtige Stelle, um dann ſeine Arbeitsinstrumente in
Thätigkeit treten zu laſſen. Das Wichtigste darunter sind
zwei unter der Kugel angebrachte Eiſenſtangen, von denen
eine feſtiſteht, die andere aber ſich von Innen aus bewegen
läßt, ſo daß die beiden Stangen zusammen eine Art gange
bilden. Man kann mit ihrer Hilfe Lasten emporheben, aber
auch Kabel oder Ketten damit um Gegenstände von un-
gewöhnlicher Größe und Schwere legen, um diese (zum Bei-
ſpiel ein geſunkenes Schiff) dann von einem Bergungsdampfer
aus emporzuwinden. Je nach Bedarf kann man natürlich
auch mehrere dieser „unterseeiſchen Arbeiter" zu gleicher Zeit
in Thätigkeit treten laſſen. Die Versuche, welche mit diesem
Apparat bei Choiſy le Roi in der Seine angestellt wurden,
ſind über Erwarten gut gelungen. Man sieht mit Spannung
den weiteren Verſuchen in Havre, wo er in einer Tiefe von
250 Meter, und auf der Reede von Brest, wo er 500 Meter
tief arbeiten ſoll, entgegen.
Der Beſuch des Königs von Siam bei dem
Fürſten Bismarck in Friedrichsruh.
(Siehe das Biid auf Seite 148.)
D? König von Siam ist auf seiner europäiſchen Rundreise
Ende Auguſt auch in Berlin und Potsdam gewesen, wo
er die Gastfreundschaft des deutschen Kaiſers genoß. Auf der
Weiterreiſe traf der oſtaſiatiſche Herrſcher mit seinem Gefolge
am 2. September um 2 Uhr 10 Minuten nachmittags von
Hamburg in Friedrichsruh ein, um dem Fürsten Bismarck
seinen Besuch zu machen (siehe unser Bild auf S.. 148).
Graf Ranßau nahm die Ankommenden in Empfang unn
führte ſie dem Fürſten zu, der gleich dem König und ſeinen
Begleitern in Zivilkleidung war. Außer dem König waren deſſen
beide Brüder, die Prinzen Svasti und Mahisara, ſowie die Herren
des königlichen Gefolges, Generaladjutant Phya Tejo, Lega-
tionsrat Phra Ratnakoſa und Kammerherr Mai Cha Yuat
erſchienen. Der Fürst führte den König und die beiden
Prinzen in den vor dem Speiſesaale liegenden Salon, dessen
Fenster Ausblick nach dem Park haben. Hier befanden ſich
noch die Gräfin Rantzau und die Nichte des Fürsten Bis-
marck, Frau v. Kotze, geb. v. Arnim. Es entspann sich nun
zwiſchen dem Fürsten und seinem königlichen Gaſte eine sehr
lebhafte, engliſch geführte Unterhaltung, an der hin und
wieder auch die Gräfin Rantzau teilnahm. Es wurden Zi-
garren und Zigaretten, sowie Thee und Cognac gereicht. Jm
Laufe der Unterhaltung erbat sich der König vom Fürsten
deſſen Porträt mit Unterschrift, worauf der Fürſt ſich Feder
und Tinte bringen ließ und seinen Namen auf eine Photo-
graphie ſchrieb. Diese stellte den Fürsten jedoch in Zivilklei-
dung dar, und die Wünſche des Königs gingen dahin, ein
Bildnis Bismarcks in Uniform zu erhalten. Er wählte dann
eine Photographie, die den Fürsten in General-Interimsuni-
| form und unbedeckten Hauptes zeigte. Einer der Begleiter
des Königs notierte beständig sehr eifrig in ein Miniatur-
taſchenbuch, was er vom Nebenzimmer aus von den Aus-
sprüchen des Fürſten Bismarck erhaſchen konnte. Als die
fahrplanmäßige Zeit zur Rückfahrt nach Hamburg gemeldet
wurde, erhob ſich die ganze Gesellſchaft und begab ſich vors
Haus. Hier erregte es das höchſte Ergößen des Königs,
als er sich vier thatbereiten Photographen gegenübersſah, und
er veranlaßte den Fürſten, der ebenfalls lachend die zum
Photographieren getroffenen Vorbereitungen muſterte, eine
Weile vor der Hausthür ſtehen zu bleiben, bis einige Gruppen-
aufnahmen gemacht waren. Dann ſchritt der Fürſt Arm in
Arm mit dem Könige, dessen ſchlanke Gestalt er um mehr
als Haupteslänge überragte, nach dem Bahngeleiſe, wo ein
zahlreiches Publikum die Ankommenden mit lauten Hurra-
rufen empfing. Noch war kein Zug zu sehen, und nach eingee..
Zeit des Wartens kam die Meldung, daß der Berliner Zug
11 Minuten Verſpätung habe. Sobald der König dies hörte,
bat er den Fürsten dringend, ſich nicht länger das ermüdende
Stehen zuzumuten, sondern wieder in den Park zurückzu-
kehren. Als der Fürst höflich abwehrte, legte König Tſchula-
longkorn schnell wieder seinen Arm in den Bismarcks und
zog ihn mit sanfter Gewalt nach dem Portierhäuschen hin.
Aus diesem wurden dann vier Stühle geholt, worauf sich der
König, der Fürſt, die Gräfin Rantzau und Frau v. Kotze
dicht hinter dem Gitter des Eingangsthores niederließen.
Als der Zug endlich ankam, begleitete Fürſt Bismarck seine
Gäſle nochmals bis ans Geleiſe. Der König verabschiedete
sich mit herzlichen Worten, . beſtieg den Salonwagen und
winkte dann vom Fenster aus Grüße zu, während der zug
davonfuhr. Als die Passagiere des vorbeirollenden Zuges
den Fürſten dicht vor ſich am Eisenbahngeleiſe stehen sahen,
mischten sich ihre Hurras in die Rufe des den Fürsten um-
gebenden Publikums, und flatternde Tücher aus allen Fenſtern
des Zuges winkten dem greiſen Schloßherrn so lange Grüße
zu, wie der Zug dem Auge der am Wege Stehenden ſicht-
bar blieb. t . :