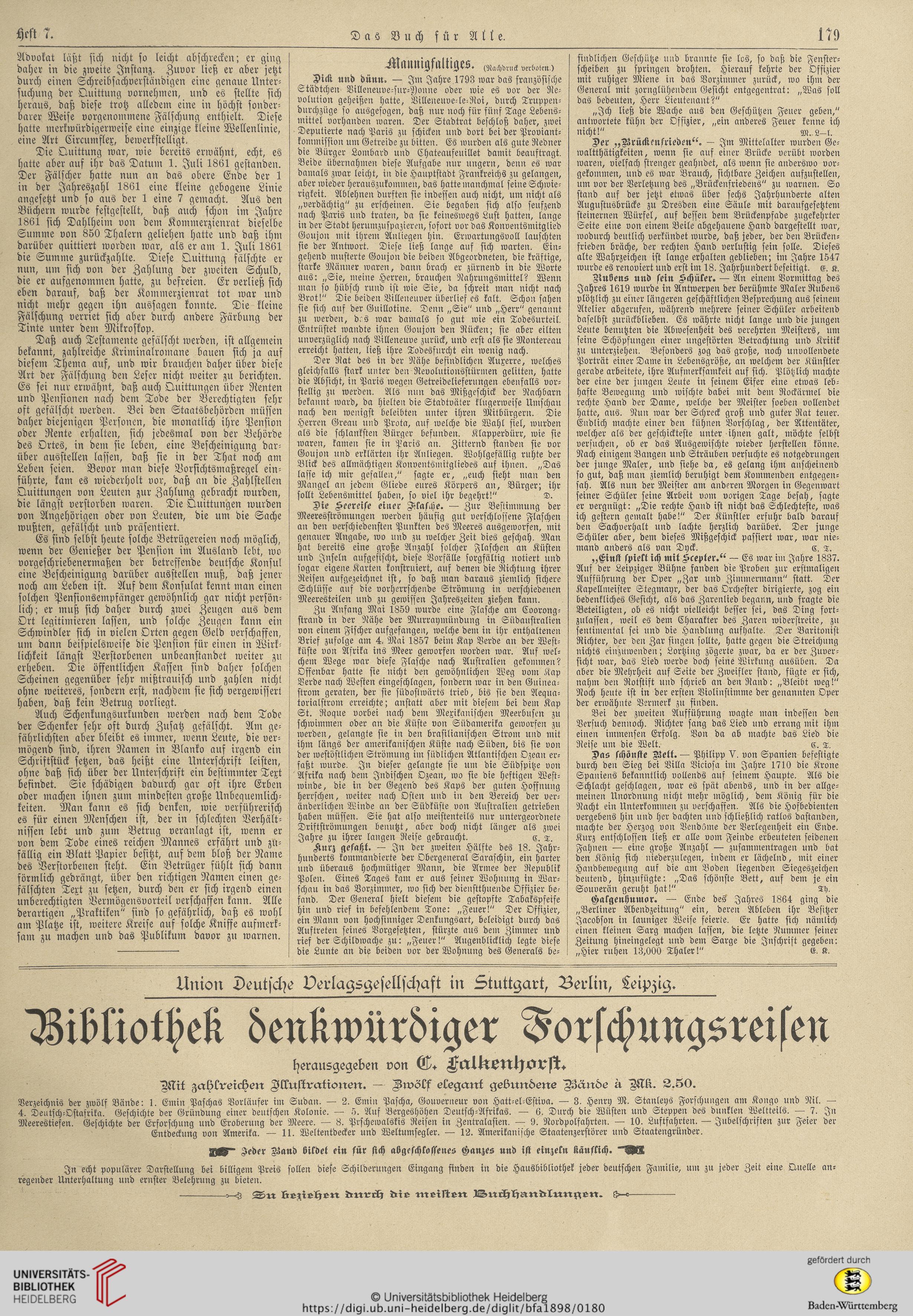die Summe zurückzahlte.
Heft. 7.
Das Buch für Alte.
179
Advokat läßt ſich nicht so leicht abſchrecken; er ging
daher in die zweite Instanz. Zuvor ließ er aber jett
durch einen Schreibſachverſtändigen eine genaue Unter-
ſuchung der Quittung vornehmen, und es ſtellte ſich
heraus, daß dieſe troß alledem eine in höchſt ſonder-
barer Weiſe vorgenommene Fälſchung enthielt. Diese
hatte merkwürdigerweiſe eine einzige kleine Wellenlinie,
eine Art Circumflex, bewerkstelligt.
Die Quittung war, wie bereits erwähnt, echt, es
hatte aber auf ihr das Datum 1. Juli 1861 gestanden.
Der Fälſcher hatte nun an das obere Ende der 1
in der Jahreszahl 1861 eine kleine gebogene Linie
qu. yl que ver.! Fire l qemuht Aug zen
1861 ſich Dahlheim von dem Kommerzienrat dieselbe
Summe von 850 Thalern geliehen hatte und daß ihm
darüber quittiert worden war, als er am 1. Juli 1861
Diese Quittung fälſchte er
nun, um sich von der Zahlung der zweiten Schuld,
die er aufgenommen hatte, zu befreien. Er verließ ſich
eben darauf, daß der Kommerzienrat tot war und
nicht mehr gegen ihn ausſagen konnte. Die kleine
Fälſchung verriet ſich aber durch andere Färbung der
Tinte unter dem Mikroskop.
Daß auch Teſtamente gefälſcht werden, ist allgemein
bekannt, zahlreiche Kriminalromane bauen ſich ja auf
diesem Thema auf, und wir brauchen daher über diese
Art der Fälſchung den Leser nicht weiter zu berichten.
Es sei nur erwähnt, daß auch Quittungen über Renten
und Pensionen nach dem Tode der Berechtigten sehr
oft gefälſcht werden. Bei den Staatsbehörden müſsen
daher diejenigen Personen, die monatlich ihre Pension
oder Rente erhalten, sich jedesmal von der Behörde
des Ortes, in dem ſie leben, eine Beſcheinigung dar-
über ausſtellen laſſen, daß sie in der That noch am
Leben seien. Bevor man diese Vorsichtsmaßregel ein-
führte, kam es wiederholt vor, daß an die Zahlſtellen
Quittungen von Leuten zur Zahlung gebracht wurden,
die längſt verſtorben waren. Die Quittungen wurden
von Angehörigen oder von Leuten, die um die Sache
wußten, gefälſcht und präſentiert.
Es ſind ſelbſt heute ſolche Betrügereien noch möglich,
wenn der Genießer der Penſion im Ausland lebt, wo
tu . t rue Kerſa!
noch am s: if Auf dem Konſulat kennt man einen
solchen Pensionsempfänger gewöhnlich gar nicht persön-
lich; er muß sich daher durch zwei Zeugen aus dem
Ort legitimieren laſſen, und solche Zeugen kann ein
Schwindler sich in vielen Orten gegen Geld verschaffen,
um dann beiſpielsweiſe die Pension für einen in Wirk-
lichkeit längſt Verſtorbenen unbeanstandet weiter zu
erheben. Die öffentlichen Kassen sind daher solchen
Scheinen gegenüber sehr mißtrauiſch und zahlen nicht
ohne weiteres, sondern erſt, nachdem ſie ſich vergewissert
haben, daß kein Betrug vorliegt. .
Auch Schenkungsurkunden werden nach dem Tode
der Schenker sehr oft durch Zusatz gefälſcht. Am ge-
fährlichſten aber bleibt es immer, wenn Leute, die ver-
mögend ſind, ihren Namen in Blanko auf irgend ein
Schriftstück setzen, das heißt eine Unterschrift leisten,
ohne daß ſich über der Unterſchrift ein bestimmter Text
befindet. Sie schädigen dadurch gar oft ihre Erben
oder machen ihnen zum mindesten große Unbequemlich-
keiten. Man kann es sich denken, wie verführeriſch
es für einen Menſchen ist, der in ſchlechten Verhält-
niſſen lebt und zum Betrug veranlagt iſt, wenn er
von dem Tode eines reichen Mannes erfährt und zu-
fällig ein Blatt Papier besitt, auf dem bloß der Name
des Verstorbenen steht. Ein Betrüger fühlt ſich dann
förmlich gedrängt, über den richtigen Namen einen ge-
fälſchten Text zu setzen, durch den er sich irgend einen
unberechtigten Vermögensvorteil verſchaffen kann. Alle
derartigen „Praktiken“ sind so gefährlich, daß es wohl
am Plate iſt, weitere Kreiſe auf solche Kniffe aufmerk-
sam zu machen und das Publikum davor zu warnen.
Manunigfaltiges. (Nachdruck verboten.)
Dick und dünn. – Jm Jahre 1793 war das französiſche
Städtchen Villeneuve-sur-Yonne oder wie es vor der Re-
volution geheißen hatte, Villeneuve-le:Roi, durch Truppen-
durchzüge ſo ausgesogen, daß nur noch für fünf Tage Lebens-
mittel vorhanden waren. Der Stadtrat beschloß daher, zwei
. Deputierte nach Paris zu schicken und dort bei der Proviant-
kommission um Getreide zu bitten. Es wurden als gute Redner
die Bürger Lombard und Chateaufeuillet damit beauftragt.
Beide übernahmen diese Aufgabe nur ungern, denn es war
damals zwar leicht, in die Hauptstadt Frankreichs zu gelangen,
aber wieder herauszukommen, das hatte manchmal seine Schwie-
rigkeit. Ablehnen durften sie indessen auch nicht, um nicht als
„verdächtig“ zu erſcheinen. Sie begaben sich also seufzend
nach Paris und traten, da sie keineswegs Luſt hatten, lange
in der Stadt herumzuspazieren, sofort vor das Konventsmitglied
Goujon mit ihrem Anliegen hin. Erwartungsvoll lauſchten
ſie der Antwort. Diese ließ lange auf sich warten. Ein-
gehend muſterte Goujon die beiden Abgeordneten, die kräftige,
starke Männer waren, dann brach er zürnend in die Worte
aus: „Sie, meine Herren, brauchen Nahrungsmittel? Wenn
man so hübſch rund iſt wie Sie, da ſchreit man nicht nach
Brot!‘ Die beiden Villeneuver überlief es kalt. Schon sahen
sie sich auf der Guillotine. Denn „Sie" und „Herr“ genannt
zu werden, dcs war damals so gut wie ein Todesurteil.
Entrüſstet wandte ihnen Goujon den Rücken; sie aber eilten
unverzüglich nach Villeneuve zurück, und erst als ſie Montereau
erreicht hatten, ließ ihre Todesfurcht ein wenig nach.
Der Rat des in der Nähe befindlichen Auxerre, welches
gleichfalls stark unter den Revolutionsſstürmen gelitten, hatte
die Absicht, in Paris wegen Getreidelieferungen ebenfalls vor-
stellig zu werden. Als nun das Mißgeschick der Nachbarn
bekannt ward, da hielten die Stadtväter klugerweiſe Unmiſchau
nach den wenigst beleibten unter ihren Mitbürgern. Die
Herren Greau und Prota, auf welche die Wahl fiel, wurden
als die ſchlankſten Bürger befunden. Klapperdürr, wie sie
waren, kamen sie in Paris an. Zitternd standen sie vor
Goujon und erklärten ihr Anliegen. Wohlgefällig ruhte der
Blick des allmächtigen Konventsmitgliedes auf ihnen. „Das
laſſe ich mir gefallen,“ sagte er, „euch ſieht man den
Mangel an jedem Gliede eures Körpers an, Bürger; ihr
sollt Lebensmittel haben, so viel ihr begehrt!" : - D.
Die Seereiſe einer Iilkaſcje. – Zur Bestimmung der
Meeresſtrömungen werden häufig gut versſchloſſene Flaschen
an den versſchiedenſten Punkten des Meeres ausgeworfen, mit
genauer Angabe, wo und zu welcher Zeit dies geſchah. Man
hat bereits eine große Anzahl solcher Flaschen an Küſten
und Inseln aufgefiſcht, diese Vorfälle sorgfältig notiert und
sogar eigene Karten konstruiert, auf denen die Richtung ihrer
Reisen aufgezeichnet iſt, so daß man daraus ziemlich sichere
Schlüsse auf die vorherrſchende Strömung in verschiedenen
Meeresteilen und zu gewissen Jahreszeiten ziehen kann.
î Hu Anfang Mai 1859 wurde eine Flaſche am Coorong-
strand in der Nähe der Murraymündung in Südauſtralien
von einem Fiſcher aufgefangen, welche dem in ihr enthaltenen
Brief zufolge am 4. Mai 1857 beim Kap Verde an der Weſt-
küste von Afrika ins Meer geworfen worden war. Auf wel-
<em Wege war diese Flaſche nach Auſtralien gekommen ?
Offenbar hatte ſie nicht den gewöhnlichen Weg vom Kap
Verde nach Westen eingeschlagen, sondern war in den Guinea
strom geraten, der ſie ſüdoſlwärts trieb, bis ſie den Aequa-
torialſtrom erreichte; anstatt aber mit diesem bei dem Kap
St. Roque vorbei nach dem Mexikaniſchen Meerbusen zu
schwimmen oder an die Küste von Südamerika geworfen zu
werden, gelangte sie in den brasilianiſchen Strom und mit
ihm längs der amerikaniſchen Küſte nach Süden, bis sie von
der weſstöſtlichen Strömung im südlichen Atlantischen Ozean er-
faßt wurde. In dieser gelangte ſie um die Südspitze von
Afrika nach dem Indischen Ozean, wo ſie die heftigen Weſt-
winde, die in der Gegend des Kaps der guten Hoffnung
herrſchen, weiter nach Osten und in den Bereich der ver-
änderlichen Winde an der Südküſte von Auſtralien getrieben
haben müssen. Sie hat also meiſtenteils nur untergeordnete
Driftsſtrömungen benutzt, aber doch nicht länger als zwei
Jahre zu ihrer langen Reise gebraucht. C. T.
Kurz gefaßt. ~ In der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts kommandierte der Obergeneral Saraſschin, ein harter
und überaus hochmütiger Mann, die Armee der Republik
Polen. Eines Tages kam er aus seiner Wohnung in War-
schau in das Vorzimmer, wo ſich der dienſtthuende Offizier be-
fand. Der General hielt dieſem die gestopfte Tabakspfeife
hin und rief in befehlendem Tone: „Jeuer!‘ Der Offizier,
ein Mann von hochſinniger Denkungsart, beleidigt durch das
Auftreten ſeines Vorgesetzten, stürzte aus dem Zimmer und
rief der Schildwache zu: „Feuer!“ Augenblicklich legte diese
die Lunte an die beiden vor der Wohnung des Generals be-
findlichen Geschüt)e und brannte sie los, so daß die Fenster-
ſcheiben zu springen drohten. Hierauf kehrte der Offizier
mit ruhiger Miene in das Vorzimmer zurück, wo ihm der
General mit zornglühendem Gesicht entgegentrat: „Was soll
das bedeuten, Herr Lieutenant?"
„Ich ließ die Wache aus den Geschüßen Feuer geben,"
antwortete kühn der Offizier, „ein anderes Feuer kenne ich
nicht!“ M.. L-l.
W. „„Brückeufrieden®. ~ Im Mittelalter wurden Ge-
waltthätigkeiten, wenn sie auf. einer Brücke verübt worden
waren, vielfach strenger geahndet, als wenn sie anderswo vor-
gekommen, und es war Brauch, sichtbare Zeichen aufzuſtellen,
um vor der Verletzung des „Brückenfriedens" zu warnen. So
stand auf der jet etwas über sechs Jahrhunderte alten
Auguſstusbrücke zu Dresden eine Säule mit daraufgesetttem
steinernen Würfel, auf deſſen dem Brückenpfade zugekehrter
Seite eine von einem Beile abgehauene Hand dargestellt war,
wodurch deutlich verkündet wurde, daß jeder, der den Brücken-
frieden bräche, der rechten Hand verluſtig sein solle. Dieses
alte Wahrzeichen ist lange erhalten geblieben; im Jahre 1547
wurde es renoviert und erſt im 18. Jahrhundert beseitigt. €. K.
Rubens und ſein Schüler. – An einem Vormittag des
Jahres 1619 wurde in Antwerpen der berühmte Maler Rubens
plötzlich zu einer längeren geschäftlichen Besprechung aus seinem
Atelier abgerufen, während mehrere seiner Schüler arbeitend
daſelbſt zurückblieben. Es währte nicht lange und die jungen
Leute benutzten die Abwesenheit des verehrten Meisters, um
seine Schöpfungen einer ungestörten Betrachtung und Kritik
zu unterziehen. Besonders zog das große, noch unvollendete
Porträt einer Dame in Lebensgröße, an welchem der Künſtler
gerade arbeitete, ihre Aufmerksamkeit auf sich. Plötzlich machte
der eine der jungen Leute in seinem Eifer eine etwas leb-
hafte Bewegung und wiſchte dabei mit dem Rockärmel die
rechte Hand der Dame, welche der Meister soeben vollendet
hatte, aus. Nun war der Schreck groß und guter Rat teuer.
Endlich machte einer den kühnen Vorschlag, der Attentäter,
welcher als der geschickteſte unter ihnen galt, möchte selbst
verſuchen, ob er das Ausgewiſschte wieder herſtellen könne.
Nach einigem Bangen und Sträuben versuchte es notgedrungen
der junge Maler, und siehe da, es gelang ihm anſcheinend
so gut, daß man ziemlich beruhigt dem Kommenden entgegen-
sah. Als nun der Meister am anderen Morgen in Gegenwart
seiner Schüler seine Arbeit vom vorigen Tage besah, ſagte
er vergnügt: „Die rechte Hand ist nicht das Schlechteste, was
U LLL Est R E Bs
Schüler aber, dem dieses Mißgeschick paſſiert war, war nie-
mand anders als van Dyck. § . C. T.
Auf Lr ſoictt . huits jetter: die fs tar in Jahre 1197
Aufführung der Oper „Zar und Zimmermann“ statt. Der
Kapellmeister Stegmayr, der das Orchester dirigierte, zog ein
. ) bedenkliches Gesicht, als das Zarenlied begann, und fragte die
Beteiligten, ob es nicht vielleicht besser sei, das Ding fort-
zulassen, weil es dem Charakter des Zaren widerstreite, zu
sentimental sei und die Handlung aufhalte. Der Baritoniſt
Richter, der den Zar ſingen sollte, hatte gegen die Streichung
nichts einzuwenden; Lortzing zögerte zwar, da er der Zuver-
sicht war, das Lied werde doch seiné Wirkung ausüben. Da
aber die Mehrheit auf Seite der Zweifler stand, fügte er sich,
nahm den Rotstift und schrieb an den Rand: „Bleibt weg!"
Noch heute ist in der erſten Violinſtimme der genannten Oper
der erwähnte Vermerk zu finden.
Bei der zweiten Aufführung wagte man indessen den
Versuch dennoch. Richter sang das Lied und errang mit ihm
einen immensen Erfolg. Von da ab machte das Lied die
Reise um die Welt. E. T.
Das ſchönsſte Wett. + Philipp V. von Spanien befestigte
durch den Sieg bei Villa Vicioſa im Jahre 1710 die Krone
Spaniens bekanntlich vollends auf seinem Haupte. Als die
Schlacht geschlagen, war es spät abends, und in der allge-
meinen Unordnung nicht mehr möglich, dem König für die
Nacht ein Unterkommen zu verſchaffen. Als die Hofbedienten
vergebens hin und her dachten und ſchließlich ratlos daſtanden,
machte der Herzog von Vendôme der Verlegenheit ein Ende.
Kurz entſchloſſen ließ er alle vom Feinde erbeuteten seidenen
Fahnen ~ eine große Anzahl ~ zuſammentragen und bat
den König sich niederzulegen, indem er lächelnd, mit einer
Handbewegung auf die am Boden liegenden Siegeszeichen
deutend, hinzufügte: „Das ſchönste Bett, auf dem je ein
Souverän geruht hat.!" Th.
Galgenhumore. –~ Ende des Jahres 1864 ging die
„Berliner Abendzeitung“ ein, deren Ableben ihr Beſsitzer
Jacobson in launiger Weise feierte. Er hatte sich nämlich
einen kleinen Sarg machen lassen, die letzte Nummer seiner
Zeitung hineingelegt und dem Sarge die Inſchrift gegeben:
„Hier ruhen 13,000 Thaler !" E. K.
Union Deutſche Verlagsgeſellſchaft in Stuttgart, Berlin, Leipzig.
Bibliothek denkwürdiger JForſchungsreiſen
herausgegeben von C. Lalkenhorſt.
Mit zablkreichen Illuſtrationen. + Zwölf elegant gebundene 2ände a MK. 2.50.
Verzeichnis der zwölf Bände: 1. Emin Paſchas Vorläufer im Sudan. — 2. Emin Paſcha, Gouverneur von Hatt-el-Eſtiva. – 3. Henry M. Stanleys Forschungen am Kongo und Nil. +
. Deutsſch-Ostafrika. Geschichte der Gründung einer deutschen Kolonie. ~ 5. Auf Bergeshöhen Deutsſch-Afrikas. ~ 6. Durch die Wüſten und Steppen des dunklen Weltteils. – 7. In
Meerestiefen. Geſchichte der Erforschung und Eroberung der Meere. + 8. Prſchewalskis Reiſen in gentralaſien. - 9. Nordpolfahrten. ~ 10. Luftfahrten. ~ Jubelschriften zur Feier der
! Entdeckung von Amerika. + 11. Weltentdecker und Weltumſegler. ~ 12. Amerikaniſche Staatenzerſtörer und Staatengründer.
: M Ieder Wand bildet ein für ſich abgeſchkoſſenes Ganzes und iſt einzeln käuflich. “M |
In echt populärer Darſtellung bei billigem Preis sollen diese Schilderungen Eingang finden in die Hausbibliothek jeder deutschen Familie, um zu jeder Zeit eine Quelle an-
; regender Unterhaltung und ernster Belehrung zu bieten.
3 Zu beziehen Durch die meiſten 2uchhandlungen. -
Heft. 7.
Das Buch für Alte.
179
Advokat läßt ſich nicht so leicht abſchrecken; er ging
daher in die zweite Instanz. Zuvor ließ er aber jett
durch einen Schreibſachverſtändigen eine genaue Unter-
ſuchung der Quittung vornehmen, und es ſtellte ſich
heraus, daß dieſe troß alledem eine in höchſt ſonder-
barer Weiſe vorgenommene Fälſchung enthielt. Diese
hatte merkwürdigerweiſe eine einzige kleine Wellenlinie,
eine Art Circumflex, bewerkstelligt.
Die Quittung war, wie bereits erwähnt, echt, es
hatte aber auf ihr das Datum 1. Juli 1861 gestanden.
Der Fälſcher hatte nun an das obere Ende der 1
in der Jahreszahl 1861 eine kleine gebogene Linie
qu. yl que ver.! Fire l qemuht Aug zen
1861 ſich Dahlheim von dem Kommerzienrat dieselbe
Summe von 850 Thalern geliehen hatte und daß ihm
darüber quittiert worden war, als er am 1. Juli 1861
Diese Quittung fälſchte er
nun, um sich von der Zahlung der zweiten Schuld,
die er aufgenommen hatte, zu befreien. Er verließ ſich
eben darauf, daß der Kommerzienrat tot war und
nicht mehr gegen ihn ausſagen konnte. Die kleine
Fälſchung verriet ſich aber durch andere Färbung der
Tinte unter dem Mikroskop.
Daß auch Teſtamente gefälſcht werden, ist allgemein
bekannt, zahlreiche Kriminalromane bauen ſich ja auf
diesem Thema auf, und wir brauchen daher über diese
Art der Fälſchung den Leser nicht weiter zu berichten.
Es sei nur erwähnt, daß auch Quittungen über Renten
und Pensionen nach dem Tode der Berechtigten sehr
oft gefälſcht werden. Bei den Staatsbehörden müſsen
daher diejenigen Personen, die monatlich ihre Pension
oder Rente erhalten, sich jedesmal von der Behörde
des Ortes, in dem ſie leben, eine Beſcheinigung dar-
über ausſtellen laſſen, daß sie in der That noch am
Leben seien. Bevor man diese Vorsichtsmaßregel ein-
führte, kam es wiederholt vor, daß an die Zahlſtellen
Quittungen von Leuten zur Zahlung gebracht wurden,
die längſt verſtorben waren. Die Quittungen wurden
von Angehörigen oder von Leuten, die um die Sache
wußten, gefälſcht und präſentiert.
Es ſind ſelbſt heute ſolche Betrügereien noch möglich,
wenn der Genießer der Penſion im Ausland lebt, wo
tu . t rue Kerſa!
noch am s: if Auf dem Konſulat kennt man einen
solchen Pensionsempfänger gewöhnlich gar nicht persön-
lich; er muß sich daher durch zwei Zeugen aus dem
Ort legitimieren laſſen, und solche Zeugen kann ein
Schwindler sich in vielen Orten gegen Geld verschaffen,
um dann beiſpielsweiſe die Pension für einen in Wirk-
lichkeit längſt Verſtorbenen unbeanstandet weiter zu
erheben. Die öffentlichen Kassen sind daher solchen
Scheinen gegenüber sehr mißtrauiſch und zahlen nicht
ohne weiteres, sondern erſt, nachdem ſie ſich vergewissert
haben, daß kein Betrug vorliegt. .
Auch Schenkungsurkunden werden nach dem Tode
der Schenker sehr oft durch Zusatz gefälſcht. Am ge-
fährlichſten aber bleibt es immer, wenn Leute, die ver-
mögend ſind, ihren Namen in Blanko auf irgend ein
Schriftstück setzen, das heißt eine Unterschrift leisten,
ohne daß ſich über der Unterſchrift ein bestimmter Text
befindet. Sie schädigen dadurch gar oft ihre Erben
oder machen ihnen zum mindesten große Unbequemlich-
keiten. Man kann es sich denken, wie verführeriſch
es für einen Menſchen ist, der in ſchlechten Verhält-
niſſen lebt und zum Betrug veranlagt iſt, wenn er
von dem Tode eines reichen Mannes erfährt und zu-
fällig ein Blatt Papier besitt, auf dem bloß der Name
des Verstorbenen steht. Ein Betrüger fühlt ſich dann
förmlich gedrängt, über den richtigen Namen einen ge-
fälſchten Text zu setzen, durch den er sich irgend einen
unberechtigten Vermögensvorteil verſchaffen kann. Alle
derartigen „Praktiken“ sind so gefährlich, daß es wohl
am Plate iſt, weitere Kreiſe auf solche Kniffe aufmerk-
sam zu machen und das Publikum davor zu warnen.
Manunigfaltiges. (Nachdruck verboten.)
Dick und dünn. – Jm Jahre 1793 war das französiſche
Städtchen Villeneuve-sur-Yonne oder wie es vor der Re-
volution geheißen hatte, Villeneuve-le:Roi, durch Truppen-
durchzüge ſo ausgesogen, daß nur noch für fünf Tage Lebens-
mittel vorhanden waren. Der Stadtrat beschloß daher, zwei
. Deputierte nach Paris zu schicken und dort bei der Proviant-
kommission um Getreide zu bitten. Es wurden als gute Redner
die Bürger Lombard und Chateaufeuillet damit beauftragt.
Beide übernahmen diese Aufgabe nur ungern, denn es war
damals zwar leicht, in die Hauptstadt Frankreichs zu gelangen,
aber wieder herauszukommen, das hatte manchmal seine Schwie-
rigkeit. Ablehnen durften sie indessen auch nicht, um nicht als
„verdächtig“ zu erſcheinen. Sie begaben sich also seufzend
nach Paris und traten, da sie keineswegs Luſt hatten, lange
in der Stadt herumzuspazieren, sofort vor das Konventsmitglied
Goujon mit ihrem Anliegen hin. Erwartungsvoll lauſchten
ſie der Antwort. Diese ließ lange auf sich warten. Ein-
gehend muſterte Goujon die beiden Abgeordneten, die kräftige,
starke Männer waren, dann brach er zürnend in die Worte
aus: „Sie, meine Herren, brauchen Nahrungsmittel? Wenn
man so hübſch rund iſt wie Sie, da ſchreit man nicht nach
Brot!‘ Die beiden Villeneuver überlief es kalt. Schon sahen
sie sich auf der Guillotine. Denn „Sie" und „Herr“ genannt
zu werden, dcs war damals so gut wie ein Todesurteil.
Entrüſstet wandte ihnen Goujon den Rücken; sie aber eilten
unverzüglich nach Villeneuve zurück, und erst als ſie Montereau
erreicht hatten, ließ ihre Todesfurcht ein wenig nach.
Der Rat des in der Nähe befindlichen Auxerre, welches
gleichfalls stark unter den Revolutionsſstürmen gelitten, hatte
die Absicht, in Paris wegen Getreidelieferungen ebenfalls vor-
stellig zu werden. Als nun das Mißgeschick der Nachbarn
bekannt ward, da hielten die Stadtväter klugerweiſe Unmiſchau
nach den wenigst beleibten unter ihren Mitbürgern. Die
Herren Greau und Prota, auf welche die Wahl fiel, wurden
als die ſchlankſten Bürger befunden. Klapperdürr, wie sie
waren, kamen sie in Paris an. Zitternd standen sie vor
Goujon und erklärten ihr Anliegen. Wohlgefällig ruhte der
Blick des allmächtigen Konventsmitgliedes auf ihnen. „Das
laſſe ich mir gefallen,“ sagte er, „euch ſieht man den
Mangel an jedem Gliede eures Körpers an, Bürger; ihr
sollt Lebensmittel haben, so viel ihr begehrt!" : - D.
Die Seereiſe einer Iilkaſcje. – Zur Bestimmung der
Meeresſtrömungen werden häufig gut versſchloſſene Flaschen
an den versſchiedenſten Punkten des Meeres ausgeworfen, mit
genauer Angabe, wo und zu welcher Zeit dies geſchah. Man
hat bereits eine große Anzahl solcher Flaschen an Küſten
und Inseln aufgefiſcht, diese Vorfälle sorgfältig notiert und
sogar eigene Karten konstruiert, auf denen die Richtung ihrer
Reisen aufgezeichnet iſt, so daß man daraus ziemlich sichere
Schlüsse auf die vorherrſchende Strömung in verschiedenen
Meeresteilen und zu gewissen Jahreszeiten ziehen kann.
î Hu Anfang Mai 1859 wurde eine Flaſche am Coorong-
strand in der Nähe der Murraymündung in Südauſtralien
von einem Fiſcher aufgefangen, welche dem in ihr enthaltenen
Brief zufolge am 4. Mai 1857 beim Kap Verde an der Weſt-
küste von Afrika ins Meer geworfen worden war. Auf wel-
<em Wege war diese Flaſche nach Auſtralien gekommen ?
Offenbar hatte ſie nicht den gewöhnlichen Weg vom Kap
Verde nach Westen eingeschlagen, sondern war in den Guinea
strom geraten, der ſie ſüdoſlwärts trieb, bis ſie den Aequa-
torialſtrom erreichte; anstatt aber mit diesem bei dem Kap
St. Roque vorbei nach dem Mexikaniſchen Meerbusen zu
schwimmen oder an die Küste von Südamerika geworfen zu
werden, gelangte sie in den brasilianiſchen Strom und mit
ihm längs der amerikaniſchen Küſte nach Süden, bis sie von
der weſstöſtlichen Strömung im südlichen Atlantischen Ozean er-
faßt wurde. In dieser gelangte ſie um die Südspitze von
Afrika nach dem Indischen Ozean, wo ſie die heftigen Weſt-
winde, die in der Gegend des Kaps der guten Hoffnung
herrſchen, weiter nach Osten und in den Bereich der ver-
änderlichen Winde an der Südküſte von Auſtralien getrieben
haben müssen. Sie hat also meiſtenteils nur untergeordnete
Driftsſtrömungen benutzt, aber doch nicht länger als zwei
Jahre zu ihrer langen Reise gebraucht. C. T.
Kurz gefaßt. ~ In der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts kommandierte der Obergeneral Saraſschin, ein harter
und überaus hochmütiger Mann, die Armee der Republik
Polen. Eines Tages kam er aus seiner Wohnung in War-
schau in das Vorzimmer, wo ſich der dienſtthuende Offizier be-
fand. Der General hielt dieſem die gestopfte Tabakspfeife
hin und rief in befehlendem Tone: „Jeuer!‘ Der Offizier,
ein Mann von hochſinniger Denkungsart, beleidigt durch das
Auftreten ſeines Vorgesetzten, stürzte aus dem Zimmer und
rief der Schildwache zu: „Feuer!“ Augenblicklich legte diese
die Lunte an die beiden vor der Wohnung des Generals be-
findlichen Geschüt)e und brannte sie los, so daß die Fenster-
ſcheiben zu springen drohten. Hierauf kehrte der Offizier
mit ruhiger Miene in das Vorzimmer zurück, wo ihm der
General mit zornglühendem Gesicht entgegentrat: „Was soll
das bedeuten, Herr Lieutenant?"
„Ich ließ die Wache aus den Geschüßen Feuer geben,"
antwortete kühn der Offizier, „ein anderes Feuer kenne ich
nicht!“ M.. L-l.
W. „„Brückeufrieden®. ~ Im Mittelalter wurden Ge-
waltthätigkeiten, wenn sie auf. einer Brücke verübt worden
waren, vielfach strenger geahndet, als wenn sie anderswo vor-
gekommen, und es war Brauch, sichtbare Zeichen aufzuſtellen,
um vor der Verletzung des „Brückenfriedens" zu warnen. So
stand auf der jet etwas über sechs Jahrhunderte alten
Auguſstusbrücke zu Dresden eine Säule mit daraufgesetttem
steinernen Würfel, auf deſſen dem Brückenpfade zugekehrter
Seite eine von einem Beile abgehauene Hand dargestellt war,
wodurch deutlich verkündet wurde, daß jeder, der den Brücken-
frieden bräche, der rechten Hand verluſtig sein solle. Dieses
alte Wahrzeichen ist lange erhalten geblieben; im Jahre 1547
wurde es renoviert und erſt im 18. Jahrhundert beseitigt. €. K.
Rubens und ſein Schüler. – An einem Vormittag des
Jahres 1619 wurde in Antwerpen der berühmte Maler Rubens
plötzlich zu einer längeren geschäftlichen Besprechung aus seinem
Atelier abgerufen, während mehrere seiner Schüler arbeitend
daſelbſt zurückblieben. Es währte nicht lange und die jungen
Leute benutzten die Abwesenheit des verehrten Meisters, um
seine Schöpfungen einer ungestörten Betrachtung und Kritik
zu unterziehen. Besonders zog das große, noch unvollendete
Porträt einer Dame in Lebensgröße, an welchem der Künſtler
gerade arbeitete, ihre Aufmerksamkeit auf sich. Plötzlich machte
der eine der jungen Leute in seinem Eifer eine etwas leb-
hafte Bewegung und wiſchte dabei mit dem Rockärmel die
rechte Hand der Dame, welche der Meister soeben vollendet
hatte, aus. Nun war der Schreck groß und guter Rat teuer.
Endlich machte einer den kühnen Vorschlag, der Attentäter,
welcher als der geschickteſte unter ihnen galt, möchte selbst
verſuchen, ob er das Ausgewiſschte wieder herſtellen könne.
Nach einigem Bangen und Sträuben versuchte es notgedrungen
der junge Maler, und siehe da, es gelang ihm anſcheinend
so gut, daß man ziemlich beruhigt dem Kommenden entgegen-
sah. Als nun der Meister am anderen Morgen in Gegenwart
seiner Schüler seine Arbeit vom vorigen Tage besah, ſagte
er vergnügt: „Die rechte Hand ist nicht das Schlechteste, was
U LLL Est R E Bs
Schüler aber, dem dieses Mißgeschick paſſiert war, war nie-
mand anders als van Dyck. § . C. T.
Auf Lr ſoictt . huits jetter: die fs tar in Jahre 1197
Aufführung der Oper „Zar und Zimmermann“ statt. Der
Kapellmeister Stegmayr, der das Orchester dirigierte, zog ein
. ) bedenkliches Gesicht, als das Zarenlied begann, und fragte die
Beteiligten, ob es nicht vielleicht besser sei, das Ding fort-
zulassen, weil es dem Charakter des Zaren widerstreite, zu
sentimental sei und die Handlung aufhalte. Der Baritoniſt
Richter, der den Zar ſingen sollte, hatte gegen die Streichung
nichts einzuwenden; Lortzing zögerte zwar, da er der Zuver-
sicht war, das Lied werde doch seiné Wirkung ausüben. Da
aber die Mehrheit auf Seite der Zweifler stand, fügte er sich,
nahm den Rotstift und schrieb an den Rand: „Bleibt weg!"
Noch heute ist in der erſten Violinſtimme der genannten Oper
der erwähnte Vermerk zu finden.
Bei der zweiten Aufführung wagte man indessen den
Versuch dennoch. Richter sang das Lied und errang mit ihm
einen immensen Erfolg. Von da ab machte das Lied die
Reise um die Welt. E. T.
Das ſchönsſte Wett. + Philipp V. von Spanien befestigte
durch den Sieg bei Villa Vicioſa im Jahre 1710 die Krone
Spaniens bekanntlich vollends auf seinem Haupte. Als die
Schlacht geschlagen, war es spät abends, und in der allge-
meinen Unordnung nicht mehr möglich, dem König für die
Nacht ein Unterkommen zu verſchaffen. Als die Hofbedienten
vergebens hin und her dachten und ſchließlich ratlos daſtanden,
machte der Herzog von Vendôme der Verlegenheit ein Ende.
Kurz entſchloſſen ließ er alle vom Feinde erbeuteten seidenen
Fahnen ~ eine große Anzahl ~ zuſammentragen und bat
den König sich niederzulegen, indem er lächelnd, mit einer
Handbewegung auf die am Boden liegenden Siegeszeichen
deutend, hinzufügte: „Das ſchönste Bett, auf dem je ein
Souverän geruht hat.!" Th.
Galgenhumore. –~ Ende des Jahres 1864 ging die
„Berliner Abendzeitung“ ein, deren Ableben ihr Beſsitzer
Jacobson in launiger Weise feierte. Er hatte sich nämlich
einen kleinen Sarg machen lassen, die letzte Nummer seiner
Zeitung hineingelegt und dem Sarge die Inſchrift gegeben:
„Hier ruhen 13,000 Thaler !" E. K.
Union Deutſche Verlagsgeſellſchaft in Stuttgart, Berlin, Leipzig.
Bibliothek denkwürdiger JForſchungsreiſen
herausgegeben von C. Lalkenhorſt.
Mit zablkreichen Illuſtrationen. + Zwölf elegant gebundene 2ände a MK. 2.50.
Verzeichnis der zwölf Bände: 1. Emin Paſchas Vorläufer im Sudan. — 2. Emin Paſcha, Gouverneur von Hatt-el-Eſtiva. – 3. Henry M. Stanleys Forschungen am Kongo und Nil. +
. Deutsſch-Ostafrika. Geschichte der Gründung einer deutschen Kolonie. ~ 5. Auf Bergeshöhen Deutsſch-Afrikas. ~ 6. Durch die Wüſten und Steppen des dunklen Weltteils. – 7. In
Meerestiefen. Geſchichte der Erforschung und Eroberung der Meere. + 8. Prſchewalskis Reiſen in gentralaſien. - 9. Nordpolfahrten. ~ 10. Luftfahrten. ~ Jubelschriften zur Feier der
! Entdeckung von Amerika. + 11. Weltentdecker und Weltumſegler. ~ 12. Amerikaniſche Staatenzerſtörer und Staatengründer.
: M Ieder Wand bildet ein für ſich abgeſchkoſſenes Ganzes und iſt einzeln käuflich. “M |
In echt populärer Darſtellung bei billigem Preis sollen diese Schilderungen Eingang finden in die Hausbibliothek jeder deutschen Familie, um zu jeder Zeit eine Quelle an-
; regender Unterhaltung und ernster Belehrung zu bieten.
3 Zu beziehen Durch die meiſten 2uchhandlungen. -