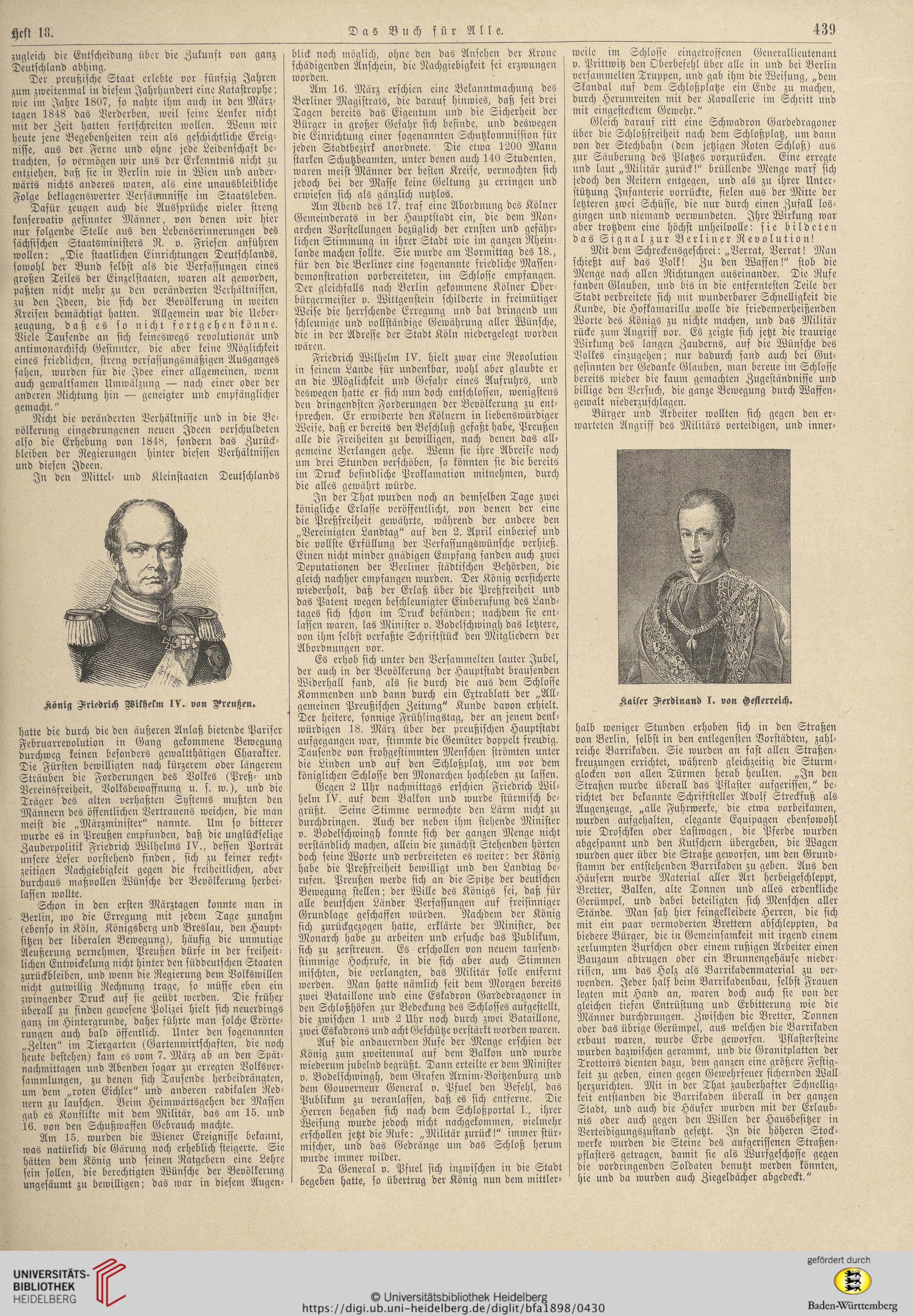Heft 18.
zugleich die Entscheidung über die Zukunft von ganz
Deutſchland abhing.
Der preußiſche Staat erlebte vor fünfzig Jahren
zum zweitenmal in diesem Jahrhundert eine Kataſtrophe;
wie im Jahre 1807, ſo nahte ihm auch in den März-
tagen 1848 das Verderben, weil seine Lenker nicht
mit der Zeit hatten fortſchreiten wollen. Wenn wir
heute jene Begebenheiten rein als geschichtliche Ereig-
niſſe, aus der Ferne und ohne jede Leidenſchaft be-
trachten, ſo vermögen wir uns der Erkenntnis nicht zu
entziehen, daß sie in Berlin wie in Wien und ander-
wärts nichts anderes waren, als eine unausbleibliche
Folge betlagenswerter Verſäumniſſe im Staatsleben.
Dafür zeugen auch die Ausſprüche vieler ſtreng
konservativ geſinnter Männer, von denen wir hier
nur folgende Stelle aus den Lebenserinnerungen des
ſächſiſchen Staatsministers R. v. Friesen anführen
wollen: „Die ſstaatlichen Einrichtungen Deutschlands,
ſowohl der Bund ſelbſt als die Verfaſſungen eines
großen Teiles der Einzelſtaaten, waren alt geworden,
paßten nicht mehr zu den veränderten Verhältniſsen,
zu den Ideen, die sich der Bevölkerung in weiten
Kreiſen bemächtigt hatten. Allgemein war die Ueber-
zeugung, daß es ſo nicht fortgehen könne.
Viele Tauſende an ſich keineswegs revolutionär und
antimonarchiſch Geſinnter, die aber keine Möglichkeit
eines friedlichen, streng verfaſſungsmäßigen Ausganges
ſahen, wurden für die Idee einer allgemeinen, wenn
auch gewaltſamen Umwälzung = nach einer oder der
Uztren Richtung hin = geneigter und empfänglicher
emacht. Ü
§ Nicht die veränderten Verhältniſſe und in die Be-
völkerung eingedrungenen neuen Ideen verſchuldeten
also die Erhebung von 1848, sondern das Zurück-
bleiben der Regierungen hinter dieſen Verhältnissen
und dieſen Ideen.
In den Mittel- und Kleinstaaten Deutſchlands
Hönig Friedrich Vilhekm IV. von Preußen.
hatte die durch die den äußeren Anlaß bietende Pariser
Februarrevolution in Gang gekommene Bewegung
durchweg keinen besonders gewaltthätigen Charakter.
Die Fürsten bewilligten nach kürzerem oder längerem
Sträuben die Forderungen des Volkes (Preß- und
Vereinsfreiheit, Volksbewaffnung u. ſ. w.), und die
Träger des alten verhaßten Syſtems mußten den
Männern des öffentlichen Vertrauens weichen, die man
meiſt die „Märzminiſter“ nannte. Um ſo bitterer
wurde es in Preußen empfunden, daß die unglückselige
gZauderpolitik Friedrich Wilhelms IV., deſſen Porträt
unsere Leser vorſtehend finden, ſich zu keiner recht-
zeitigen Nachgiebigkeit gegen die freiheitlichen, aber
durchaus maßvollen Wünſche der Bevölkerung herbei-
_ daſſen wollte.
Schon in den erſten Märztagen konnte man in
_ Berlin, wo die Erregung mit jedem Tage zunahm
(ebenſo in Köln, Königsberg und Breslau, den Haupt-
ſitzen der liberalen Bewegung), häufig die unmutige
Aeuußerung vernehmen, Preußen dürfe in der freiheit-
lichen Entwickelung nicht hinter den ſüddeutſchen Staaten
zurückbleiben, und wenn die Regierung dem Volkswillen
nicht gutwillig Rechnung trage, sſo müſſe eben ein
| zwingender Druck auf sie geübt werden. Die früher
: überall zu finden geweſene Polizei hielt ſich neuerdings
ganz im Hintergrunde, daher führte man ſolche Erörte-
rungen auch bald öffentlich. Unter den sogenannten
„Zelten“ im Tiergarten (Gartenwirtſchaften, die noch
heute beſtehen) kam es vom 7. März ab an den Spät-
nachmittagen und Abenden ſogar zu erregten Volksver-
ammlungen, zu denen ſich Tauſende herbeidrängten,
um dem ,roten Eichler“ und anderen radikalen Red-
i nern zu lauſchen. Beim Heimwärtsgehen der Massen
gab es Konflikte mit dem Militär, das am 15. und
16. von den Schußwaffen Gebrauch machte.
Am 15. wurden die Wiener Ereigniſſe bekannt,
was natürlich die Gärung noch erheblich steigerte. Sie
hätten dem König und seinen Ratgebern eine Lehre
sein ſollen, die berechtigten Wünsche der Bevölkerung
ungeſäumt zu bewilligen; das war in diesem Augen-
Da s Buch für Alle.
blick noch möglich, ohne den das Anſehen der Krone
isjzbiacnten Anſchein, die Nachgiebigkeit ſei erzwungen
worden.
Am 16. März erſchien eine Bekanntmachung des
Berliner Magiſtrats, die darauf hinwies, daß ſeit drei
Tagen bereits das Eigentum und die Sicherheit der
Bürger in großer Gefahr ſich befinde, und deswegen
die Einrichtung einer sogenannten Schutkkommiſssion für
jeden Stadtbezirk anordnete. Die etwa 1200 Mann
starken Schutbeamten, unter denen auch 140 Studenten,
waren meiſt Männer der besten Kreiſe, vermochten ſich
jedoch bei der Masſe keine Geltung zu erringen und
erwieſen ſich als gänzlich nutzlos.
Am Abend des 17. traf eine Abordnung des Kölner
Gemeinderats in der Hauptſtadt ein, die dem Mon-
archen Vorſtellungen bezüglich der ernſten und gefähr-
lichen Stimmung in ihrer Stadt wie im ganzen Rhein-
lande machen sollte. Sie wurde am Vormittag des 18.,
für den die Berliner eine sogenannte friedliche Maſſen-
demonſtration vorbereiteten, im Schloſſe empfangen.
Der gleichfalls nach Berlin gekommene Kölner Ober-
bürgermeister v. Wittgenstein ſchilderte in freimütiger
Weise die herrſchende Erregung und bat dringend um
ſchleunige und vollständige Gewährung aller Wünſche,
die in der Adreſſe der Stadt Köln niedergelegt worden
wären.
Friedrich Wilhelm IV. hielt zwar eine Revolution
in seinem Lande für undenkbar, wohl aber glaubte er
an die Möglichkeit und Gefahr eines Aufruhrs, und
deswegen hatte er ſich nun doch entſchloſſen, wenigstens
den dringendsten Forderungen der Bevölkerung zu ent-
ſprechen. Er erwiderte den Kölnern in liebenswürdiger
Weise, daß er bereits den Beſchluß gefaßt habe, Preußen
alle die Freiheiten zu bewilligen, nach denen das all-
gemeine Verlangen gehe. Wenn ſie ihre Abreiſe noch
um drei Stunden verſchöben, so könnten sie die bereits
im Druck befindliche Proklamation mitnehmen, durch
die alles gewährt würde.
In der That wurden noch an demſelben Tage zwei
königliche Erlasse veröffentlicht, von denen der eine
die Preßfreiheit gewährte, während der andere den
„Vereinigten Landtag“ auf den 2. April einberief und
die vollſte Erfüllung der Verfaſſungswünſche verhieß.
Einen nicht minder gnädigen Empfang fanden auch zwei
Deputationen der Berliner ſstädtiſchen Behörden, die
gleich nachher empfangen wurden. Der König versicherte
wiederholt, daß der Erlaß über die Preßfreiheit und
das Patent wegen beſchleunigter Einberufung des Land- |
| tages ſich ſchon im Druck befänden; nachdem ſie ent- |
laſſen waren, las Miniſter v. Bodelschwingh das letztere,
von ihm ſelbſt verfaßte Schriftſtück den Mitgliedern der
Abordnungen vor.
Es erhob ſich unter den Verſammelten lauter Jubel, |
der auch in der Bevölkerung der Hauptstadt brauſenden
Widerhall fand, als sie durch die aus dem Schlose
Kommenden und dann durch ein Extrablatt der „All-
| gemeinen Preußiſchen Zeitung“" Kunde davon erhielt.
Der heitere, sonnige Frühlingstag, der an jenem denk-
würdigen 18. März über der preußiſchen Hauptſtadt
aufgegangen war, stimmte die Gemüter doppelt freudig.
Tauſende von frohgeſtimmten Menſchen strömten unter
die Linden und auf den Schloßplaz, um vor dem
königlichen Schloſſe den Monarchen hochleben zu laſſen.
Gegen 2 Uhr nachmittags erſchien Friedrich Wil-
helm IV. auf dem Balkon und wurde ſtürmiſch be-
grüßt. Seine Stimme vermochte den Lärm nicht zu
durchdringen. Auch der neben ihm stehende Miniſter
v. Bodelſchwingh konnte sich der ganzen Menge nicht
verständlich machen, allein die zunächſt Stehenden hörten
doch seine Worte und verbreiteten es weiter: der König
habe die Preßfreiheit bewilligt und den Landtag be-
rufen. Preußen werde sich an die Spitze der deutſchen
Bewegung stellen; der Wille des Königs ſei, daß für
alle deutſchen Länder Verfaſſungen auf freiſinniger
Grundlage geschaffen würden. Nachdem der König
ſich zurückgezogen hatte, erklärte der Minister, der
Monarch habe zu arbeiten und erſuche das Publikum,
sich zu zerſtreuen. Es erſchollen von neuem tauſend-
stimmige Hochrufe, in die sich aber auch Stimmen
miſchten, die verlangten, das Militär solle entfernt
werden. Man hatte nämlich seit dem Morgen bereits
Fr Sqsßgöfen ‘ur Bh eqg bes ShUfet cufgcſellt
die zwiſchen 1 und 2 Uhr noch durch zwei Bataillone,
zwei Eskadrons und acht Geschütze verſtärkt worden waren.
Auf die andauernden Rufe der Menge erſchien der
König zum zweitenmal auf dem Balkon und wurde
wiederum jubelnd begrüßt. Dann erteilte er dem Miniſter
v. Bodelſchwingh, dem Grafen Arnim-Boitzenburg und
dem Gouverneur General v. Pfuel den Befehl, das
Publikum zu veranlassen, daß es ſich entferne. Die
Herren begaben sich nach dem Schloßportal I., ihrer
Weiſung wurde jedoch nicht nachgekommen, vielmehr
erſchollen jetzt die Rufe: „Militär zurück!“ immer ſstür-
miſcher, und das Gedränge um das Schloß herum
wurde immer wilder.
Da General v. Pfuel sich inzwiſchen in die Stadt
begeben hatte, so übertrug der König nun dem mittler-
439
weile im Schloſſe eingetroffenen Generallieutenant
v. Prittwitz den Oberbefehl über alle in und bei Berlin
versammelten Truppen, und gab ihm die Weiſung, „dem
Skandal auf dem Schloßplatze ein Ende zu machen,
durch Herumreiten mit der Kavallerie im Schritt und
""t auzthet “ queht.. Schwadron Gardedragoner
über die Schloßfreiheit nach dem Schloßplat, um dann
von der Stechbahn (dem jetzigen Roten Schloß) aus
zur Säuberung des Platzes vorzurücken. Eine erregte
und laut „Militär zurück!“ brüllende Menge warf ſich
jedoch den Reitern entgegen, und als zu ihrer Unter-
ſtützung Infanterie vorrückte, fielen aus der Mitte der
lehteren zwei Schüſſe, die nur durch einen Zufall los-
gingen und niemand verwundeten. Ihre Wirkung war
aber troßdem eine höchſt unheilvolle: ſie bildeten
das Signal zux Berliner Revolution!
Mit dem Schreckensgeſchrei : „Verrat, Verrat! Man
schießt auf das Volk! Hu den Waffen!“ ſtob die
Menge nach allen Richtungen auseinander. Die Rufe
fanden Glauben, und bis in die entfernteſten Teile der
Stadt verbreitete ſich mit wunderbarer Schnelligkeit die
Kunde, die Hofkamarilla wolle die friedenverheißenden
Worte des Königs zu nichte machen, und das Militär
rücke zum Angriff vor. Es zeigte sich jett die traurige
Wirkung des langen Zauderns, auf die Wünſche des
Volkes einzugehen; nur dadurch fand auch bei Gut-
geſinnten der Gedanke Glauben, man bereue im Schlosse
bereits wieder die kaum gemachten Zugeständnisse und
billige den Verſuch, die ganze Bewegung durch Waffen-
gewalt niederzuſchlagen.
Bürger und Arbeiter wollten ſich gegen den er-
warteten Angriff. des Militärs verteidigen, und inner-
Kaiſer Ferdinand I. von Fefterreich. :
halb weniger Stunden erhoben sich in den Straßen
von Berlin, selbst in den entlegensten Vorstädten, zahl-
reiche Barrikaden. Sie wurden an faſt allen Straßen-
kreuzungen errichtet, während gleichzeitig die Sturm-
glocken von allen Türmen herab heulten. „Jn den
Straßen wurde überall das Pflaſter aufgeriſſen, “ be-
richtet der bekannte Schriftſteller Adolf Streckfuß als
Augenzeuge, „alle Fuhrwerke, die etwa vorbeikamen,
wurden aufgehalten, elegante Equipagen ebensowohl
wie Droſchken oder Laſtwagen, die Pferde wurden
abgeſpannt und den Kutschern übergeben, die Wagen
wurden quer über die Straße geworfen, um den Grund-
stamm der entstehenden Barrikaden zu geben. Aus den
Häuſern wurde Material aller Art herbeigeſchleppt,
Bretter, Balken, alte Tonnen und alles erdenlliche
Gerümpel, und dabei beteiligten ſich Menſchen aller
Stände. Man ſsah hier feingekleidete Herren, die ſich
mit ein paar vermoderten Brettern abſchleppten, da
biedere Bürger, die in Gemeinſamkeit mit irgend einem
zerlumpten Burſchen oder einem rußigen Arbeiter einen
Bauzaun abtrugen oder ein Brunnengehäuſe nieder-
riſſen, um das Holz als Barrikadenmaterial zu ver-
wenden. Jeder half beim Barrikadenbau, ſelbſt Frauen
legten mit Hand an, waren doch auch sie von der
gleichen tiefen Entrüſtung und Erbitterung wie die
Männer durchdrungen. Zwiſchen die Bretter, Tonnen
oder das übrige Gerümpel, aus welchen die Barrikaden
erbaut waren, wurde Erde geworfen. Pflaſterſteine
wurden dazwiſchen gerammt, und die Granitplatten der
Trottoirs dienten dazu, dem ganzen eine größere Feſtig-
keit zu geben, einen gegen Gewehrfeuer ſichernden Wall
herzurichten. Mit in der That zauberhafter Schnellig-
keit entſtanden die Barrikaden überall in der ganzen
Stadt, und auch die Häuſer wurden mit der Erlaub-
nis oder auch gegen den Willen der Hausbesitzer in
Verteidigungszuſtand geſetzt. In die höheren Stock-
werke wurden die Steine des aufgeriſſenen Straßen-
pflaſters getragen, damit ſie als Wurfgesſchoſſe gegen
die vordringenden Soldaten benutzt werden könnten,
hie und da wurden auch Ziegeldächer abgedeckt. Ü“
zugleich die Entscheidung über die Zukunft von ganz
Deutſchland abhing.
Der preußiſche Staat erlebte vor fünfzig Jahren
zum zweitenmal in diesem Jahrhundert eine Kataſtrophe;
wie im Jahre 1807, ſo nahte ihm auch in den März-
tagen 1848 das Verderben, weil seine Lenker nicht
mit der Zeit hatten fortſchreiten wollen. Wenn wir
heute jene Begebenheiten rein als geschichtliche Ereig-
niſſe, aus der Ferne und ohne jede Leidenſchaft be-
trachten, ſo vermögen wir uns der Erkenntnis nicht zu
entziehen, daß sie in Berlin wie in Wien und ander-
wärts nichts anderes waren, als eine unausbleibliche
Folge betlagenswerter Verſäumniſſe im Staatsleben.
Dafür zeugen auch die Ausſprüche vieler ſtreng
konservativ geſinnter Männer, von denen wir hier
nur folgende Stelle aus den Lebenserinnerungen des
ſächſiſchen Staatsministers R. v. Friesen anführen
wollen: „Die ſstaatlichen Einrichtungen Deutschlands,
ſowohl der Bund ſelbſt als die Verfaſſungen eines
großen Teiles der Einzelſtaaten, waren alt geworden,
paßten nicht mehr zu den veränderten Verhältniſsen,
zu den Ideen, die sich der Bevölkerung in weiten
Kreiſen bemächtigt hatten. Allgemein war die Ueber-
zeugung, daß es ſo nicht fortgehen könne.
Viele Tauſende an ſich keineswegs revolutionär und
antimonarchiſch Geſinnter, die aber keine Möglichkeit
eines friedlichen, streng verfaſſungsmäßigen Ausganges
ſahen, wurden für die Idee einer allgemeinen, wenn
auch gewaltſamen Umwälzung = nach einer oder der
Uztren Richtung hin = geneigter und empfänglicher
emacht. Ü
§ Nicht die veränderten Verhältniſſe und in die Be-
völkerung eingedrungenen neuen Ideen verſchuldeten
also die Erhebung von 1848, sondern das Zurück-
bleiben der Regierungen hinter dieſen Verhältnissen
und dieſen Ideen.
In den Mittel- und Kleinstaaten Deutſchlands
Hönig Friedrich Vilhekm IV. von Preußen.
hatte die durch die den äußeren Anlaß bietende Pariser
Februarrevolution in Gang gekommene Bewegung
durchweg keinen besonders gewaltthätigen Charakter.
Die Fürsten bewilligten nach kürzerem oder längerem
Sträuben die Forderungen des Volkes (Preß- und
Vereinsfreiheit, Volksbewaffnung u. ſ. w.), und die
Träger des alten verhaßten Syſtems mußten den
Männern des öffentlichen Vertrauens weichen, die man
meiſt die „Märzminiſter“ nannte. Um ſo bitterer
wurde es in Preußen empfunden, daß die unglückselige
gZauderpolitik Friedrich Wilhelms IV., deſſen Porträt
unsere Leser vorſtehend finden, ſich zu keiner recht-
zeitigen Nachgiebigkeit gegen die freiheitlichen, aber
durchaus maßvollen Wünſche der Bevölkerung herbei-
_ daſſen wollte.
Schon in den erſten Märztagen konnte man in
_ Berlin, wo die Erregung mit jedem Tage zunahm
(ebenſo in Köln, Königsberg und Breslau, den Haupt-
ſitzen der liberalen Bewegung), häufig die unmutige
Aeuußerung vernehmen, Preußen dürfe in der freiheit-
lichen Entwickelung nicht hinter den ſüddeutſchen Staaten
zurückbleiben, und wenn die Regierung dem Volkswillen
nicht gutwillig Rechnung trage, sſo müſſe eben ein
| zwingender Druck auf sie geübt werden. Die früher
: überall zu finden geweſene Polizei hielt ſich neuerdings
ganz im Hintergrunde, daher führte man ſolche Erörte-
rungen auch bald öffentlich. Unter den sogenannten
„Zelten“ im Tiergarten (Gartenwirtſchaften, die noch
heute beſtehen) kam es vom 7. März ab an den Spät-
nachmittagen und Abenden ſogar zu erregten Volksver-
ammlungen, zu denen ſich Tauſende herbeidrängten,
um dem ,roten Eichler“ und anderen radikalen Red-
i nern zu lauſchen. Beim Heimwärtsgehen der Massen
gab es Konflikte mit dem Militär, das am 15. und
16. von den Schußwaffen Gebrauch machte.
Am 15. wurden die Wiener Ereigniſſe bekannt,
was natürlich die Gärung noch erheblich steigerte. Sie
hätten dem König und seinen Ratgebern eine Lehre
sein ſollen, die berechtigten Wünsche der Bevölkerung
ungeſäumt zu bewilligen; das war in diesem Augen-
Da s Buch für Alle.
blick noch möglich, ohne den das Anſehen der Krone
isjzbiacnten Anſchein, die Nachgiebigkeit ſei erzwungen
worden.
Am 16. März erſchien eine Bekanntmachung des
Berliner Magiſtrats, die darauf hinwies, daß ſeit drei
Tagen bereits das Eigentum und die Sicherheit der
Bürger in großer Gefahr ſich befinde, und deswegen
die Einrichtung einer sogenannten Schutkkommiſssion für
jeden Stadtbezirk anordnete. Die etwa 1200 Mann
starken Schutbeamten, unter denen auch 140 Studenten,
waren meiſt Männer der besten Kreiſe, vermochten ſich
jedoch bei der Masſe keine Geltung zu erringen und
erwieſen ſich als gänzlich nutzlos.
Am Abend des 17. traf eine Abordnung des Kölner
Gemeinderats in der Hauptſtadt ein, die dem Mon-
archen Vorſtellungen bezüglich der ernſten und gefähr-
lichen Stimmung in ihrer Stadt wie im ganzen Rhein-
lande machen sollte. Sie wurde am Vormittag des 18.,
für den die Berliner eine sogenannte friedliche Maſſen-
demonſtration vorbereiteten, im Schloſſe empfangen.
Der gleichfalls nach Berlin gekommene Kölner Ober-
bürgermeister v. Wittgenstein ſchilderte in freimütiger
Weise die herrſchende Erregung und bat dringend um
ſchleunige und vollständige Gewährung aller Wünſche,
die in der Adreſſe der Stadt Köln niedergelegt worden
wären.
Friedrich Wilhelm IV. hielt zwar eine Revolution
in seinem Lande für undenkbar, wohl aber glaubte er
an die Möglichkeit und Gefahr eines Aufruhrs, und
deswegen hatte er ſich nun doch entſchloſſen, wenigstens
den dringendsten Forderungen der Bevölkerung zu ent-
ſprechen. Er erwiderte den Kölnern in liebenswürdiger
Weise, daß er bereits den Beſchluß gefaßt habe, Preußen
alle die Freiheiten zu bewilligen, nach denen das all-
gemeine Verlangen gehe. Wenn ſie ihre Abreiſe noch
um drei Stunden verſchöben, so könnten sie die bereits
im Druck befindliche Proklamation mitnehmen, durch
die alles gewährt würde.
In der That wurden noch an demſelben Tage zwei
königliche Erlasse veröffentlicht, von denen der eine
die Preßfreiheit gewährte, während der andere den
„Vereinigten Landtag“ auf den 2. April einberief und
die vollſte Erfüllung der Verfaſſungswünſche verhieß.
Einen nicht minder gnädigen Empfang fanden auch zwei
Deputationen der Berliner ſstädtiſchen Behörden, die
gleich nachher empfangen wurden. Der König versicherte
wiederholt, daß der Erlaß über die Preßfreiheit und
das Patent wegen beſchleunigter Einberufung des Land- |
| tages ſich ſchon im Druck befänden; nachdem ſie ent- |
laſſen waren, las Miniſter v. Bodelschwingh das letztere,
von ihm ſelbſt verfaßte Schriftſtück den Mitgliedern der
Abordnungen vor.
Es erhob ſich unter den Verſammelten lauter Jubel, |
der auch in der Bevölkerung der Hauptstadt brauſenden
Widerhall fand, als sie durch die aus dem Schlose
Kommenden und dann durch ein Extrablatt der „All-
| gemeinen Preußiſchen Zeitung“" Kunde davon erhielt.
Der heitere, sonnige Frühlingstag, der an jenem denk-
würdigen 18. März über der preußiſchen Hauptſtadt
aufgegangen war, stimmte die Gemüter doppelt freudig.
Tauſende von frohgeſtimmten Menſchen strömten unter
die Linden und auf den Schloßplaz, um vor dem
königlichen Schloſſe den Monarchen hochleben zu laſſen.
Gegen 2 Uhr nachmittags erſchien Friedrich Wil-
helm IV. auf dem Balkon und wurde ſtürmiſch be-
grüßt. Seine Stimme vermochte den Lärm nicht zu
durchdringen. Auch der neben ihm stehende Miniſter
v. Bodelſchwingh konnte sich der ganzen Menge nicht
verständlich machen, allein die zunächſt Stehenden hörten
doch seine Worte und verbreiteten es weiter: der König
habe die Preßfreiheit bewilligt und den Landtag be-
rufen. Preußen werde sich an die Spitze der deutſchen
Bewegung stellen; der Wille des Königs ſei, daß für
alle deutſchen Länder Verfaſſungen auf freiſinniger
Grundlage geschaffen würden. Nachdem der König
ſich zurückgezogen hatte, erklärte der Minister, der
Monarch habe zu arbeiten und erſuche das Publikum,
sich zu zerſtreuen. Es erſchollen von neuem tauſend-
stimmige Hochrufe, in die sich aber auch Stimmen
miſchten, die verlangten, das Militär solle entfernt
werden. Man hatte nämlich seit dem Morgen bereits
Fr Sqsßgöfen ‘ur Bh eqg bes ShUfet cufgcſellt
die zwiſchen 1 und 2 Uhr noch durch zwei Bataillone,
zwei Eskadrons und acht Geschütze verſtärkt worden waren.
Auf die andauernden Rufe der Menge erſchien der
König zum zweitenmal auf dem Balkon und wurde
wiederum jubelnd begrüßt. Dann erteilte er dem Miniſter
v. Bodelſchwingh, dem Grafen Arnim-Boitzenburg und
dem Gouverneur General v. Pfuel den Befehl, das
Publikum zu veranlassen, daß es ſich entferne. Die
Herren begaben sich nach dem Schloßportal I., ihrer
Weiſung wurde jedoch nicht nachgekommen, vielmehr
erſchollen jetzt die Rufe: „Militär zurück!“ immer ſstür-
miſcher, und das Gedränge um das Schloß herum
wurde immer wilder.
Da General v. Pfuel sich inzwiſchen in die Stadt
begeben hatte, so übertrug der König nun dem mittler-
439
weile im Schloſſe eingetroffenen Generallieutenant
v. Prittwitz den Oberbefehl über alle in und bei Berlin
versammelten Truppen, und gab ihm die Weiſung, „dem
Skandal auf dem Schloßplatze ein Ende zu machen,
durch Herumreiten mit der Kavallerie im Schritt und
""t auzthet “ queht.. Schwadron Gardedragoner
über die Schloßfreiheit nach dem Schloßplat, um dann
von der Stechbahn (dem jetzigen Roten Schloß) aus
zur Säuberung des Platzes vorzurücken. Eine erregte
und laut „Militär zurück!“ brüllende Menge warf ſich
jedoch den Reitern entgegen, und als zu ihrer Unter-
ſtützung Infanterie vorrückte, fielen aus der Mitte der
lehteren zwei Schüſſe, die nur durch einen Zufall los-
gingen und niemand verwundeten. Ihre Wirkung war
aber troßdem eine höchſt unheilvolle: ſie bildeten
das Signal zux Berliner Revolution!
Mit dem Schreckensgeſchrei : „Verrat, Verrat! Man
schießt auf das Volk! Hu den Waffen!“ ſtob die
Menge nach allen Richtungen auseinander. Die Rufe
fanden Glauben, und bis in die entfernteſten Teile der
Stadt verbreitete ſich mit wunderbarer Schnelligkeit die
Kunde, die Hofkamarilla wolle die friedenverheißenden
Worte des Königs zu nichte machen, und das Militär
rücke zum Angriff vor. Es zeigte sich jett die traurige
Wirkung des langen Zauderns, auf die Wünſche des
Volkes einzugehen; nur dadurch fand auch bei Gut-
geſinnten der Gedanke Glauben, man bereue im Schlosse
bereits wieder die kaum gemachten Zugeständnisse und
billige den Verſuch, die ganze Bewegung durch Waffen-
gewalt niederzuſchlagen.
Bürger und Arbeiter wollten ſich gegen den er-
warteten Angriff. des Militärs verteidigen, und inner-
Kaiſer Ferdinand I. von Fefterreich. :
halb weniger Stunden erhoben sich in den Straßen
von Berlin, selbst in den entlegensten Vorstädten, zahl-
reiche Barrikaden. Sie wurden an faſt allen Straßen-
kreuzungen errichtet, während gleichzeitig die Sturm-
glocken von allen Türmen herab heulten. „Jn den
Straßen wurde überall das Pflaſter aufgeriſſen, “ be-
richtet der bekannte Schriftſteller Adolf Streckfuß als
Augenzeuge, „alle Fuhrwerke, die etwa vorbeikamen,
wurden aufgehalten, elegante Equipagen ebensowohl
wie Droſchken oder Laſtwagen, die Pferde wurden
abgeſpannt und den Kutschern übergeben, die Wagen
wurden quer über die Straße geworfen, um den Grund-
stamm der entstehenden Barrikaden zu geben. Aus den
Häuſern wurde Material aller Art herbeigeſchleppt,
Bretter, Balken, alte Tonnen und alles erdenlliche
Gerümpel, und dabei beteiligten ſich Menſchen aller
Stände. Man ſsah hier feingekleidete Herren, die ſich
mit ein paar vermoderten Brettern abſchleppten, da
biedere Bürger, die in Gemeinſamkeit mit irgend einem
zerlumpten Burſchen oder einem rußigen Arbeiter einen
Bauzaun abtrugen oder ein Brunnengehäuſe nieder-
riſſen, um das Holz als Barrikadenmaterial zu ver-
wenden. Jeder half beim Barrikadenbau, ſelbſt Frauen
legten mit Hand an, waren doch auch sie von der
gleichen tiefen Entrüſtung und Erbitterung wie die
Männer durchdrungen. Zwiſchen die Bretter, Tonnen
oder das übrige Gerümpel, aus welchen die Barrikaden
erbaut waren, wurde Erde geworfen. Pflaſterſteine
wurden dazwiſchen gerammt, und die Granitplatten der
Trottoirs dienten dazu, dem ganzen eine größere Feſtig-
keit zu geben, einen gegen Gewehrfeuer ſichernden Wall
herzurichten. Mit in der That zauberhafter Schnellig-
keit entſtanden die Barrikaden überall in der ganzen
Stadt, und auch die Häuſer wurden mit der Erlaub-
nis oder auch gegen den Willen der Hausbesitzer in
Verteidigungszuſtand geſetzt. In die höheren Stock-
werke wurden die Steine des aufgeriſſenen Straßen-
pflaſters getragen, damit ſie als Wurfgesſchoſſe gegen
die vordringenden Soldaten benutzt werden könnten,
hie und da wurden auch Ziegeldächer abgedeckt. Ü“