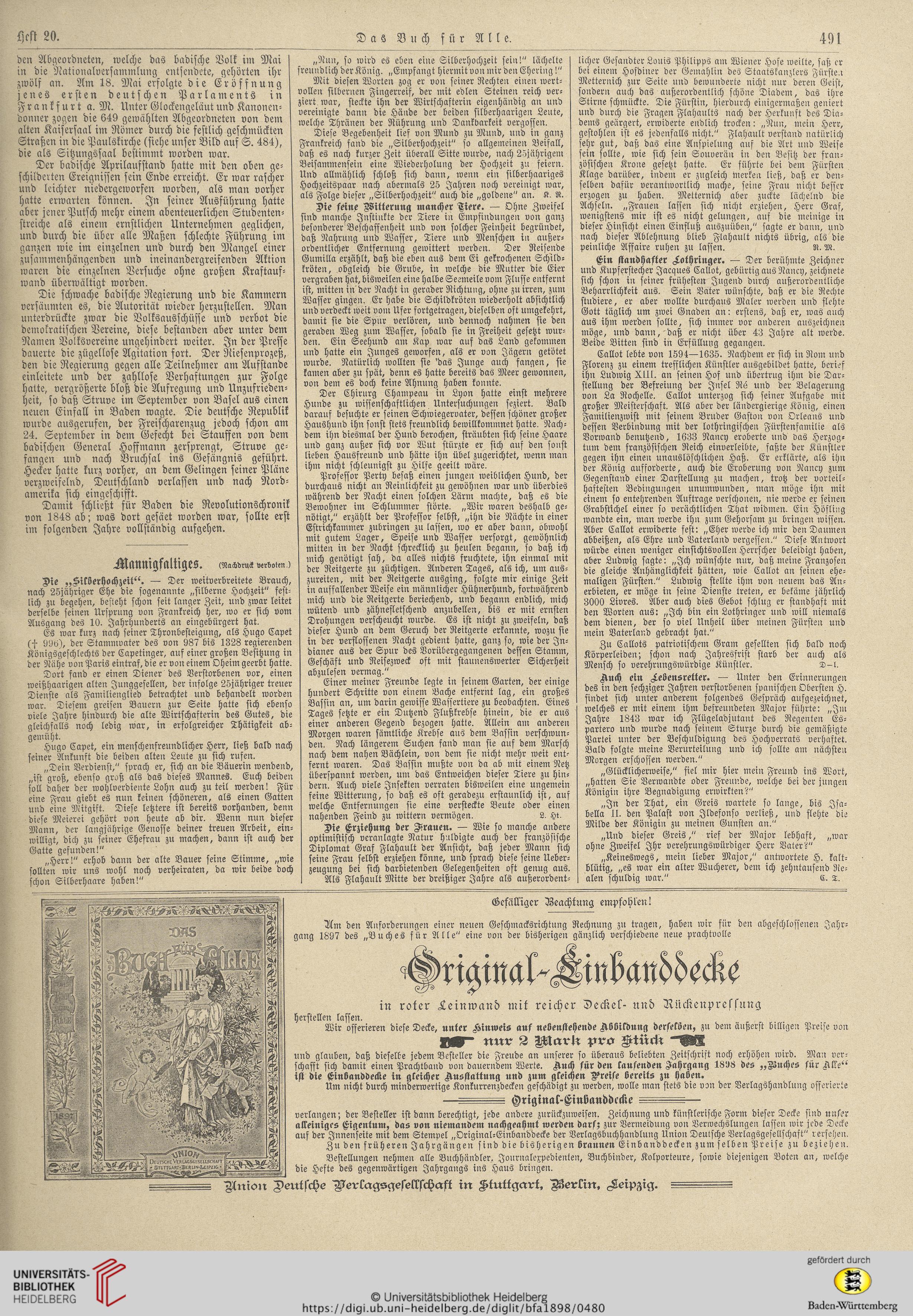Heft 20.
Da s Buch für Allêée..
den Abgeordneten, welche das badiſche Volk im Mai
in die Nationalverſammlung entſendete, gehörten ihr
zwölf an. Am 18. Mai erfolgte die Eröffnung
jenes erſten deutſhen Parlaments in
Frankfurt a. M. Unter Glockengeläut und Kanonen-
vonner zogen die 649 gewählten Abgeordneten von dem
alten Kaiſerſaal im Römer durch die festlich geschmückten
Straßen in die Paulskirche (ſiehe unſer Bild auf S. 484),
die als Sitzungssaal beſtimmt worden war.
Der badiſche Aprilaufstand hatte mit den oben ge-
ſchilderten Ereignissen sein Ende erreicht. Er war raſcher
und leichter niedergeworfen worden, als man vorher
hatte erwarten können. In ſseiner Ausführung hatte
1 aber jener Putſch mehr einem abenteuerlichen Studenten-
ſtreiche als einem ernſtlichen Unternehmen geglichen,
und durch die über alle Maßen schlechte Führung im
: ganzen wie im einzelnen und durch den Mangel einer
zusammenhängenden und ineinandergreifenden Aktion
_ wuaren die einzelnen Verſuche ohne großen Kraftauf-
wand überwältigt worden.
Die ſchwache badiſche Regierung und die Kammern
1 versäumten es, die Autorität wieder herzuſtellen. Man
unterdrückte zwar die Volksausſchüſſe und verbot die
demokratiſchen Vereine, dieſe beſtanden aber unter dem
Namen Volksvereine ungehindert weiter. In der Presse
dauerte die zügelloſe Agitation fort. Der Riesenprozeß,
den die Regierung gegen alle Teilnehmer am Aufstande
einleitete und der zahlloſe Verhaftungen zur Folge
alte, vergrößerte bloß die Aufregung und Unzufrieden-
heit, ſo daß Struve im September von Baſel aus einen
neuen Einfall in Baden wagte. Die deutſche Republik
wurde ausgerufen, der Freiſcharenzug jedoch schon am
24. September in dem Gefecht bei Stauffen von dem
. badiſchen General Hoffmann zerſprengt, Struve ge-
fangen und nach Bruchſal ins Gefängnis geführt.
Hecker hatte kurz vorher, an dem Gelingen seiner Pläne
verzweifelnd, Deutſchland verlaſſen und nach Nord-
amerika sich eingeſchifft. ; |
Damit ſchließt für Baden die Revolutionschronik
von 1848 ab; was dort geſäet worden war, ſollte erſt
im folgenden Jahre vollständig aufgehen.
Mannigfaltiges. M©na©aÊOÊ.22
Die ,„„Silderhochzeits“. –~ Der weitverbreitete Brauch,
nach 25jähriger Ehe die sogenannte „silberne Hochzeit" fest-
lich zu begehen, besteht schon seit langer Zeit, und zwar leitet
derſelbe seinen Ursprung von Frankreich her, wo er sich vom
Ausgang des 10. Jahrhunderts an eingebürgert hat.
Es war kurz nach seiner Thronbesteigung, als Hugo Capet
(+ 996), der Stammvater des von 987 bis 1328 regierenden
Königsgeschlechts der Capetinger, auf einer großen Beſitung in
der Nähe von Paris eintraf, die er von einem Dheim geerbt hatte.
Dort fand er einen Diener des Verstorbenen vor, einen
weißhaarigen alten Junggesellen, der infolge 25jähriger treuer
Dienste als Familienglied betrachtet und behandelt worden
war. Diesem greiſen Bauern zur Seite hatte sich ebenso
viele Jahre hindurch die alte Wirtschafterin des Gutes, die
gleichfalls noch ledig war, in erfolgreicher Thätigkeit ab-
emüht.
s use Capet, ein menschenfreundlicher Herr, ließ bald nach
seiner Ankunft die beiden alten Leute zu sich rufen.
„Dein Verdienst," sprach er, sich an die Bäuerin wendend,
q „iſt groß, ebenſo groß als das dieses Mannes. Euch beiden
soll daher der wohlverdiente Lohn auch zu teil werden! Für
: eine Frau giebt es nun keinen ſchöneren, als einen Gatten
und eine Mitgift. Diese letztere iſt bereits vorhanden, denn
diese Meierei gehört von heute ab dir. Wenn nun dieser
Mann, der langjährige Genoſſe deiner treuen Arbeit, ein-
willigt, dich zu ſciter Ehefrau zu machen, dann ist auch der
hatte gefturestt dann der alte Bauer seine Stimme, ,wie
sollten wir uns wohl noch verheiraten, da wir beide doch
schon Silberhaare haben!"
Union
/ /. gang 1897 des „Buches für Alle“ eine von der bisher
/ | herſtellen laſſen.
„Nun, so wird es eben eine Silberhochzeit sein!" lächelte
freundlich der König. „Empfangt hiermit von mir den Chering !“
Mit diesen Worten zog er von seiner Rechten einen wert-
vollen silbernen Fingerreif, der mit edlen Steinen reich ver-
ziert war, steckte ihn der Wirtſchafterin eigenhändig an und
vereinigte dann die Hände der beiden ſsſilberhaarigen Leute,
welche Thränen der Rührung und Dankbarkeit vergoſsen.
Diese Begebenheit lief von Mund zu Mund, und in ganz
Frankreich fand die „Silberhochzeit“ so allgemeinen Beifall,
daß es nach kurzer Zeit überall Sitte wurde, nach 25jährigem
Beisammensein eine Wiederholung der Hochzeit zu feiern.
Und allmählich ſchloß sich dann, wenn ein ſilberhaariges
Hochzeitspaar nach abermals 25 Jahren noch vereinigt war,
als Folge dieser „Silberhochzeit auch die „goldene" an. K. R.
Die feine Witterung mancher Tiere. – Ohne Zweifel
sind manche Instinkte der Tiere in Empfindungen von ganz
besonderer Beschaffenheit und von solcher Feinheit begründet,
daß Nahrung und Wasser, Tiere und Menſchen in außer-
ordentlicher Entfernung gewittert werden. Der Reisende
Gumilla erzählt, daß die eben aus dem Ei gekrochenen Schild-
kröten, obgleich die Grube, in welche die Mutter die Eier
vergraben hat, bisweilen eine halbe Seemeile vom Flusse entfernt
iſt, mitten in der Nacht in gerader Richtung, ohne zu irren, zum
Wasser gingen. Er habe die Schildkröten wiederholt absichtlich
und verdeckt weit vom Ufer fortgetragen, dieſelben oft umgekehrt,
damit sie die Spur verlören, und dennoch nahmen sie den
geraden Weg zum Waſfser, sobald sie in Freiheit gesetzt wur-
den. Ein Seehund am Kap war auf das Land gekommen
und hatte ein Junges geworfen, als er von Jägern getötet
wurde. Natürlich wollten sie 'das Junge auch fangen, sie
kamen aber zu ſpät, denn es hatte bereits das Meer gewonnen,
von dem es doch keine Ahnung haben konnte.
Der Chirurg Champeau in Lyon hatte einst mehrere
Hunde zu wiſssenſchaftlichen Untersuchungen seziert. Bald
darauf besuchte er seinen Schwiegervater, dessen ſchöner großer
Haushund ihn sonſt stets freundlich bewillkommnet hatte. Nach-
dem ihn diesmal der Hund berochen, sträubten sich ſeine Haare
und ganz außer ſich vor Wut stürzte er sich auf den sonſt
lieben Hausfreund und hätte ihn übel zugerichtet, wenn man
ihm nicht ſchleunigst zu Hilfe geeilt wäre.
Professor Perty besaß einen jungen weiblichen Hund, der
durchaus nicht an Reinlichkeit zu gewöhnen war und überdies
während der Nacht einen solchen Lärm machte, daß es die
Bewohner im Schlummer störte. „Wir waren deshalb ge-
nötigt," erzählt der Professor selbst, „ihn die Nächte in einer
Eſtrichkammer zubringen zu lassen, wo er aber dann, obwohl
mit gutem Lager, Speiſe und Wasſer versorgt, gewöhnlich
mitten in der Nacht ſchrecklich zu heulen begann, so daß ich
mich genötigt sah, da alles nichts fruchtete, ihn einmal mit
der Reitgerte zu züchtigen. Anderen Tages, als ich, um aus-
zureiten, mit der Reitgerte ausging, folgte mir einige Zeit
in auffallender Weise ein männlicher Hühnerhund, fortwährend
mich und die Reitgerte beriechend, und begann endlich, mich
wütend und zähnefletſchend anzubellen, bis er mit ernsten
| Drohungen verscheucht wurde. Es ist nicht zu zweifeln, daß
dieser Hund an dem Geruch der Reitgerte erkannte, wozu sie
in der verfloſſenen Nacht gedient hatte, ganz so, wie der In-
dianer aus der Spur des Vorübergegangenen dessen Stamm,
Geschäft und Reisezweck oft mit staunenswerter Sicherheit
abzuleſen vermag.“ :
Einer meiner Freunde legte in seinem Garten, der einige
hundert Schritte von einem Bache entfernt lag, ein großes
Bassin an, um darin gewisse Wasſertiere zu beobachten. Eines
Tages setzte er ein Dutzend Flußkrebſe hinein, die er aus
einer anderen Gegend bezogen hatte. Allein am anderen
Morgen waren ſämtliche Krebſe aus dem Bassin verſchwun-
den. Nach längerem Suchen fand man sie auf dem Marsch
nach dem nahen Bächlein, von dem sie nicht mehr weit ent-
fernt waren. Das Bassin mußte von da ab mit einem Net
überſpannt werden, um das Entweichen dieser Tiere zu hin-
dern. Auch viele Insekten verraten bisweilen eine ungemein
feine Witterung, so daß es oft geradezu erstaunlich iſt, auf
welche Entfernungen sie eine versteckte Beute oder einen
nahenden Feind zu wittern vermögen. L. Ht.
Die Erziehung der Irauen. ~ Wie so manche andere
r ks prreuugte Netrr hrttgte az er tests
s Frau selbst erziehen könne, und sprach diese ſeine Ueber-
zeugung bei sich darbietenden Gelegenheiten oft genug aus.
Als Flahault Mitte der dreißiger Jahre als außerordent-
. 191
licher Gesandter Louis Philipps am Wiener Hofe weilte, saß er
bei einem Hofdiner der Gemahlin des Staatskanzlers Jürſte.1
Metternich zur Seite und bewunderte nicht nur deren Geiſt,
ſondern auch das außerordentlich ſchöne Diadem, das ihre
Stirne schmückte. Die Fürstin, hierdurch einigermaßen geniert
und durch die Fragen Flahaults nach der Herkunft des Dia-
dems geärgert, erwiderte endlich trocken: „Nun, mein Herr,
geſtohlen ist es jedenfalls nicht." Flahault verstand natürlich
ſehr gut, daß das eine Anspielung auf die Art und Weise
ſein sollte, wie sich sein Souverän in den Besitz der fran-
zöſiſchen Krone geseßt hatte. Er führte bei dem Fürsten
Klage darüber, indem er zugleich merken ließ, daß er den-
selben dafür verantwortlich mache, seine Frau nicht besser
erzogen zu haben. Metternich aber zuckte lächelnd die
Achſeln. „Frauen lassen sich nicht erziehen, Herr Graf,
wenigstens mir ist es nicht gelungen, auf die meinige in
dieſer Hinsicht einen Einfluß auszuüben,“ sagte er dann, und
nach dieſer Ablehnung blieb Flahault nichts übrig, als die
peinliche Affaire ruhen zu lassen. . R. M.
Ein ſtandhafter Lothringer. ~ Der berühmte Zeichner
und Kupferstecher Jacques Callot, gebürtig aus Nancy, zeichnete
sſich schon in seiner früheſten Jugend durch außerordentliche
Beharrlichkeit aus. Sein Vater wünſchte, daß er die Rechte
studiere, er aber wollte durchaus Maler werden und flehte
Gott täglich um zwei Gnaden an: erſtens, daß er, was auch
aus ihm werden sollte, sich immer vor anderen auszeichnen
möge, und dann, daß er nicht über 43 Jahre alt werde.
Beide Bitten sind in Erfüllung gegangen. /
Callot lebte von 1594~1635. Nachdem er sich in Rom und
Florenz zu einem trefflichen Künstler ausgebildet hatte, berief
ihn Ludwig RlII. an seinen Hof und übertrug ihm die Dar-
stellung der Befreiung der Inſel Ré und der Belagerung
von La Rochelle. Callot unterzog ſich seiner Aufgabe mit
großer Meisterſchaft. Als aber der ländergierige König, einen
Familienzwiſt mit seinem Bruder Gaſton von Orleans und
deſſen Verbindung mit der lothringiſchen Fürſtenfamilie als
Vorwand benutzend, 1633 Nancy eroberte und das Herzog-
tum dem franzöſiſchen Reich einverleibte, faßte der Künstler
gegen ihn einen unauslöſchlichen Haß. Er erklärte, als ihn
der König aufforderte, auch die Eroberung von Nancy zum
Gegenstand einer Darstellung zu machen, trotz der vorteil-
hafteſten Bedingungen unumwunden, man möge ihn mit
einem so entehrenden Auftrage verſchonen, nie werde er seinen
Grabſtichel einer ſo verächtlichen That widmen. Ein Höfling
wandte ein, man werde ihn zum Gehorſam zu bringen wiſſen.
Aber Callot erwiderte feſt: „Eher werde ich mir den Daumen
abbeißen, als Ehre und Vaterland vergessen.“ Diese Antwort
würde einen weniger einsichtsvollen Herrſcher beleidigt haben,
aber Ludwig sagte: „Jch wünschte nur, daß meine Franzosen
die gleiche Anhänglichkeit hätten, wie Callot an seinen ehe-
maligen Fürsten." Ludwig stellte ihm von neuem das An-
erbieten, er möge in seine Dienste treten, er bekäme jährlich
3000 Livres. Aber auch dies Gebot ſchlug er ſtandhaft mit
den Worten aus: „Jch bin ein Lothringer und will niemals
dem dienen, der ſo viel Unheil über meinen Fürsten und
mein Vaterland gebracht hat.“ ;
Zu Callots patriotiſchen Gram gesellten sich bald noch
Körperleiden; schon nach Jahresfriſt starb der auch als
Menſch so verehrungswürdige Künſtler. Dr.
auch. ein Lebensretter + Unter den Erinnerungen
des in den sechziger Jahren verstorbenen ſspaniſchen Obersten H.
findet ſich unter anderem folgendes Gespräch aufgezeichnet,
welches er mit einem ihm befreundeten Major führte: „Jm
Jahre 1848 war ich Flügeladjutant des Regenten Es-
partero und wurde nach ſeinem Sturze durch die gemäßigte
Partei unter der Beschuldigung des Hochverrats verhaftet.
Bald folgte meine Verurteilung und ich sollte am nächsten
Morgen ersſchoſſen werden.“
„Glücklicherweise,“ fiel mir hier mein Freund ins Wort,
„hatten Sie Verwandte oder Freunde, welche bei der jungen
Königin ihre Begnadigung erwirkten?"
„In der That, ein Greis wartete so lange, bis Jsa-
bella Il. den Palaſt von Ildefonso verließ, und flehte die
Milde der Königin zu meinen Gunsten an."
eh §Icif. Gut .ch! Mi z!etha f
„Keineswegs, mein lieber Major,“ antwortete H. kalt. -
blütig, „es war ein alter Wucherer, dem ich zehntausend Re-
alen schuldig war." C. T.
„war
Gefälliger Beachtung empfohlen!
Am den Anforderungen einer neuen Geſschmacksrichtung Rechnung zu tragen, haben wir für den abgeschlossenen Jahr-
igen gänzlich verſchiedene neue prachtvolle
Hriginal-Linbanddecke
in roter Leinwand mit reicher Deckel- und Rückenpreſsſung
Wir offerieren diese Decke, unker Hinweis auf nebenſtehende Abbildung derſelöen, zu dem äußerst billigen Preiſe von
m. nur 2 Mark pro stick “MT
j | und glauben, daß dieselbe jedem Besteller die Freude an unserer so überaus beliebten Zeitſchrift noch erhöhen wird. Man ver:
| ſchafft sich damit einen Prachtband von dauerndem Werte. Auch für den kaufenden Jahrgang 1898 des „„Zzuches ſür Allen.
iſt die Einbanddecke in gleicher Ausſtattung und zum gleichen Freiſe bereits zu haben.
Um nicht durch minderwertige Konkurrenzdecken geschädigt zu werden, wolle man stets die von der Verlagshandlung offerierte
: Original-Cinbanddecke
’]| verlangen; der Besteller ist dann berechtigt, jede andere zurückzuweisen. Zeichnung und künstlerische Form dieser Decke sind uufer
alleiniges Eigentum, das von niemandem nachgeahmt werden darf; zur Vermeidung von Verwechslungen lassen wir jede Decke
2\| | auf der Innenseite mit dem Stempel „Original-Einbanddecke der Verlagsbuchhandlung Union Deutſche Verlagsgesellſchaft“" rersehen.
Zu den früheren Jahrgängen ſind die bisherigen braunen Einbanddecken zum selben Preiſe zu beziehen.
Bestellungen nehmen alle Buchhändler. Journalexpedienten, Buchbinder, Kolporteure, sowie diejenigen Voten an, welche
die Hefte des gegenwärtigen Jahrgangs ins Haus bringen.
Deutsche Verkagsgeſellſchaft in Htuttgart, erkin, Leipzig.
Da s Buch für Allêée..
den Abgeordneten, welche das badiſche Volk im Mai
in die Nationalverſammlung entſendete, gehörten ihr
zwölf an. Am 18. Mai erfolgte die Eröffnung
jenes erſten deutſhen Parlaments in
Frankfurt a. M. Unter Glockengeläut und Kanonen-
vonner zogen die 649 gewählten Abgeordneten von dem
alten Kaiſerſaal im Römer durch die festlich geschmückten
Straßen in die Paulskirche (ſiehe unſer Bild auf S. 484),
die als Sitzungssaal beſtimmt worden war.
Der badiſche Aprilaufstand hatte mit den oben ge-
ſchilderten Ereignissen sein Ende erreicht. Er war raſcher
und leichter niedergeworfen worden, als man vorher
hatte erwarten können. In ſseiner Ausführung hatte
1 aber jener Putſch mehr einem abenteuerlichen Studenten-
ſtreiche als einem ernſtlichen Unternehmen geglichen,
und durch die über alle Maßen schlechte Führung im
: ganzen wie im einzelnen und durch den Mangel einer
zusammenhängenden und ineinandergreifenden Aktion
_ wuaren die einzelnen Verſuche ohne großen Kraftauf-
wand überwältigt worden.
Die ſchwache badiſche Regierung und die Kammern
1 versäumten es, die Autorität wieder herzuſtellen. Man
unterdrückte zwar die Volksausſchüſſe und verbot die
demokratiſchen Vereine, dieſe beſtanden aber unter dem
Namen Volksvereine ungehindert weiter. In der Presse
dauerte die zügelloſe Agitation fort. Der Riesenprozeß,
den die Regierung gegen alle Teilnehmer am Aufstande
einleitete und der zahlloſe Verhaftungen zur Folge
alte, vergrößerte bloß die Aufregung und Unzufrieden-
heit, ſo daß Struve im September von Baſel aus einen
neuen Einfall in Baden wagte. Die deutſche Republik
wurde ausgerufen, der Freiſcharenzug jedoch schon am
24. September in dem Gefecht bei Stauffen von dem
. badiſchen General Hoffmann zerſprengt, Struve ge-
fangen und nach Bruchſal ins Gefängnis geführt.
Hecker hatte kurz vorher, an dem Gelingen seiner Pläne
verzweifelnd, Deutſchland verlaſſen und nach Nord-
amerika sich eingeſchifft. ; |
Damit ſchließt für Baden die Revolutionschronik
von 1848 ab; was dort geſäet worden war, ſollte erſt
im folgenden Jahre vollständig aufgehen.
Mannigfaltiges. M©na©aÊOÊ.22
Die ,„„Silderhochzeits“. –~ Der weitverbreitete Brauch,
nach 25jähriger Ehe die sogenannte „silberne Hochzeit" fest-
lich zu begehen, besteht schon seit langer Zeit, und zwar leitet
derſelbe seinen Ursprung von Frankreich her, wo er sich vom
Ausgang des 10. Jahrhunderts an eingebürgert hat.
Es war kurz nach seiner Thronbesteigung, als Hugo Capet
(+ 996), der Stammvater des von 987 bis 1328 regierenden
Königsgeschlechts der Capetinger, auf einer großen Beſitung in
der Nähe von Paris eintraf, die er von einem Dheim geerbt hatte.
Dort fand er einen Diener des Verstorbenen vor, einen
weißhaarigen alten Junggesellen, der infolge 25jähriger treuer
Dienste als Familienglied betrachtet und behandelt worden
war. Diesem greiſen Bauern zur Seite hatte sich ebenso
viele Jahre hindurch die alte Wirtschafterin des Gutes, die
gleichfalls noch ledig war, in erfolgreicher Thätigkeit ab-
emüht.
s use Capet, ein menschenfreundlicher Herr, ließ bald nach
seiner Ankunft die beiden alten Leute zu sich rufen.
„Dein Verdienst," sprach er, sich an die Bäuerin wendend,
q „iſt groß, ebenſo groß als das dieses Mannes. Euch beiden
soll daher der wohlverdiente Lohn auch zu teil werden! Für
: eine Frau giebt es nun keinen ſchöneren, als einen Gatten
und eine Mitgift. Diese letztere iſt bereits vorhanden, denn
diese Meierei gehört von heute ab dir. Wenn nun dieser
Mann, der langjährige Genoſſe deiner treuen Arbeit, ein-
willigt, dich zu ſciter Ehefrau zu machen, dann ist auch der
hatte gefturestt dann der alte Bauer seine Stimme, ,wie
sollten wir uns wohl noch verheiraten, da wir beide doch
schon Silberhaare haben!"
Union
/ /. gang 1897 des „Buches für Alle“ eine von der bisher
/ | herſtellen laſſen.
„Nun, so wird es eben eine Silberhochzeit sein!" lächelte
freundlich der König. „Empfangt hiermit von mir den Chering !“
Mit diesen Worten zog er von seiner Rechten einen wert-
vollen silbernen Fingerreif, der mit edlen Steinen reich ver-
ziert war, steckte ihn der Wirtſchafterin eigenhändig an und
vereinigte dann die Hände der beiden ſsſilberhaarigen Leute,
welche Thränen der Rührung und Dankbarkeit vergoſsen.
Diese Begebenheit lief von Mund zu Mund, und in ganz
Frankreich fand die „Silberhochzeit“ so allgemeinen Beifall,
daß es nach kurzer Zeit überall Sitte wurde, nach 25jährigem
Beisammensein eine Wiederholung der Hochzeit zu feiern.
Und allmählich ſchloß sich dann, wenn ein ſilberhaariges
Hochzeitspaar nach abermals 25 Jahren noch vereinigt war,
als Folge dieser „Silberhochzeit auch die „goldene" an. K. R.
Die feine Witterung mancher Tiere. – Ohne Zweifel
sind manche Instinkte der Tiere in Empfindungen von ganz
besonderer Beschaffenheit und von solcher Feinheit begründet,
daß Nahrung und Wasser, Tiere und Menſchen in außer-
ordentlicher Entfernung gewittert werden. Der Reisende
Gumilla erzählt, daß die eben aus dem Ei gekrochenen Schild-
kröten, obgleich die Grube, in welche die Mutter die Eier
vergraben hat, bisweilen eine halbe Seemeile vom Flusse entfernt
iſt, mitten in der Nacht in gerader Richtung, ohne zu irren, zum
Wasser gingen. Er habe die Schildkröten wiederholt absichtlich
und verdeckt weit vom Ufer fortgetragen, dieſelben oft umgekehrt,
damit sie die Spur verlören, und dennoch nahmen sie den
geraden Weg zum Waſfser, sobald sie in Freiheit gesetzt wur-
den. Ein Seehund am Kap war auf das Land gekommen
und hatte ein Junges geworfen, als er von Jägern getötet
wurde. Natürlich wollten sie 'das Junge auch fangen, sie
kamen aber zu ſpät, denn es hatte bereits das Meer gewonnen,
von dem es doch keine Ahnung haben konnte.
Der Chirurg Champeau in Lyon hatte einst mehrere
Hunde zu wiſssenſchaftlichen Untersuchungen seziert. Bald
darauf besuchte er seinen Schwiegervater, dessen ſchöner großer
Haushund ihn sonſt stets freundlich bewillkommnet hatte. Nach-
dem ihn diesmal der Hund berochen, sträubten sich ſeine Haare
und ganz außer ſich vor Wut stürzte er sich auf den sonſt
lieben Hausfreund und hätte ihn übel zugerichtet, wenn man
ihm nicht ſchleunigst zu Hilfe geeilt wäre.
Professor Perty besaß einen jungen weiblichen Hund, der
durchaus nicht an Reinlichkeit zu gewöhnen war und überdies
während der Nacht einen solchen Lärm machte, daß es die
Bewohner im Schlummer störte. „Wir waren deshalb ge-
nötigt," erzählt der Professor selbst, „ihn die Nächte in einer
Eſtrichkammer zubringen zu lassen, wo er aber dann, obwohl
mit gutem Lager, Speiſe und Wasſer versorgt, gewöhnlich
mitten in der Nacht ſchrecklich zu heulen begann, so daß ich
mich genötigt sah, da alles nichts fruchtete, ihn einmal mit
der Reitgerte zu züchtigen. Anderen Tages, als ich, um aus-
zureiten, mit der Reitgerte ausging, folgte mir einige Zeit
in auffallender Weise ein männlicher Hühnerhund, fortwährend
mich und die Reitgerte beriechend, und begann endlich, mich
wütend und zähnefletſchend anzubellen, bis er mit ernsten
| Drohungen verscheucht wurde. Es ist nicht zu zweifeln, daß
dieser Hund an dem Geruch der Reitgerte erkannte, wozu sie
in der verfloſſenen Nacht gedient hatte, ganz so, wie der In-
dianer aus der Spur des Vorübergegangenen dessen Stamm,
Geschäft und Reisezweck oft mit staunenswerter Sicherheit
abzuleſen vermag.“ :
Einer meiner Freunde legte in seinem Garten, der einige
hundert Schritte von einem Bache entfernt lag, ein großes
Bassin an, um darin gewisse Wasſertiere zu beobachten. Eines
Tages setzte er ein Dutzend Flußkrebſe hinein, die er aus
einer anderen Gegend bezogen hatte. Allein am anderen
Morgen waren ſämtliche Krebſe aus dem Bassin verſchwun-
den. Nach längerem Suchen fand man sie auf dem Marsch
nach dem nahen Bächlein, von dem sie nicht mehr weit ent-
fernt waren. Das Bassin mußte von da ab mit einem Net
überſpannt werden, um das Entweichen dieser Tiere zu hin-
dern. Auch viele Insekten verraten bisweilen eine ungemein
feine Witterung, so daß es oft geradezu erstaunlich iſt, auf
welche Entfernungen sie eine versteckte Beute oder einen
nahenden Feind zu wittern vermögen. L. Ht.
Die Erziehung der Irauen. ~ Wie so manche andere
r ks prreuugte Netrr hrttgte az er tests
s Frau selbst erziehen könne, und sprach diese ſeine Ueber-
zeugung bei sich darbietenden Gelegenheiten oft genug aus.
Als Flahault Mitte der dreißiger Jahre als außerordent-
. 191
licher Gesandter Louis Philipps am Wiener Hofe weilte, saß er
bei einem Hofdiner der Gemahlin des Staatskanzlers Jürſte.1
Metternich zur Seite und bewunderte nicht nur deren Geiſt,
ſondern auch das außerordentlich ſchöne Diadem, das ihre
Stirne schmückte. Die Fürstin, hierdurch einigermaßen geniert
und durch die Fragen Flahaults nach der Herkunft des Dia-
dems geärgert, erwiderte endlich trocken: „Nun, mein Herr,
geſtohlen ist es jedenfalls nicht." Flahault verstand natürlich
ſehr gut, daß das eine Anspielung auf die Art und Weise
ſein sollte, wie sich sein Souverän in den Besitz der fran-
zöſiſchen Krone geseßt hatte. Er führte bei dem Fürsten
Klage darüber, indem er zugleich merken ließ, daß er den-
selben dafür verantwortlich mache, seine Frau nicht besser
erzogen zu haben. Metternich aber zuckte lächelnd die
Achſeln. „Frauen lassen sich nicht erziehen, Herr Graf,
wenigstens mir ist es nicht gelungen, auf die meinige in
dieſer Hinsicht einen Einfluß auszuüben,“ sagte er dann, und
nach dieſer Ablehnung blieb Flahault nichts übrig, als die
peinliche Affaire ruhen zu lassen. . R. M.
Ein ſtandhafter Lothringer. ~ Der berühmte Zeichner
und Kupferstecher Jacques Callot, gebürtig aus Nancy, zeichnete
sſich schon in seiner früheſten Jugend durch außerordentliche
Beharrlichkeit aus. Sein Vater wünſchte, daß er die Rechte
studiere, er aber wollte durchaus Maler werden und flehte
Gott täglich um zwei Gnaden an: erſtens, daß er, was auch
aus ihm werden sollte, sich immer vor anderen auszeichnen
möge, und dann, daß er nicht über 43 Jahre alt werde.
Beide Bitten sind in Erfüllung gegangen. /
Callot lebte von 1594~1635. Nachdem er sich in Rom und
Florenz zu einem trefflichen Künstler ausgebildet hatte, berief
ihn Ludwig RlII. an seinen Hof und übertrug ihm die Dar-
stellung der Befreiung der Inſel Ré und der Belagerung
von La Rochelle. Callot unterzog ſich seiner Aufgabe mit
großer Meisterſchaft. Als aber der ländergierige König, einen
Familienzwiſt mit seinem Bruder Gaſton von Orleans und
deſſen Verbindung mit der lothringiſchen Fürſtenfamilie als
Vorwand benutzend, 1633 Nancy eroberte und das Herzog-
tum dem franzöſiſchen Reich einverleibte, faßte der Künstler
gegen ihn einen unauslöſchlichen Haß. Er erklärte, als ihn
der König aufforderte, auch die Eroberung von Nancy zum
Gegenstand einer Darstellung zu machen, trotz der vorteil-
hafteſten Bedingungen unumwunden, man möge ihn mit
einem so entehrenden Auftrage verſchonen, nie werde er seinen
Grabſtichel einer ſo verächtlichen That widmen. Ein Höfling
wandte ein, man werde ihn zum Gehorſam zu bringen wiſſen.
Aber Callot erwiderte feſt: „Eher werde ich mir den Daumen
abbeißen, als Ehre und Vaterland vergessen.“ Diese Antwort
würde einen weniger einsichtsvollen Herrſcher beleidigt haben,
aber Ludwig sagte: „Jch wünschte nur, daß meine Franzosen
die gleiche Anhänglichkeit hätten, wie Callot an seinen ehe-
maligen Fürsten." Ludwig stellte ihm von neuem das An-
erbieten, er möge in seine Dienste treten, er bekäme jährlich
3000 Livres. Aber auch dies Gebot ſchlug er ſtandhaft mit
den Worten aus: „Jch bin ein Lothringer und will niemals
dem dienen, der ſo viel Unheil über meinen Fürsten und
mein Vaterland gebracht hat.“ ;
Zu Callots patriotiſchen Gram gesellten sich bald noch
Körperleiden; schon nach Jahresfriſt starb der auch als
Menſch so verehrungswürdige Künſtler. Dr.
auch. ein Lebensretter + Unter den Erinnerungen
des in den sechziger Jahren verstorbenen ſspaniſchen Obersten H.
findet ſich unter anderem folgendes Gespräch aufgezeichnet,
welches er mit einem ihm befreundeten Major führte: „Jm
Jahre 1848 war ich Flügeladjutant des Regenten Es-
partero und wurde nach ſeinem Sturze durch die gemäßigte
Partei unter der Beschuldigung des Hochverrats verhaftet.
Bald folgte meine Verurteilung und ich sollte am nächsten
Morgen ersſchoſſen werden.“
„Glücklicherweise,“ fiel mir hier mein Freund ins Wort,
„hatten Sie Verwandte oder Freunde, welche bei der jungen
Königin ihre Begnadigung erwirkten?"
„In der That, ein Greis wartete so lange, bis Jsa-
bella Il. den Palaſt von Ildefonso verließ, und flehte die
Milde der Königin zu meinen Gunsten an."
eh §Icif. Gut .ch! Mi z!etha f
„Keineswegs, mein lieber Major,“ antwortete H. kalt. -
blütig, „es war ein alter Wucherer, dem ich zehntausend Re-
alen schuldig war." C. T.
„war
Gefälliger Beachtung empfohlen!
Am den Anforderungen einer neuen Geſschmacksrichtung Rechnung zu tragen, haben wir für den abgeschlossenen Jahr-
igen gänzlich verſchiedene neue prachtvolle
Hriginal-Linbanddecke
in roter Leinwand mit reicher Deckel- und Rückenpreſsſung
Wir offerieren diese Decke, unker Hinweis auf nebenſtehende Abbildung derſelöen, zu dem äußerst billigen Preiſe von
m. nur 2 Mark pro stick “MT
j | und glauben, daß dieselbe jedem Besteller die Freude an unserer so überaus beliebten Zeitſchrift noch erhöhen wird. Man ver:
| ſchafft sich damit einen Prachtband von dauerndem Werte. Auch für den kaufenden Jahrgang 1898 des „„Zzuches ſür Allen.
iſt die Einbanddecke in gleicher Ausſtattung und zum gleichen Freiſe bereits zu haben.
Um nicht durch minderwertige Konkurrenzdecken geschädigt zu werden, wolle man stets die von der Verlagshandlung offerierte
: Original-Cinbanddecke
’]| verlangen; der Besteller ist dann berechtigt, jede andere zurückzuweisen. Zeichnung und künstlerische Form dieser Decke sind uufer
alleiniges Eigentum, das von niemandem nachgeahmt werden darf; zur Vermeidung von Verwechslungen lassen wir jede Decke
2\| | auf der Innenseite mit dem Stempel „Original-Einbanddecke der Verlagsbuchhandlung Union Deutſche Verlagsgesellſchaft“" rersehen.
Zu den früheren Jahrgängen ſind die bisherigen braunen Einbanddecken zum selben Preiſe zu beziehen.
Bestellungen nehmen alle Buchhändler. Journalexpedienten, Buchbinder, Kolporteure, sowie diejenigen Voten an, welche
die Hefte des gegenwärtigen Jahrgangs ins Haus bringen.
Deutsche Verkagsgeſellſchaft in Htuttgart, erkin, Leipzig.