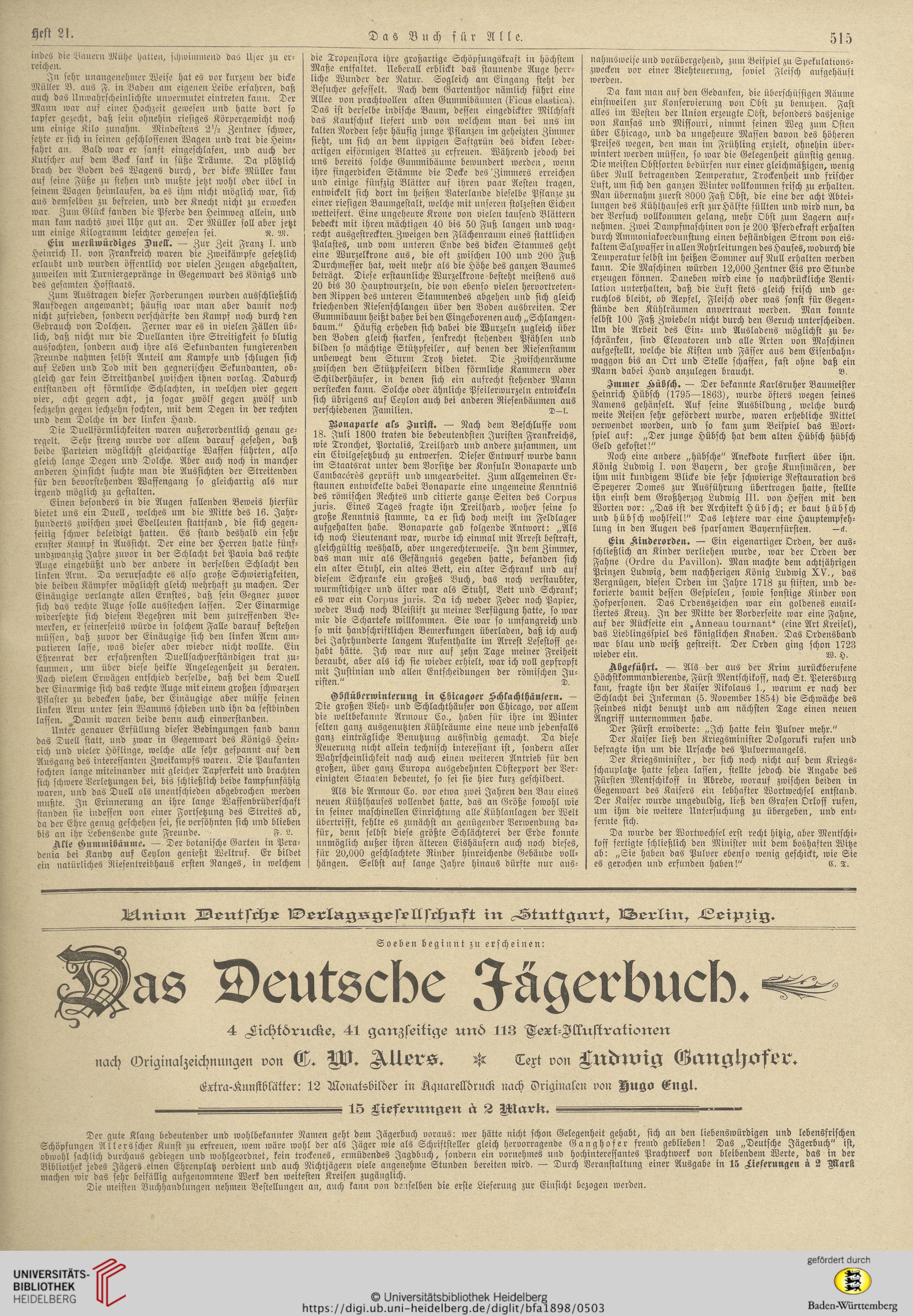Heft 21.
D a s B u < für A ! ke.
515
indes die Bauern Mühe hatten, ſchwimmend das Ujer zu er-
reichen.
In sehr unangenehmer Weise hat es vor kurzem der dicke
Müller B. aus F. in Baden am eigenen Leibe erfahren, daß
auch das Unwahrscheinlichſte unvermutet eintreten kann. Der
Mann war auf einer Hochzeit gewesen und hatte dort so
tapfer gezecht, daß sein ohnehin riesiges Körpergewicht noch
unm. einige Kilo zunahm. Mindestens 2'ſ2 Zentner schwer,
sette er ſich in ſeinen geschlossenen Wagen und trat die Heim-
fahrt an. Bald war er ſanft eingeschlafen, und auch der
Kutscher auf dem Bock sank in ſüße Träume. Da plötzlich
brach der Boden des Wagens durch, der dicke Müller kam
auf seine Füße zu stehen und mußte jetzt wohl oder übel in
seinem Wagen heimlaufen, da es ihm nicht möglich war, sich
_ aus demſelben zu befreien, und der Knecht nicht zu erwecken
war. Zum Glück fanden die Pferde den Heimweg allein, und
man kam nachts zwei Uhr gut an. Der Müller soll aber jett
um einige Kilogramm leichter gewesen sei. R. M.
Ein merkwürdiges Duell. ~ Zur Zeit Franz I. und
Heinrich Il. von Frankreich waren die Zweikämpfe geſeytlich
_ erlaubt und wurden öffentlich vor vielen Zeugen abgehalten,
zuweilen mit Turniergepränge in Gegenwart des Königs und
des geſamten Hofstaats. _
Zum Austragen dieser Forderungen wurden ausschließlich
Raufdegen angewandt; häufig war man aber damit noch
nicht zufrieden, sondern verſchärfte den Kampf noch durch ten
Gebrauch von Dolchen. Ferner war es in vielen Fällen üb-
lich, daß nicht nur die Duellanten ihre Streitigkeit so blutig
ausfochten, ſondern auch ihre als Sekundanten fungierenden
Freunde nahmen ſelbſt Anteil am Kampfe und ſchlugen ſich
auf Leben und Tod mit den gegneriſchen Sekundanten, ob-
_ gleich gar kein Streithandel zwiſchen ihnen vorlag. Dadurch
entstanden oft förmliche Schlachten, in welchen vier gegen
vier, acht gegen acht, ja sogar zwölf gegen zwölf und
sechzehn gegen ſechzehn fochten, mit dem Degen in der rechten
und dem Dolche in der linken Hand.
Die Duellförmlichkeiten waren außerordentlich genau ge-
“ S sp s
gleich lange Degen und Dolche. Aber auch noch in mancher
anderen Hinsicht ſuchte man die Aussichten der Streitenden
für den bevorſtehenden Waffengang so gleichartig als nur
irgend möglich zu gestalten.
Einen besonders in die Augen fallenden Beweis hierfür
bietet uns ein Duell, welches um die Mitte des 16. Jahr-
hunderts zwischen zwei Edelleuten stattfand, die sich gegen-
ſeitig ſchwer beleidigt hatten. Es stand deshalb ein sehr
_ ernster Kampf in Aussicht. Der eine der Herren hatte fünf-
undzwanzig Jahre zuvor in der Schlacht bei Pavia das rechte
Auge eingebüßt und der andere in derselben Schlacht den
linken Arm. Da verursachte es alſo große Schwierigkeiten,
die beiden Kämpfer möglichst gleich wehrhaft zu machen. Der
Einäugige verlangte allen Ernstes, daß sein Gegner zuvor
_ Yich das rechte Auge ſolle ausstechen laſſen. Der Einarmige
widersetzte ſich diesem Begehren mit dem zutreffenden Be-
merken, er ſeinerſeits würde in solchem Falle darauf bestehen
müſsſen, daß zuvor der Einäugige ſich den linken Arm am-
putieren laſſe, was dieser aber wieder nicht wollte. Ein
Ehrenrat der erfahrensten Duellsachverſtändigen trat zu-
sammen, um über diese heikle Angelegenheit zu beraten.
Nach vielem Erwägen entſchied derselbe, daß bei dem Duell
der Einarmige ſich das rechte Auge mit einem großen ſchwarzen
> HYPllaster zu bedecken habe, der Einäugige aber müsse seinen
linken Arm unter sein Wamms ſchieben und ihn da festbinden
laſſen. Damit waren beide denn auch einverstanden.
Unter genauer Erfüllung dieser Bedingungen fand dann
das Duell statt, und zwar in Gegenwart des Königs Hein-
rich und vieler Höflinge, welche alle sehr geſpannt auf den
Ausgang des interesſſanten Zweikampfs waren. Die Paukanten
fochten lange miteinander mit gleicher Tapferkeit und brachten
ſich ſchwere Verletzungen bei, bis ſchließlich beide kampfunfähig
waren, und das Duell als unentschieden abgebrochen werden
. mußte. In Erinnerung an ihre lange Waffenbrüdersſchaft
. ſtanden sie indessen von einer Fortſezung des Streites ab,
da der Ehre genug geſchehen sei, sie verſöhnten sich und hliehet
ig an ihr Lebensende gute Freunde. §
Alte Gummibäume. + Der botaniſche Garten in Pera-
denia bei Kandy auf Ceylon genießt Weltruf. Er bildet
ein natürliches Riesentreibhaus ersten Ranges, in welchem
ZJRMmißon Deutk;che Derlansgeſsel]ſchnft in Stuttgurt, Berlin, Leipzig.
ft
die Tropenflora ihre großartige Schöpfungskraft in höchſtem
Maße entfaltet. Ueberall erblickt das staunende Auge herr-
liche Wunder der Natur. Sogleich am Eingang steht der
Besucher gefeſſelt. Nach dem Gartenthor nämlich führt eine
Allee von prachtvollen alten Gummibäumen (Ficus elastica).
Das ist derselbe indiſche Baum, dessen eingedickter Milchsaft
das Kautſchuk liefert und von welchem man bei uns im
kalten Norden sehr häufig junge Pflanzen im geheizten Zimmer
sieht, um sich an dem üppigen Saftgrün des dicken leder-
artigen eiförmigen Blattes zu erfreuen. Während jedoch bei
uns bereits solche Gummibäume bewundert werden, wenn
ihre fingerdicken Stämme die Decke des ‘Zimmers erreichen
und einige fünfzig Blätter auf ihren paar Aesten tragen,
entwickelt sich dort im heißen Vaterlande dieselbe Pflanze zu
einer riesigen Baumgestalt, welche mit unseren stolzesten Eichen
wetteifert. Eine ungeheure Krone von vielen tauſend Blättern
bedeckt mit ihren mächtigen 40 bis 50 Fuß langen und wag-
recht ausgestreckten Zweigen den Flächenraum eines stattlichen
Palastes, und vom unteren Ende des dicken Stammes geht
eine Wurzelkrone aus, die oft zwiſchen 100 und 200 Fuß
Durchmesser hat, weit mehr als die Höhe des ganzen Baumes
beträgt. Diese erstaunliche Wurzelkrone besteht meistens aus
20 bis 30 Hauptwurzeln, die von ebenso vielen hervortreten-
den Rippen des unteren Stammendes abgehen und ſich gleich
kriechenden Riesenſchlangen über den Boden ausbreiten. Der
Gurmitout heißt daher bei den Eingeborenen auch „Schlangen-
aum.'
den Boden gleich starken, senkrecht stehenden Pfählen und
bilden so mächtige Stützpfeiler, auf denen der Riesensſtamm
unbewegt dem Sturm Trotz bietet. Die Zwiſchenräume
zwiſchen den Stützpfeilern bilden förmliche Kammern oder
Schilderhäuſer, in denen sich ein aufrecht stehender Mann
verstecken kann. Solche oder ähnliche Pfeilerwurzeln entwickeln
ſich übrigens auf Ceylon auch bei anderen Riesenbäumen aus
verschiedenen Familien. Dl.
Wonaparkte als Juriſt. ~ Nach dem Besſchluſſe vom
18. Juli 1800 traten die bedeutendsten Juristen Frankreichs,
wie Tronchet, Portalis, Treilhard und andere zuſammen, um
ein Civilgeſegbuch zu entwerfen. Dieser Entwurf wurde dann
im Staatsrat unter dem Vorſite der Konsuln Bonaparte und
Cambacérès geprüft und umgearbeitet. Zum allgemeinen Er-
staunen entwickelte dabei Bonaparte eine ungemeine Kenntnis
des römischen Rechtes und citierte ganze Seiten des Corpus
juris. Eines Tages fragte ihn Treilhard, woher ſeine so
große Kenntnis stamme, da er sich doch meiſt im Feldlager
aufgehalten habe. Bonaparte gab folgende Antwort: ,Als
ich noch Lieutenant war, wurde ich einmal mit Arrest bestraft,
gleichgültig weshalb, aber ungerechterweiſe. In dem Himmer,
das man mir als Gefängnis gegeben hatte, befanden ſsich
ein alter Stuhl, ein altes Bett, ein alter Schrank und auf
diesem Schranke ein großes Buch, das noch verstaubter,
wurmſtichiger und älter war als Stuhl, Bett und Schrank;
es war ein Corpus juris. Da ich weder Feder noch Papier,
weder Buch noch Bleistift zu meiner Verfügung hatte, so war
mir die Scharteke willklommen. Sie war so umfangreich und
sſo mit handſchriftlichen Bemerkungen überladen, daß ich auch
bei Jahrhunderte langem Aufenthalte im Arrest Leſeſtosf ge-
habt hätte. Ich war nur auf zehn Tage meiner Freiheit
beraubt, aber als ich sie wieder erhielt, war ich voll gepfropft
uit Juſtinian und allen Entscheidungen der römischen Ju-
riſten.“ D.
Obſtüberwinterung in Chicagoer Sch>achthäuſern. +
Die großen Vieh- und Schlachthäuſer von Chicago, vor allem
die weltbekannte Armour Co., haben für ihre im Winter
selten ganz ausgenutzten Kühlräume eine neue und jedenfalls
ganz. einträgliche Benutzung. ausfindig gemacht. Da diese
Neuerung nicht allein techniſch intereſſant iſt, sondern aller
Wahrſscheinlichkeit nach auch einen weiteren Antrieb für den
großen, über ganz Europa ausgedehnten Obſstexport der Ver-
einigten Staaten bedeutet, so sei ſie hier kurz geschildert.
Als die Armour Co. vor etwa zwei Jahren den Bau eines
neuen Kühlhauſes vollendet hatte, das an Größe sowohl wie
in seiner maschinellen Einrichtung alle Kühlanlagen der Welt
übertrifft, fehlte es zunächſt an genügender Verwendung da-
für, denn ſselbſt diese größte Schlächterei der Erde konnte
unmöglich außer ihren älteren Eishäuſern auch noch dieſes,
fir 20,000 geschlachtete Rinder hinreichende Gebäude voll-
hängen. Selbst auf lange Jahre hinaus dürfte nur aus-
Häufig erheben sich dabei die Wurzeln zugleich über
nahmsweiſe und vorübergehend, zum Beispiel zu Spekulations-
ſtvetet vor einer Viehteuerung, soviel Fleiſch aufgehäuft
werden.
Da kam man auf den Gedanken, die überſchüſſigen Räume
einstweilen zur Konservierung von Obst zu benutzen. Jaſt
alles im Westen der Union erzeugte Obst, besonders dasjenige
von Kansas und Missouri, nimmt seinen Weg zum Oſten
über Chicago, und da ungeheure Massen davon des höheren
Preiſes wegen, den man im Frühling erzielt, ohnehin über-
wintert werden müssen, so war die Gelegenheit günstig genug.
Die meisten Obstsorten bedürfen nur einer gleichmäßigen, wenig
über Null betragenden Temperatur, Trockenheit und friſcher
Luft, um sich den ganzen Winter vollkommen frisch zu erhalten.
Man übernahm zuerst 8000 Faß Obst, die eine der acht Abtei-
lungen des Kühlhauſes erst zur Hälfte füllten und wird nun, da
der Verſuch vollkommen gelang, mehr Obst zum Lagern auf-
nehmen. Zwei Dampfmaſchinen von je 200 Pferdekraft erhalten
durch Ammoniakverdunſstung einen beständigen Strom von eis-
kaltem Salzwasser in allen Rohrleitungen des Hauſes, wodurch die
Temperatur selbſt im heißen Sommer auf Null erhalten werden
kann. Die Maſchinen würden 12,000 Zentner Eis pro Stunde
erzeugen können. Daneben wird eine so nachdrückliche Venti-
lation unterhalten, daß die Luft stets gleich friſch und ge-
ruchlos bleibt, ob Aepfel, Fleiſch oder was sonst für Gegen-
stände den Kühlräumen anvertraut werden. Man konnte
selbſt 100 Faß Zwiebeln nicht durch den Geruch unterscheiden.
Um die Arbeit des Ein- und Ausladens möglichst zu be-
ſchränken, sind Elevatoren und alle Arten von Maſchinen
aufgestellt, welche die Kiſten und Fässer aus dem Eisenbahn-
waggon bis an Ort und Stelle ſchaffen, faſt ohne daß ein
Mann dabei Hand anzulegen braucht. V.
Immer Hübſch. ~ Der bekannte Karlsruher Baumeister
Heinrich Hübſch (17951863), wurde öfters wegen seines
Namens gehänselt. Auf seine Ausbildung , welche durch
weite Reiſen sehr gefördert wurde, waren erhebliche Mittel
verwendet worden, und so kam zum Beispiel das Wort-
her ef „Der junge Hübſch hat dem alten Hübſch hübſch
eld gekoſtet !‘ ;
Ncth eine andere „hübſche'" Anekdote kursiert über ihn.
König Ludwig I. von Bayern, der große Kunstmäcen, der
ihm mit kundigem Blicke die sehr schwierige Restauration des
Speyerer Domes zur Ausführung übertragen hatte, ſtellte
ihn einst dem Großherzog Ludwig IIl. von Hessen mit den
Worten vor: „Das ist der Architekt Hübſch; er baut hübſch
und hübſch wohlfeil!“" Das letztere war eine Hauptempfeh-
lung in den Augen des sparsamen Bayernfürſten. Ö.
Ein Kinderorden. ~ Ein eigenartiger Orden, der aus-
ſchließlich an Kinder verliehen wurde, war der Orden der
Fahne (Ordre du Pavillon). Man machte dem achtjährigen
Prinzen Ludwig, dem nachherigen König Ludwig XV., das
Vergnügen, diesen Orden im Jahre 1718 zu stiften, und de-
korierte damit deſſen Gespielen, sowie sonstige Kinder von
Hofperſonen. Das Ordenszeichen war ein goldenes email-
liertes Kreuz. In der Mitte der Vorderseite war eine Fahne,
auf der Rückseite ein „Anneau tournant“ (eine Art Kreisel),
das Lieblingsspiel des königlichen Knaben. Das Ordensband
war blau und weiß gestreift. Der Orden ging schon 1723
wieder ein. ; W. H.
Abgeführt. – Als der aus der Krim zurückberufene
Höchſtkommandierende, Fürst Mentschikoff, nach St. Petersburg
kam, fragte ihn der Kaiser Nikolaus I., warum er nach der
Schlacht bei JInkerman (5. November 1854) die Schwäche des
Feindes nicht benuzt und am nächsten Tage einen neuen
ngtisf Flrſt orwivertsr c Ich hatte kein Pulver mehr."
Der Kaiser ließ den Kriegsminister Dolgoruki rufen und
befragte ihn um die Ursache des Pulvermangels.
Der Kriegsminister, der sich noch nicht auf dem Kriegs-
ſchauplatze hatte sehen lassen, stellte jedoch die Angabe des
Fürsten Mentſchikoff in Abrede, worauf zwiſchen beiden in
Gegenwart des Kaiſers ein lebhafter Wortwechsel entstand.
Der Kaiser wurde ungeduldig, ließ den Grafen Orloff rufen,
um ihm die weitere Unterſuchung zu übergeben, und ent-
fernte sich.
_ Da wurde der Wortwechſel erſt recht hitig, aber Mentschn.
koſf fertigte ſchließlich den Minister mit dem boshaften Witze
ab: „Sie haben das Pulver ebenso wenig geschickt, tie Fir
es gerochen und erfunden haben !"
S o e b en beginnt zu erſcheinen:
4 Lichtorucke, 41 ganz>seitige und 118 Fext-Illuſtrationen
nach Originalzeichnungen von C. W. Allers. zl
as Deutsche JFägerbuch. =-
Text von Ludwig Ganaglheofer.
Extra-Kunſtblätter: 12 Wonatsbilder in Hquarelldruck nach Driginalen von Hugo Engl.
15 Lieferungen ù 2 Mark.
B 1pmp§ hilt. §1912 prheztrqver und weltteaurter Hanen qtht den Zugerbrch rgruug: V ( gt. lic. terte tretct pebtichen! Das „ Doutsche Jigerbuch " 1ji
obwohl sachlich durchaus gediegen und wohlgeordnet, kein trockenes, ermüdendes Jagdbuch, sondern ein vornehmes und hochinteresſantes Prachtwerk von bleibendem Werte, das in der
Bibliothek jedes Jägers einen Ehrenplatz verdient und auch Nichtjägern viele angenehme Stunden bereiten wird. – Durch Veranstaltung einer Ausgabe in 15 Lieferungen à 2 Mark
machen wir das sehr beifällig aufgenommene Werk den weitesten Kreisen zugänglich. ; , .. .
Die meisten Buchhandlungen nehmen Bestellungen an, auch kann von de:1selben die erste Lieferung zur Einsicht bezogen werden.