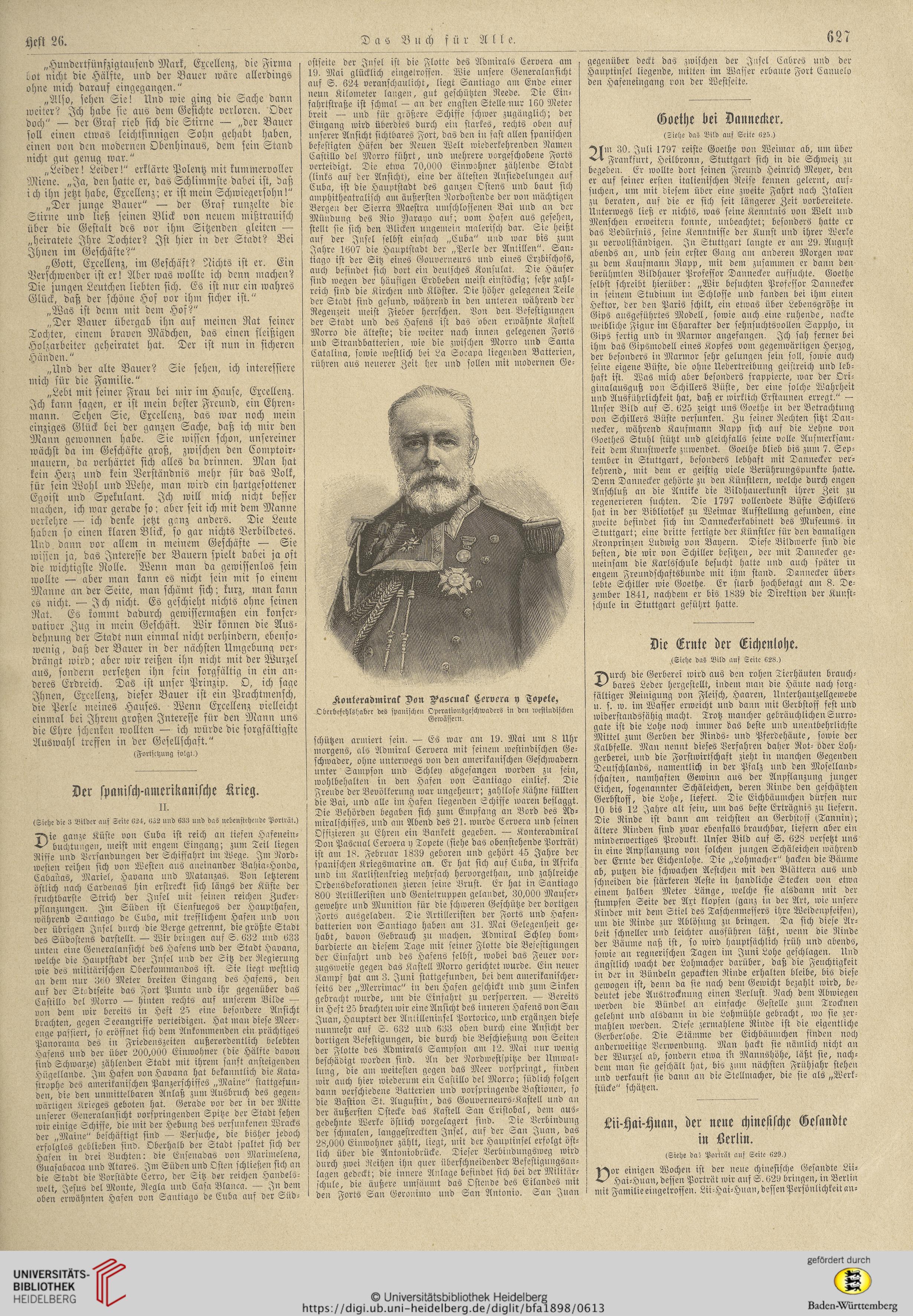_ Mann gewonnen habe.
Heft 26.
D as B u < f ür Al kl e.
627
bot nicht die Hälfte, und der Bauer wäre allerdings
ohne mich darauf eingegangen.“
„Alſo, ſehen Sie! Und wie ging die Sache dann
weiter? Ich habe ſie aus dem Gesichte verloren. Oder
doch“ ~ der Graf rieb sich die Stirne ~~ „der Bauer
soll einen etwas leichtſinnigen Sohn gehabt haben,
einen von den modernen Obenhinaus, dem sein Stand
nicht gut genug war.“
„Leider! Leider!“ erklärte Polen mit kummervoller
Miene. „Ja, den hatte er, das Schlimmſte dabei iſt, daß
ich ihn jett habe, Excellenz; er iſt mein Schwiegerſohn !“
„Der junge Bauer“ – der Graf runzelte die
Stirne und ließ ſseinen Blick von neuem mißtrauiſch
über die Gestalt des vor ihm Sigtzenden gleiten ~
„heiratete Ihre Tochter? Iſt hier in der Stadt? Bei
Ihnen im Geſchäfte?“ j
„Gott, Excellenz, im Geſchäft? Nichts iſt er. Ein
Verſchwender iſt er! Aber was wollte ich denn machen?
Die jungen Leutchen liebten ſich. Es iſt nur ein wahres
Glück, daß der ſchöne Hof vor ihm ſicher iſt.“
„Was iſt denn mit dem Hof?"
„Der Bauer übergab ihn auf meinen Rat ſeiner
Tochter, einem braven Mädchen, das einen fleißigen
Htlzärbeiter geheiratet hat. Der iſt nun in ſicheren
Händen.“
„Und der alte Bauer? Sie ſehen, ich intereſsiere
mich für die Familie.“
„Lebt mit seiner Frau bei mir im Hauſe, Excellenz.
Ich kann sagen, er iſt mein bester Freund, ein Ehren-
mann. Sehen Sie, Excellenz, das war noch mein
einziges Glück bei der ganzen Sache, daß ich mir den
Sie wissen ſchon, unſsereiner
wächſt da im Geschäfte groß, zwiſchen den Comptoir-
mauern, da verhärtet sich alles da drinnen. Man hat
kein Herz und kein Verſtändnis mehr für das Volk,
für ſein Wohl und Wehe, man wird ein hartgesſottener
Egoiſt und Spekulant. Ich will mich nicht beſſer
machen, ich war gerade so; aber seit ich mit dem Manne
verkehre – ich denke jezt ganz anders. Die Leute
haben so einen klaren Blick, so gar nichts Verbildetes.
Und dann vor allem in meinem Geſchäfte – Sie
wiſſen ja, das Intereſſe der Bauern ſpielt dabei ja oft
die wichtigſte Rolle. Wenn man da gewiſsenlos ſein
wollte – aber man kann es nicht ſein mit so einem |
Manne an der Seite, man ſchämt sich; kurz, man kann
es nicht. – Ich nicht. Es geſchieht nichts ohne seinen
Rat. Es kommt dadurch gewissermaßen ein konſer-
vativer Zug in mein Geschäft. Wir können die Aus-
dehnung der Stadt nun einmal nicht verhindern, ebenſo-
wenig , daß der Bauer in der nächſten Umgebung ver-
drängt wird; aber wir reißen ihn nicht mit der Wurzel
aus, sondern verſeßen ihn fein sorgfältig in ein an-
deres Erdreich. Das iſt unſer Prinzip. O, ich ſage
Ihnen, Excellenz, dieser Bauer iſt ein Prachtmenſch,
die Perle meines Hauſes. Wenn Exrcellenz vielleicht
einmal bei Ihrem großen Intereſſe für den Mann uns
die Ehre ſchenken wollten ~ ich würde die ſorgfältigſte
Auswahl treffen in der Geſellſchaft. “
; f (Fortſezung folgt.)
Der ſpaniſch-amerikaniſche Krieg.
. u
(Siehe die 3 Bilder auf Seite 624, 632 und 633 und das nebenſtehende Porträt.)
D'! ganze Küſte von Cuba ist reich an tiefen Hafenein-
buchtungen, meist mit engem Eingang; zum Teil liegen
Riffe und Verſandungen der Schiffahrt im Wege. Im Nord-
westen reihen sich von Westen aus aneinander Bahia-Honda,
Cabafas, Mariel, Havana und Matanzas. Von letterem
öſtlich nach Cardenas hin erſtreckt ſich längs der Küste der
fruchtbarſte Strich der Inſel mit ſeinen reichen Zucker-
pflanzungen. Im Süden ist Cienfuegos der Haupthafen,
während Santiago de Cuba, mit trefflichem Hafen und von
der übrigen Insel durch die Berge getrennt, die größte Statt
des Südostens darſtellt. – Wir bringen auf S. 682 und 638
unten eine Generalansicht des Hafens und der Stadt Havana,
welche die Hauptstadt der Insel und der Sit der Regierung
wie des militärischen Oberkommandos iſt. Sie liegt weſtlich
an dem nur 360 Meter breiten Eingang des Hafens, den
auf der Stodtseite das Fort Punta und ihr gegenüber das
Castillo del Morro ~ hinten rechts auf unserem Bilde ~
von dem wir bereits in Heft 25 eine besondere Ansicht
brachten, gegen Seeangriffe verteidigen. Hat man dieſe Meer- |
enge paſſiert, so eröffnet sich dem Ankonmmenden ein prächtiges
Panorama des in Friedenszeiten außerordentlich belebten
Hafens und der über 200,000 Einwohner (die Hälfte davon
ſind Schwarze) zählenden Stadt mit ihrem ſanft ansteigenden
Hügellande. Im Hafen von Havana hat bekanntlich die Kata-
sirophe des amerikaniſchen Panzerſchiffes „Maine“ ſtattgefun-
den, die den unmittelbaren Anlaß zum Ausbruch des gegen-
wärtigen Krieges geboten hat. Gerade vor der in der Mitte
unserer Generalanſicht vorspringenden Spite der Stadt sehen
wir einige Schiffe, die mit der Hebung des verſunkenen Wracks
der „Maine“ beschäftigt ſind ~ Versuche, die bisher jedoch
erfolglos geblieben ſind. Oberhalb der Stadt ſpaltet ſich der
Hafen in drei Buchten: die Ensenadas von Marimelena,
Guaſabacoa und Atares. Jm Süden und Oſten ſchließen sich an
die Stadt die Vorstädte Cerro, der Sitz der reichen Handels-
welt, Jeſus del Monte, Regla und Caſa Blanca. + In dem
oben erwähnten Hafen von Santiago de Cuba auf der Süd-
„Hundertfünfzigtauſend Mark, Excellenz, die Firma ,
oſtſeite der Insel ist die Flotte des Admirals Cervera am
19. Mai glücklich eingetroffen. Wie unsere Generalansicht
auf S. 624 veranſchaulicht, liegt Santiago am Ende einer
neun Kilometer langen, gut geschütten Reede. Die Ein-
fahrtstraße iſt ſchmal ~ an der engsten Stelle nur 160 Meter
breit ~ und für größere Schiffe ſchwer zugänglich; der
Eingang wird überdies durch ein starkes, rechts oben auf
unserer Ansicht sichtbares Fort, das den in fast allen ſpaniſchen
befestigten Häfen der Neuen Welt wiederkehrenden Namen
Castillo del Morro führt, und mehrere vorgeſchobene Forts
verteidigt. Die etwa 70,000 Einwohner zählende Stadt
(links auf der Ansicht), eine der ältesten Ansiedelungen auf
Cuba, ist die Hauptſtadt des ganzen Oſtens und baut ſich
amphitheatraliſch am äußersten Nordostende der von mächtigen
Bergen der Sierra Maeſtra uniſchloſſenen Bai und an der
Mündung des Rio Yarayo auf; vom Hafen aus gesehen,
stellt sie ſich den Blicken ungemein maleriſch dar. Sie heißt
auf der Insel selbſt einfach „Cuba“ und war bis zum
Jahre 1607 die Hauptstadt der „Perle der Antillen“. San-
tiago iſt der Sit eines Gouverneurs und eines Erzbiſchofs,
auch befindet sich dort ein deulſches Konſulat. Die Häuſer
sind wegen der häufigen Erdbeben meiſt einstöckig; sehr zahl-
reich sind die Kirchen und Klöster. Die höher gelegenen Teile
der Stadt sind gesund, während in den unteren während der
Regenzeit meiſt Fieber herrſchen. Von den. Befestigungen
der Stadt und des Hafens iſt das oben erwähnte Kaſltell
Morro die älteste; die weiter nach innen gelegenen Forts
und Strandbatterien, wie die zwiſchen Morro und Santa
Catalina, sowie westlich bei La Socapa liegenden Batterien,
rühren aus neuerer Zeit her und sollen mit modernen Ge-
KHonteradmiraC Don Pascual Cervera y Topetle,
Oberbefehlshaber des ſpaniſchen Hrttetonssetmuuvers in den weſtindiſchen
schützen armiert ſein. – Es war am 19. Mai um s Uhr
morgens, als Admiral Cervera mit seinem westindiſchen Ge-
schwader, ohne unterwegs von den amerikanischen Geschwadern
unter Sampſon und Schley abgefangen worden zu ſein,
wohlbehalten in den Hafen von Santiago einlief. Die
Jreude der Bevölkerung war ungeheuer; zahllose Kähne füllten
die Bai, und alle im Hafen liegenden Schiffe waren beflaggt.
Die Behörden begaben ſich zum Empfang an Bord des Ad-
miralſchiffes, und am Abend des 21. wurde Cervera und seinen
Offizieren zu Ehren ein Bankett gegeben. ~ Konteradmiral
Don Pascual Cervera y Topete (ſiehe das obenstehende Porträt)
iſt am 18. Februar 1839 geboren und gehört 45 Jahre der
spaniſchen Kriegsmarine an. Er hat sich auf Cuba, in Afrika.
und im Karliſtenkrieg mehrfach hervorgethan, und zahlreiche
Ordensdekorationen zieren seine Bruſt. Er hat in Santiago
800 Artilleriſten und Genietruppen gelandet, 30,000 Mauſer-
gewehre und Munition für die ſchweren Geſchütze der dortigen
Forts ausgeladen. Die Artilleriſten der Forts und Hafen:
batterien von Santiago haben am 831. Mai Gelegenheit ge-
habt, davon Gebrauch zu machen. Admiral Schley bom-
bardierte an dieſem Tage mit seiner Flotte die Befeſtigungen
der Einfahrt und des Hafens ſelbſt, wobei das Feuer vor-
zugsweiſe gegen das Kaſtell Morro gerichtet wurde. Ein neuer
Kampf hat am 3. Juni stattgefunden, bei dem amerikaniſcher-
seits der „Merrimae“ in den Hafen geschickt und zum Sinken
gebracht wurde, um die Einfahrt zu verſperren. ~ Bereits
in Hefi 25 brachten wir eine Ansicht des inneren Hafens von San
Juan, Hauptsrt der Antilleninsel Portorico, und ergänzen diese
nunmehr auf S. 632 und 6838 oben durch eine Ansicht der
dortigen Befestigungen, die durch die Beschießung von Seiten
der Flotte des Admirals Sampson am 12. Mai nur wenig
beſchädigt worden ſind. An der Nordwestſpiße der Ummal-
lung, die am weitesten gegen das Meer vorsſpringt, finden
wir auch hier wiederum ein Caſtillo del Morro; ſüdlich folgen
dann verschiedene Batterien und vorspringende Baſtionen, so
die Baſtion St. Augustin, das Gouverneurs-Kaſtell und an
der äußerſten Oſtecke das Kaſtell San Criſtobal, dem aus-
gedehnte Werke öſtlich vorgelagert sind. Die Verbindung
der schmalen, langgestreckten Insel, auf der San Juan, das
28,000 Einwohner zählt, liegt, mit der Hauptinsel erfolgt öſt-
lich über die Antoniobrücke. Dieſer Verbindungsweg wird
durch zwei Reihen ihn quer überſchneidender Befeſtigungsan-
lagen gedeckt; die innere Anlage befindet ſich bei der Militär-
ſchule, die äußere umſäumt das Ostende des Eilandes mit
den Forts San Geronimo und San Antonio. San Juan
gegenüber deckt das zwiſchen der Jnſel Cabres und der
Hauptinsel liegende, mitten im Waſser erbaute Fort Canuelo
den Hafeneingang von der Westseite.
Goethe bei Dannecker.
(Siehe das Bild auf Seite 625.)
IM! 30. Juli 1797 reiſte Goethe von Weimar ab, um über
Frankfurt, Heilbronn, Stuttgart sich in die Schweiz zu
begeben. Er wollte dort seinen Freund Heinrich Meyer, den
er auf seiner ersten italieniſchen Reiſe kennen gelernt, auf-
suchen, um mit diesem über eine zweite Fahrt nach Italien
zu beraten, auf die er sich seit längerer Zeit vorbereitete.
Unterwegs ließ er nichts, was seine Kenntnis von Welt unuan
Menschen erweitern konnte, unbeachtet; besonders hatte er
das Bedürfnis, seine Kenntnisse der Kunst und ihrer Werke
zu vervollständigen. In Stuttgart langte er am 29. Auguſt
abends an, und sein ersſter Gang am anderen Morgen war
zu dem Kaufmann Rapp, mit dem zuſammen er dann den
berühmten Bildhauer Profeſſor Dannecker aufsuchte. Goethe
selbſt ſchreibt hierüber: „Wir besuchten Profeſſor Dannecker
in seinem Studium im Schlosse und fanden bei ihm einen
Hektor, der den Paris ſchilt, ein etwas über Lebensgröße in
Gips ausgeführtes Modell, sowie auch .eine ruhende, nackte
weibliche Figur im Charakter der sſehnſuchtsvollen Sappho, in
Gips fertig und in Marmor angefangen. Ich sah ferner bei
ihm das Gipsmodell eines Kopfes vom gegenwärtigen Herzog,
der besonders in Marmor ſehr gelungen ſein ſoll, ſowie auch
seine eigene Büſte, die ohne Uebertreibung geiſtreich und leb-
haft iſt. Was mich aber besonders frappierte, war der Ori-
ginalausguß von Schillers Büſte, der eine solche Wahrheit
und Ausführlichkeit hat, daß er wirklich Erſtaunen erregt." ~
Unser Bild auf S. 625 zeigt uns Goethe in der Betrachtung
von Schillers Büſte versunken. Zu seiner Rechten ſittt Dan-
necker, während Kaufmann Rapp ſich auf die Lehne von
Goethes Stuhl stützt und gleichfalls seine volle Aufmerkſam-
keit dem Kunstwerke zuwendet. Goelhe blieb bis zum 7. Sep-
tember in Stuttgart, besonders lebhaft mit Dannecker ver-
kehrend, mit dem er geiſtig viele Berührungspunkte hatte.
Denn Dannecker gehörte zu den Künſtlern, welche durch engen
Anſchluß an die Antike die Bildhauerkunst ihrer Zeit zu
regenerieren ſuchten. Die 1797 vollendete Büſte Schillers
hat in der Bibliothek zu Weimar Aufstellung gefunden, eine
zweite befindet ſich im Danneckerkabinett des Muſeums. in
Stuttgart; eine dritte fertigte der Künſtler für den damaligen
Kronprinzen Ludwig von Bayern. Diese Bildwerke ſind die
beſten, die wir von Schiller besißen, der mit Dannecker ge-
meinsam die Karlsſchule besucht hatte und auch später in
engem FJreundſchaftsbunde mit ihm stand. Dannecker über-
lebte Schiller wie Goethe. Er starb hochbetagt am 8. De-
zember 1841, nachdem er bis 1839 die Direktion der Kunſt-
ſchule in Stuttgart geführt hatte.
Die Ernte der Eichenlohe.
(Siehe das Bild auf Seite 6289
D'? die Gerberei wird aus den rohen Tierhäuten brauch-
bares Leder hergestellt, indem man die Häute nach ſorg-
fältiger Reinigung von Fleiſch, Haaren, Unterhautzellgewebe
u. s. w. im Wasser erweicht und dann mit Gerbſtoff fest und
widerstandsfähig macht. Trotz mancher gebräuchlichen Surro-
gate iſt die Lohe noch immer das beste und unentbehrlichſte
Mittel zum Gerben der Rinds- und Pferdehäute, sowie der
Kalbfelle. Man nennt dieses Verfahren daher Rot- oder Loh-
gerberei, und die Forſtwirtſchaft zieht in manchen Gegenden
Deutſchlands, namentlich in der Pfalz und den Moſelland-
ſchaften, namhaften Gewinn aus der Anpflanzung junger
Eichen, sogenannter Schäleichen, deren Rinde den geſchätten
Gerbstoff, die Lohe, liefert. Die Cichbäumchen dürfen nur
10 bis 12 Jahre alt sein, um das beste Erträgnis zu liefern.
Die Rinde ist dann am reichſten an Gerbſtoff (Tannin);
ältere Rinden sind zwar ebenfalls brauchbar, liefern aber ein
minderwertiges Produkt. Unser Bild auf S. 628 versetzt uns
in eine Anpflanzung von solchen jungen Schäleichen während
der Ernte der Eichenlohe. Die „Lohmacher" hacken die Bäume
ab, putzen die ſchwachen Aestchen mit den Blättern aus und
schneiden die stärkeren Aeſte in handliche Stecken von etwa
einem halben Meter Länge, welche sſie alsdann mit der
stumpfen Seite der Art klopfen (ganz in der Art, wie unsere
Kinder mit dem Stiel des Taſchenmeſſers ihre Weidenpfeifen),
um die Rinde zur Ablöſung zu bringen. Da ſich dieſe Ar-
beit schneller und leichter ausführen läßt, wenn die Rinde
der Bäume naß iſt, so wird hauptſächlich früh und abends,
ſowie an regneriſchen Tagen im Juni Lohe geſchlagen. Und
ängstlich wacht der Lohmacher darüber, daß die Feuchtigkeit
in der in Bündeln gepackten Rinde erhalten bleibe, bis diese
gewogen ist, denn da sie nach dem Gewicht bezahlt wird, be-
deutet jede Austrocknung einen Verluſt. Nach dem Abwiegen
werden die Bündel an einfache Geſstelle zum Trocknen
gelehnt und alsdann in die Lohmühle gebracht, wo ſsie zer-
mahlen werden. Diese zermahlene Rinde iſt die eigentliche
Gerbertohe. Die Stämme der Eichbäumchen finden noch
anderweitige Verwendung. Man hackt ſie nämlich nicht an
der Wurzel ab, ſondern etwa ihn Mannshöhe, läßt sie, nach-
dem man ſie geſchält hat, bis zum nächsten Frühjahr ſtehen
und verkauft sie dann an die Stellmacher, die ſie als „Werk-
stücke" schätzen.
Lii-Hai-Huan, der neue chineſiſche Gesandte
in Berlin.
(Siehe da? Porträt auf Seite 629.)
V: einigen Wochen iſt der neue chineſiſche Gesandte Lii-
Hai-Huan, deſſen Porträt wir auf S. 629 bringen, in Berlin
mit Familieeingetroffen. Lii-Hai-Huan, deſſen Perſönlichkeit an-
Heft 26.
D as B u < f ür Al kl e.
627
bot nicht die Hälfte, und der Bauer wäre allerdings
ohne mich darauf eingegangen.“
„Alſo, ſehen Sie! Und wie ging die Sache dann
weiter? Ich habe ſie aus dem Gesichte verloren. Oder
doch“ ~ der Graf rieb sich die Stirne ~~ „der Bauer
soll einen etwas leichtſinnigen Sohn gehabt haben,
einen von den modernen Obenhinaus, dem sein Stand
nicht gut genug war.“
„Leider! Leider!“ erklärte Polen mit kummervoller
Miene. „Ja, den hatte er, das Schlimmſte dabei iſt, daß
ich ihn jett habe, Excellenz; er iſt mein Schwiegerſohn !“
„Der junge Bauer“ – der Graf runzelte die
Stirne und ließ ſseinen Blick von neuem mißtrauiſch
über die Gestalt des vor ihm Sigtzenden gleiten ~
„heiratete Ihre Tochter? Iſt hier in der Stadt? Bei
Ihnen im Geſchäfte?“ j
„Gott, Excellenz, im Geſchäft? Nichts iſt er. Ein
Verſchwender iſt er! Aber was wollte ich denn machen?
Die jungen Leutchen liebten ſich. Es iſt nur ein wahres
Glück, daß der ſchöne Hof vor ihm ſicher iſt.“
„Was iſt denn mit dem Hof?"
„Der Bauer übergab ihn auf meinen Rat ſeiner
Tochter, einem braven Mädchen, das einen fleißigen
Htlzärbeiter geheiratet hat. Der iſt nun in ſicheren
Händen.“
„Und der alte Bauer? Sie ſehen, ich intereſsiere
mich für die Familie.“
„Lebt mit seiner Frau bei mir im Hauſe, Excellenz.
Ich kann sagen, er iſt mein bester Freund, ein Ehren-
mann. Sehen Sie, Excellenz, das war noch mein
einziges Glück bei der ganzen Sache, daß ich mir den
Sie wissen ſchon, unſsereiner
wächſt da im Geschäfte groß, zwiſchen den Comptoir-
mauern, da verhärtet sich alles da drinnen. Man hat
kein Herz und kein Verſtändnis mehr für das Volk,
für ſein Wohl und Wehe, man wird ein hartgesſottener
Egoiſt und Spekulant. Ich will mich nicht beſſer
machen, ich war gerade so; aber seit ich mit dem Manne
verkehre – ich denke jezt ganz anders. Die Leute
haben so einen klaren Blick, so gar nichts Verbildetes.
Und dann vor allem in meinem Geſchäfte – Sie
wiſſen ja, das Intereſſe der Bauern ſpielt dabei ja oft
die wichtigſte Rolle. Wenn man da gewiſsenlos ſein
wollte – aber man kann es nicht ſein mit so einem |
Manne an der Seite, man ſchämt sich; kurz, man kann
es nicht. – Ich nicht. Es geſchieht nichts ohne seinen
Rat. Es kommt dadurch gewissermaßen ein konſer-
vativer Zug in mein Geschäft. Wir können die Aus-
dehnung der Stadt nun einmal nicht verhindern, ebenſo-
wenig , daß der Bauer in der nächſten Umgebung ver-
drängt wird; aber wir reißen ihn nicht mit der Wurzel
aus, sondern verſeßen ihn fein sorgfältig in ein an-
deres Erdreich. Das iſt unſer Prinzip. O, ich ſage
Ihnen, Excellenz, dieser Bauer iſt ein Prachtmenſch,
die Perle meines Hauſes. Wenn Exrcellenz vielleicht
einmal bei Ihrem großen Intereſſe für den Mann uns
die Ehre ſchenken wollten ~ ich würde die ſorgfältigſte
Auswahl treffen in der Geſellſchaft. “
; f (Fortſezung folgt.)
Der ſpaniſch-amerikaniſche Krieg.
. u
(Siehe die 3 Bilder auf Seite 624, 632 und 633 und das nebenſtehende Porträt.)
D'! ganze Küſte von Cuba ist reich an tiefen Hafenein-
buchtungen, meist mit engem Eingang; zum Teil liegen
Riffe und Verſandungen der Schiffahrt im Wege. Im Nord-
westen reihen sich von Westen aus aneinander Bahia-Honda,
Cabafas, Mariel, Havana und Matanzas. Von letterem
öſtlich nach Cardenas hin erſtreckt ſich längs der Küste der
fruchtbarſte Strich der Inſel mit ſeinen reichen Zucker-
pflanzungen. Im Süden ist Cienfuegos der Haupthafen,
während Santiago de Cuba, mit trefflichem Hafen und von
der übrigen Insel durch die Berge getrennt, die größte Statt
des Südostens darſtellt. – Wir bringen auf S. 682 und 638
unten eine Generalansicht des Hafens und der Stadt Havana,
welche die Hauptstadt der Insel und der Sit der Regierung
wie des militärischen Oberkommandos iſt. Sie liegt weſtlich
an dem nur 360 Meter breiten Eingang des Hafens, den
auf der Stodtseite das Fort Punta und ihr gegenüber das
Castillo del Morro ~ hinten rechts auf unserem Bilde ~
von dem wir bereits in Heft 25 eine besondere Ansicht
brachten, gegen Seeangriffe verteidigen. Hat man dieſe Meer- |
enge paſſiert, so eröffnet sich dem Ankonmmenden ein prächtiges
Panorama des in Friedenszeiten außerordentlich belebten
Hafens und der über 200,000 Einwohner (die Hälfte davon
ſind Schwarze) zählenden Stadt mit ihrem ſanft ansteigenden
Hügellande. Im Hafen von Havana hat bekanntlich die Kata-
sirophe des amerikaniſchen Panzerſchiffes „Maine“ ſtattgefun-
den, die den unmittelbaren Anlaß zum Ausbruch des gegen-
wärtigen Krieges geboten hat. Gerade vor der in der Mitte
unserer Generalanſicht vorspringenden Spite der Stadt sehen
wir einige Schiffe, die mit der Hebung des verſunkenen Wracks
der „Maine“ beschäftigt ſind ~ Versuche, die bisher jedoch
erfolglos geblieben ſind. Oberhalb der Stadt ſpaltet ſich der
Hafen in drei Buchten: die Ensenadas von Marimelena,
Guaſabacoa und Atares. Jm Süden und Oſten ſchließen sich an
die Stadt die Vorstädte Cerro, der Sitz der reichen Handels-
welt, Jeſus del Monte, Regla und Caſa Blanca. + In dem
oben erwähnten Hafen von Santiago de Cuba auf der Süd-
„Hundertfünfzigtauſend Mark, Excellenz, die Firma ,
oſtſeite der Insel ist die Flotte des Admirals Cervera am
19. Mai glücklich eingetroffen. Wie unsere Generalansicht
auf S. 624 veranſchaulicht, liegt Santiago am Ende einer
neun Kilometer langen, gut geschütten Reede. Die Ein-
fahrtstraße iſt ſchmal ~ an der engsten Stelle nur 160 Meter
breit ~ und für größere Schiffe ſchwer zugänglich; der
Eingang wird überdies durch ein starkes, rechts oben auf
unserer Ansicht sichtbares Fort, das den in fast allen ſpaniſchen
befestigten Häfen der Neuen Welt wiederkehrenden Namen
Castillo del Morro führt, und mehrere vorgeſchobene Forts
verteidigt. Die etwa 70,000 Einwohner zählende Stadt
(links auf der Ansicht), eine der ältesten Ansiedelungen auf
Cuba, ist die Hauptſtadt des ganzen Oſtens und baut ſich
amphitheatraliſch am äußersten Nordostende der von mächtigen
Bergen der Sierra Maeſtra uniſchloſſenen Bai und an der
Mündung des Rio Yarayo auf; vom Hafen aus gesehen,
stellt sie ſich den Blicken ungemein maleriſch dar. Sie heißt
auf der Insel selbſt einfach „Cuba“ und war bis zum
Jahre 1607 die Hauptstadt der „Perle der Antillen“. San-
tiago iſt der Sit eines Gouverneurs und eines Erzbiſchofs,
auch befindet sich dort ein deulſches Konſulat. Die Häuſer
sind wegen der häufigen Erdbeben meiſt einstöckig; sehr zahl-
reich sind die Kirchen und Klöster. Die höher gelegenen Teile
der Stadt sind gesund, während in den unteren während der
Regenzeit meiſt Fieber herrſchen. Von den. Befestigungen
der Stadt und des Hafens iſt das oben erwähnte Kaſltell
Morro die älteste; die weiter nach innen gelegenen Forts
und Strandbatterien, wie die zwiſchen Morro und Santa
Catalina, sowie westlich bei La Socapa liegenden Batterien,
rühren aus neuerer Zeit her und sollen mit modernen Ge-
KHonteradmiraC Don Pascual Cervera y Topetle,
Oberbefehlshaber des ſpaniſchen Hrttetonssetmuuvers in den weſtindiſchen
schützen armiert ſein. – Es war am 19. Mai um s Uhr
morgens, als Admiral Cervera mit seinem westindiſchen Ge-
schwader, ohne unterwegs von den amerikanischen Geschwadern
unter Sampſon und Schley abgefangen worden zu ſein,
wohlbehalten in den Hafen von Santiago einlief. Die
Jreude der Bevölkerung war ungeheuer; zahllose Kähne füllten
die Bai, und alle im Hafen liegenden Schiffe waren beflaggt.
Die Behörden begaben ſich zum Empfang an Bord des Ad-
miralſchiffes, und am Abend des 21. wurde Cervera und seinen
Offizieren zu Ehren ein Bankett gegeben. ~ Konteradmiral
Don Pascual Cervera y Topete (ſiehe das obenstehende Porträt)
iſt am 18. Februar 1839 geboren und gehört 45 Jahre der
spaniſchen Kriegsmarine an. Er hat sich auf Cuba, in Afrika.
und im Karliſtenkrieg mehrfach hervorgethan, und zahlreiche
Ordensdekorationen zieren seine Bruſt. Er hat in Santiago
800 Artilleriſten und Genietruppen gelandet, 30,000 Mauſer-
gewehre und Munition für die ſchweren Geſchütze der dortigen
Forts ausgeladen. Die Artilleriſten der Forts und Hafen:
batterien von Santiago haben am 831. Mai Gelegenheit ge-
habt, davon Gebrauch zu machen. Admiral Schley bom-
bardierte an dieſem Tage mit seiner Flotte die Befeſtigungen
der Einfahrt und des Hafens ſelbſt, wobei das Feuer vor-
zugsweiſe gegen das Kaſtell Morro gerichtet wurde. Ein neuer
Kampf hat am 3. Juni stattgefunden, bei dem amerikaniſcher-
seits der „Merrimae“ in den Hafen geschickt und zum Sinken
gebracht wurde, um die Einfahrt zu verſperren. ~ Bereits
in Hefi 25 brachten wir eine Ansicht des inneren Hafens von San
Juan, Hauptsrt der Antilleninsel Portorico, und ergänzen diese
nunmehr auf S. 632 und 6838 oben durch eine Ansicht der
dortigen Befestigungen, die durch die Beschießung von Seiten
der Flotte des Admirals Sampson am 12. Mai nur wenig
beſchädigt worden ſind. An der Nordwestſpiße der Ummal-
lung, die am weitesten gegen das Meer vorsſpringt, finden
wir auch hier wiederum ein Caſtillo del Morro; ſüdlich folgen
dann verschiedene Batterien und vorspringende Baſtionen, so
die Baſtion St. Augustin, das Gouverneurs-Kaſtell und an
der äußerſten Oſtecke das Kaſtell San Criſtobal, dem aus-
gedehnte Werke öſtlich vorgelagert sind. Die Verbindung
der schmalen, langgestreckten Insel, auf der San Juan, das
28,000 Einwohner zählt, liegt, mit der Hauptinsel erfolgt öſt-
lich über die Antoniobrücke. Dieſer Verbindungsweg wird
durch zwei Reihen ihn quer überſchneidender Befeſtigungsan-
lagen gedeckt; die innere Anlage befindet ſich bei der Militär-
ſchule, die äußere umſäumt das Ostende des Eilandes mit
den Forts San Geronimo und San Antonio. San Juan
gegenüber deckt das zwiſchen der Jnſel Cabres und der
Hauptinsel liegende, mitten im Waſser erbaute Fort Canuelo
den Hafeneingang von der Westseite.
Goethe bei Dannecker.
(Siehe das Bild auf Seite 625.)
IM! 30. Juli 1797 reiſte Goethe von Weimar ab, um über
Frankfurt, Heilbronn, Stuttgart sich in die Schweiz zu
begeben. Er wollte dort seinen Freund Heinrich Meyer, den
er auf seiner ersten italieniſchen Reiſe kennen gelernt, auf-
suchen, um mit diesem über eine zweite Fahrt nach Italien
zu beraten, auf die er sich seit längerer Zeit vorbereitete.
Unterwegs ließ er nichts, was seine Kenntnis von Welt unuan
Menschen erweitern konnte, unbeachtet; besonders hatte er
das Bedürfnis, seine Kenntnisse der Kunst und ihrer Werke
zu vervollständigen. In Stuttgart langte er am 29. Auguſt
abends an, und sein ersſter Gang am anderen Morgen war
zu dem Kaufmann Rapp, mit dem zuſammen er dann den
berühmten Bildhauer Profeſſor Dannecker aufsuchte. Goethe
selbſt ſchreibt hierüber: „Wir besuchten Profeſſor Dannecker
in seinem Studium im Schlosse und fanden bei ihm einen
Hektor, der den Paris ſchilt, ein etwas über Lebensgröße in
Gips ausgeführtes Modell, sowie auch .eine ruhende, nackte
weibliche Figur im Charakter der sſehnſuchtsvollen Sappho, in
Gips fertig und in Marmor angefangen. Ich sah ferner bei
ihm das Gipsmodell eines Kopfes vom gegenwärtigen Herzog,
der besonders in Marmor ſehr gelungen ſein ſoll, ſowie auch
seine eigene Büſte, die ohne Uebertreibung geiſtreich und leb-
haft iſt. Was mich aber besonders frappierte, war der Ori-
ginalausguß von Schillers Büſte, der eine solche Wahrheit
und Ausführlichkeit hat, daß er wirklich Erſtaunen erregt." ~
Unser Bild auf S. 625 zeigt uns Goethe in der Betrachtung
von Schillers Büſte versunken. Zu seiner Rechten ſittt Dan-
necker, während Kaufmann Rapp ſich auf die Lehne von
Goethes Stuhl stützt und gleichfalls seine volle Aufmerkſam-
keit dem Kunstwerke zuwendet. Goelhe blieb bis zum 7. Sep-
tember in Stuttgart, besonders lebhaft mit Dannecker ver-
kehrend, mit dem er geiſtig viele Berührungspunkte hatte.
Denn Dannecker gehörte zu den Künſtlern, welche durch engen
Anſchluß an die Antike die Bildhauerkunst ihrer Zeit zu
regenerieren ſuchten. Die 1797 vollendete Büſte Schillers
hat in der Bibliothek zu Weimar Aufstellung gefunden, eine
zweite befindet ſich im Danneckerkabinett des Muſeums. in
Stuttgart; eine dritte fertigte der Künſtler für den damaligen
Kronprinzen Ludwig von Bayern. Diese Bildwerke ſind die
beſten, die wir von Schiller besißen, der mit Dannecker ge-
meinsam die Karlsſchule besucht hatte und auch später in
engem FJreundſchaftsbunde mit ihm stand. Dannecker über-
lebte Schiller wie Goethe. Er starb hochbetagt am 8. De-
zember 1841, nachdem er bis 1839 die Direktion der Kunſt-
ſchule in Stuttgart geführt hatte.
Die Ernte der Eichenlohe.
(Siehe das Bild auf Seite 6289
D'? die Gerberei wird aus den rohen Tierhäuten brauch-
bares Leder hergestellt, indem man die Häute nach ſorg-
fältiger Reinigung von Fleiſch, Haaren, Unterhautzellgewebe
u. s. w. im Wasser erweicht und dann mit Gerbſtoff fest und
widerstandsfähig macht. Trotz mancher gebräuchlichen Surro-
gate iſt die Lohe noch immer das beste und unentbehrlichſte
Mittel zum Gerben der Rinds- und Pferdehäute, sowie der
Kalbfelle. Man nennt dieses Verfahren daher Rot- oder Loh-
gerberei, und die Forſtwirtſchaft zieht in manchen Gegenden
Deutſchlands, namentlich in der Pfalz und den Moſelland-
ſchaften, namhaften Gewinn aus der Anpflanzung junger
Eichen, sogenannter Schäleichen, deren Rinde den geſchätten
Gerbstoff, die Lohe, liefert. Die Cichbäumchen dürfen nur
10 bis 12 Jahre alt sein, um das beste Erträgnis zu liefern.
Die Rinde ist dann am reichſten an Gerbſtoff (Tannin);
ältere Rinden sind zwar ebenfalls brauchbar, liefern aber ein
minderwertiges Produkt. Unser Bild auf S. 628 versetzt uns
in eine Anpflanzung von solchen jungen Schäleichen während
der Ernte der Eichenlohe. Die „Lohmacher" hacken die Bäume
ab, putzen die ſchwachen Aestchen mit den Blättern aus und
schneiden die stärkeren Aeſte in handliche Stecken von etwa
einem halben Meter Länge, welche sſie alsdann mit der
stumpfen Seite der Art klopfen (ganz in der Art, wie unsere
Kinder mit dem Stiel des Taſchenmeſſers ihre Weidenpfeifen),
um die Rinde zur Ablöſung zu bringen. Da ſich dieſe Ar-
beit schneller und leichter ausführen läßt, wenn die Rinde
der Bäume naß iſt, so wird hauptſächlich früh und abends,
ſowie an regneriſchen Tagen im Juni Lohe geſchlagen. Und
ängstlich wacht der Lohmacher darüber, daß die Feuchtigkeit
in der in Bündeln gepackten Rinde erhalten bleibe, bis diese
gewogen ist, denn da sie nach dem Gewicht bezahlt wird, be-
deutet jede Austrocknung einen Verluſt. Nach dem Abwiegen
werden die Bündel an einfache Geſstelle zum Trocknen
gelehnt und alsdann in die Lohmühle gebracht, wo ſsie zer-
mahlen werden. Diese zermahlene Rinde iſt die eigentliche
Gerbertohe. Die Stämme der Eichbäumchen finden noch
anderweitige Verwendung. Man hackt ſie nämlich nicht an
der Wurzel ab, ſondern etwa ihn Mannshöhe, läßt sie, nach-
dem man ſie geſchält hat, bis zum nächsten Frühjahr ſtehen
und verkauft sie dann an die Stellmacher, die ſie als „Werk-
stücke" schätzen.
Lii-Hai-Huan, der neue chineſiſche Gesandte
in Berlin.
(Siehe da? Porträt auf Seite 629.)
V: einigen Wochen iſt der neue chineſiſche Gesandte Lii-
Hai-Huan, deſſen Porträt wir auf S. 629 bringen, in Berlin
mit Familieeingetroffen. Lii-Hai-Huan, deſſen Perſönlichkeit an-