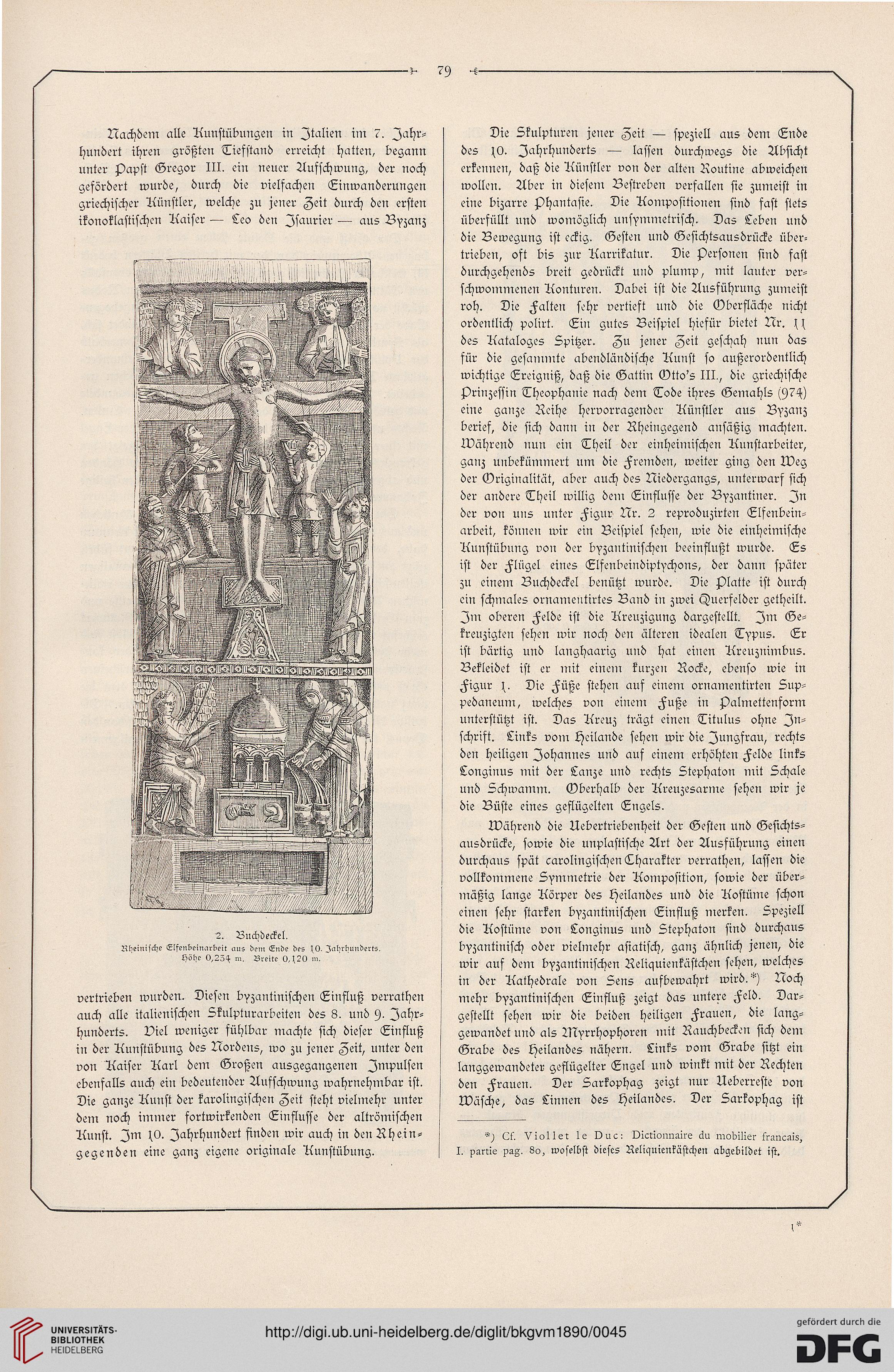X
J- 79 -£•
Nachdem alle Kuustübungen in Italien im 7. Jahr-
hundert ihren größten Tiefstand erreicht hatten, begann
unter Papst Gregor III. ein neuer Aufschwung, der noch
gefördert wurde, durch die vielfachen Einwanderungen
griechischer Künstler, welche zu jener Zeit durch den ersten
ikonoklastischcn Kaiser — Leo den Isaurier -— aus Byzanz
2. Buchdeckel.
Rheinische Elfenbeinarbeit aus dem Ende des HO- Jahrhunderts.
Höhe 0,25^ m. Breite 0,\20 m.
vertrieben wurden. Diesen byzantinischen Einfluß verrathen
auch alle italienischen Skulpturarbeiten des 8. und 9- Jahr-
hunderts. Biel weniger fühlbar machte sich dieser Einfluß
in der Kunstübung des Nordens, wo zu jener Zeit, unter den
von Kaiser Karl dein Großen ausgegangenen Impulsen
ebenfalls auch ein bedeutender Aufschwung wahrnehmbar ist.
Die ganze Kunst der karolingischen Zeit steht vielmehr unter
dem noch immer fortwirkenden Einflüsse der altrömischen
Kunst. Im sO. Jahrhundert finden wir auch in den Rhein-
gegenden eine ganz eigene originale Kunstübung.
Die Skulpturen jener Zeit — speziell aus dem Ende
des \0. Jahrhunderts — lassen durchwegs die Absicht
erkennen, daß die Künstler von der alten Routine abweichen
wollen. Aber in diesen: Bestreben verfallen sie zumeist in
eine bizarre Phantasie. Die Kompositionen sind fast stets
überfüllt und wonräglich unsymnretrisch. Das Leben und
die Bewegung ist eckig. Gesten und Gesichtsausdrücke über-
trieben, oft bis zur Karrikatur. Die Personen sind fast
durchgehends breit gedrückt und plump, mit lauter ver-
schwommenen Konturen. Dabei ist die Ausführung zumeist
roh. Die Falten sehr vertieft und die Oberfläche nicht
ordentlich polirt. Ein gutes Beispiel hiefür bietet Nr. s \
des Kataloges Spitzer. Zu jener Zeit geschah nun das
für die gesammte abendländische Kunst so außerordentlich
wichtige Ereigniß, daß die Gattin Otto's III., die griechische
Prinzessin Theophanie nach dem Tode ihres Gemahls (97^)
eine ganze Reihe hervorragender Künstler aus Byzanz
berief, die sich dann in der Rheingegend ansäßig machten.
Während nun ein Theil der einheimischen Knnstarbeiter,
ganz unbekümmert um die Fremden, weiter ging den Weg
der Originalität, aber auch des Niedergangs, unterwarf sich
der andere Theil willig dem Einflüsse der Byzantiner. In
der von uns unter Figur- Nr. 2 reproduzirten Elfenbein-
arbeit, können wir ein Beispiel sehen, wie die einheimische
Kunstübung von der byzantinischen beeinflußt wurde. Es
ist der Flügel eines Elsenbeindiptychons, der dann später
zn einem Buchdeckel benützt wurde. Die Platte ist durch
ein schnrales ornanrentirtes Band in zwei Aucrfelder getheilt.
Inr oberen Felde ist die Kreuzigung dargestellt. Inr Ge-
kreuzigten sehen wir noch den älteren idealen Typus. Er
ist bärtig und langhaarig und hat einen Kreuznimbus.
Bekleidet ist er mit einem kurzen Rocke, ebenso wie in
Figur ist Die Füße stehen auf einem ornamentirten Sup-
pedaneum, welches von einem Fuße in Palmettenform
unterstützt ist. Das Kreuz trägt einen Titulus ohne In-
schrift. Links vom Heilande sehen wir die Jungfrau, rechts
den heiligen Johannes und auf einem erhöhten Felde links
Longinus nrit der Lanze und rechts Stephaton mit Schale
und Schwamm. Oberhalb der Kreuzesarnre sehen wir je
die Büste eines geflügelten Engels.
Während die Uebertriebenheit der Gesten und Gesichts-
ausdrücke, sowie die unplastische Art der Ausführung einen
durchaus spät carolingischen Tharakter verrathen, lassen die
vollkommene Symmetrie der Komposition, sowie der über-
mäßig lange Körper des Heilandes und die Kostünre schon
einen sehr starken byzantinischen Einfluß nrerken. Speziell
die Kostüme von Longinus und Stephaton sind durchaus
byzantinisch oder vielmehr asiatisch, ganz ähnlich jenen, die
wir auf dem byzantinischen Reliquienkästchen sehen, welches
in der Kathedrale von Sens aufbewahrt wird.*) Noch
mehr byzantinischen Einfluß zeigt das untere Feld. Dar-
gestellt sehen wir die beiden heiligen Frauen, die lang-
gewandet und als Aiyrrhophoren mit Rauchbecken sich dem
Grabe des Heilandes nähern. Links von: Grabe sitzt ein
langgewandeter geflügelter Engel und winkt nrit der Rechten
den Frauen. Der Sarkophag zeigt nur Ueberreste von
Wäsche, das Linnen des Heilandes. Der Sarkophag ist
'*) Cf. Viollet le Duc: Dictionnaire du mobilier francais,
I. Partie pag. So, woselbst dieses Reliquienkästchen abgebildet ist.
X
J- 79 -£•
Nachdem alle Kuustübungen in Italien im 7. Jahr-
hundert ihren größten Tiefstand erreicht hatten, begann
unter Papst Gregor III. ein neuer Aufschwung, der noch
gefördert wurde, durch die vielfachen Einwanderungen
griechischer Künstler, welche zu jener Zeit durch den ersten
ikonoklastischcn Kaiser — Leo den Isaurier -— aus Byzanz
2. Buchdeckel.
Rheinische Elfenbeinarbeit aus dem Ende des HO- Jahrhunderts.
Höhe 0,25^ m. Breite 0,\20 m.
vertrieben wurden. Diesen byzantinischen Einfluß verrathen
auch alle italienischen Skulpturarbeiten des 8. und 9- Jahr-
hunderts. Biel weniger fühlbar machte sich dieser Einfluß
in der Kunstübung des Nordens, wo zu jener Zeit, unter den
von Kaiser Karl dein Großen ausgegangenen Impulsen
ebenfalls auch ein bedeutender Aufschwung wahrnehmbar ist.
Die ganze Kunst der karolingischen Zeit steht vielmehr unter
dem noch immer fortwirkenden Einflüsse der altrömischen
Kunst. Im sO. Jahrhundert finden wir auch in den Rhein-
gegenden eine ganz eigene originale Kunstübung.
Die Skulpturen jener Zeit — speziell aus dem Ende
des \0. Jahrhunderts — lassen durchwegs die Absicht
erkennen, daß die Künstler von der alten Routine abweichen
wollen. Aber in diesen: Bestreben verfallen sie zumeist in
eine bizarre Phantasie. Die Kompositionen sind fast stets
überfüllt und wonräglich unsymnretrisch. Das Leben und
die Bewegung ist eckig. Gesten und Gesichtsausdrücke über-
trieben, oft bis zur Karrikatur. Die Personen sind fast
durchgehends breit gedrückt und plump, mit lauter ver-
schwommenen Konturen. Dabei ist die Ausführung zumeist
roh. Die Falten sehr vertieft und die Oberfläche nicht
ordentlich polirt. Ein gutes Beispiel hiefür bietet Nr. s \
des Kataloges Spitzer. Zu jener Zeit geschah nun das
für die gesammte abendländische Kunst so außerordentlich
wichtige Ereigniß, daß die Gattin Otto's III., die griechische
Prinzessin Theophanie nach dem Tode ihres Gemahls (97^)
eine ganze Reihe hervorragender Künstler aus Byzanz
berief, die sich dann in der Rheingegend ansäßig machten.
Während nun ein Theil der einheimischen Knnstarbeiter,
ganz unbekümmert um die Fremden, weiter ging den Weg
der Originalität, aber auch des Niedergangs, unterwarf sich
der andere Theil willig dem Einflüsse der Byzantiner. In
der von uns unter Figur- Nr. 2 reproduzirten Elfenbein-
arbeit, können wir ein Beispiel sehen, wie die einheimische
Kunstübung von der byzantinischen beeinflußt wurde. Es
ist der Flügel eines Elsenbeindiptychons, der dann später
zn einem Buchdeckel benützt wurde. Die Platte ist durch
ein schnrales ornanrentirtes Band in zwei Aucrfelder getheilt.
Inr oberen Felde ist die Kreuzigung dargestellt. Inr Ge-
kreuzigten sehen wir noch den älteren idealen Typus. Er
ist bärtig und langhaarig und hat einen Kreuznimbus.
Bekleidet ist er mit einem kurzen Rocke, ebenso wie in
Figur ist Die Füße stehen auf einem ornamentirten Sup-
pedaneum, welches von einem Fuße in Palmettenform
unterstützt ist. Das Kreuz trägt einen Titulus ohne In-
schrift. Links vom Heilande sehen wir die Jungfrau, rechts
den heiligen Johannes und auf einem erhöhten Felde links
Longinus nrit der Lanze und rechts Stephaton mit Schale
und Schwamm. Oberhalb der Kreuzesarnre sehen wir je
die Büste eines geflügelten Engels.
Während die Uebertriebenheit der Gesten und Gesichts-
ausdrücke, sowie die unplastische Art der Ausführung einen
durchaus spät carolingischen Tharakter verrathen, lassen die
vollkommene Symmetrie der Komposition, sowie der über-
mäßig lange Körper des Heilandes und die Kostünre schon
einen sehr starken byzantinischen Einfluß nrerken. Speziell
die Kostüme von Longinus und Stephaton sind durchaus
byzantinisch oder vielmehr asiatisch, ganz ähnlich jenen, die
wir auf dem byzantinischen Reliquienkästchen sehen, welches
in der Kathedrale von Sens aufbewahrt wird.*) Noch
mehr byzantinischen Einfluß zeigt das untere Feld. Dar-
gestellt sehen wir die beiden heiligen Frauen, die lang-
gewandet und als Aiyrrhophoren mit Rauchbecken sich dem
Grabe des Heilandes nähern. Links von: Grabe sitzt ein
langgewandeter geflügelter Engel und winkt nrit der Rechten
den Frauen. Der Sarkophag zeigt nur Ueberreste von
Wäsche, das Linnen des Heilandes. Der Sarkophag ist
'*) Cf. Viollet le Duc: Dictionnaire du mobilier francais,
I. Partie pag. So, woselbst dieses Reliquienkästchen abgebildet ist.
X