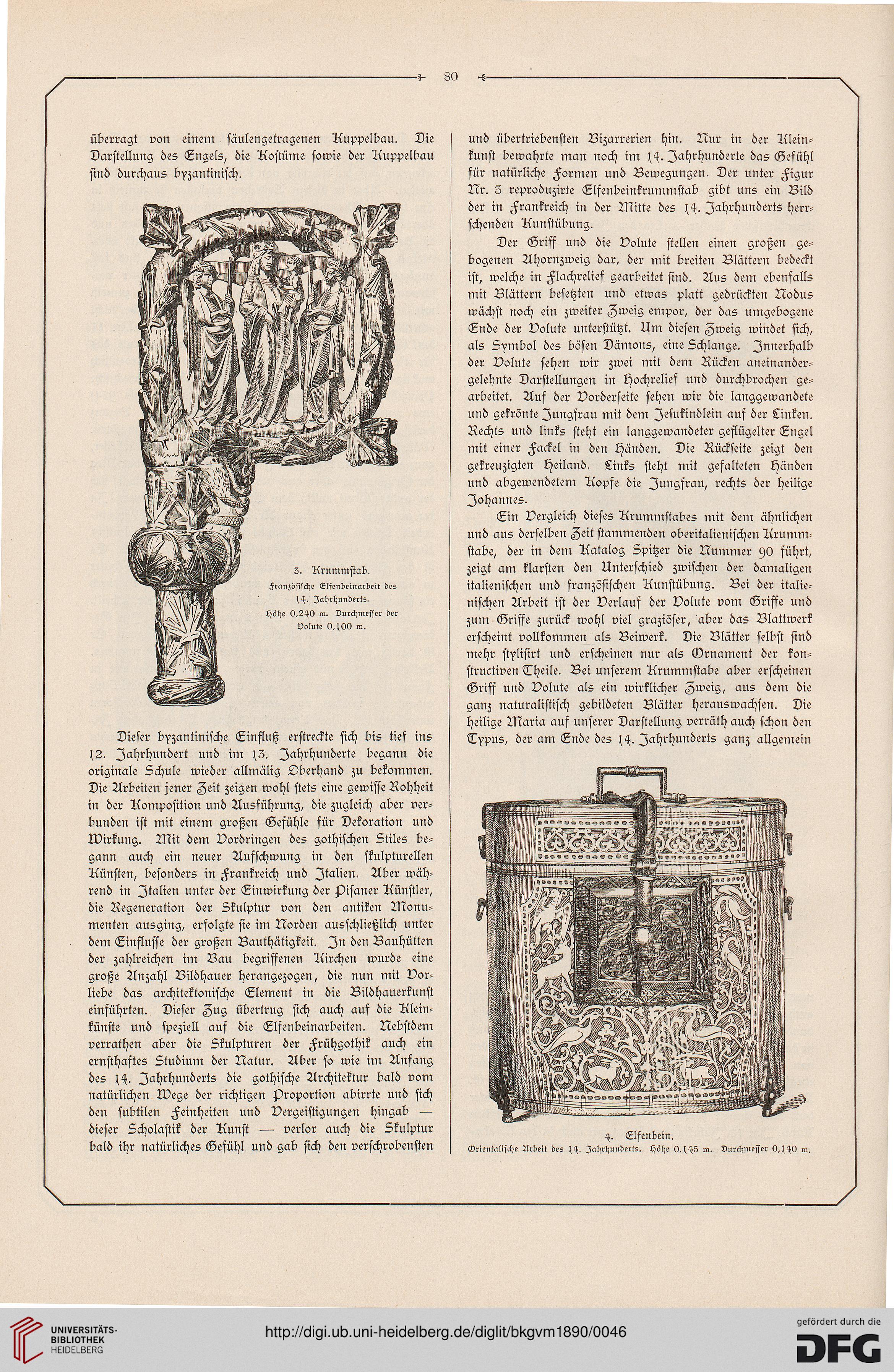überragt von einem säulengetragenen Kuppelbau. Die
Darstellung des Engels, die Kostüme sowie der Kuppelbau
sind durchaus byzantinisch.
Dieser byzantinische Einfluß erstreckte sich bis tief ins
\2. Jahrhundert und im \3. Jahrhunderte begann die
originale Schule wieder allmälig Oberhand zu bekommen.
Die Arbeiten jener Zeit zeigen wohl stets eine gewisse Rohheit
in der Komposition und Ausführung, die zugleich aber ver-
bunden ist mit einem großen Gefühle für Dekoration und
Wirkung. Mit dem Vordringen des gothischen Stiles be-
gann auch ein neuer Aufschwung in den skulpturellen
Künsten, besonders in Frankreich und Italien. Aber wäh-
rend in Italien unter der Einwirkung -er pisaner Künstler,
die Regeneration der Skulptur von den antiken Monu-
menten ausging, erfolgte sie in: Norden ausschließlich unter
dem Einflüsse der großen Bauthätigkeit. In den Bauhütten
der zahlreichen im Bau begriffenen Kirchen wurde eine
große Anzahl Bildhauer herangezogen, die nun mit Vor-
liebe das architektonische Element in die Bildhauerkunst
einführten. Dieser Zug übertrug sich auch auf die Klein-
künste und speziell auf die Elsenbeinarbeiten. Nebstdem
verrathen aber die Skulpturen der Frühgothik auch ein
ernsthaftes Studium der Natur. Aber so wie im Anfang
des Jahrhunderts die gothifche Architektur bald vom
natürlichen Wege der richtigen Proportion abirrte und sich
den subtilen Feinheiten und Vergeistigungen hingab —
dieser Scholastik der Kunst — verlor auch die Skulptur
bald ihr natürliches Gefühl und gab sich den verschrobensten
und übertriebensten Bizarrerien hin. Nur in der Klein-
kunst bewahrte man noch im sch Jahrhunderte das Gefühl
für natürliche Formen und Bewegungen. Der unter Figur
Nr. 5 reproduzirte Elfenbeinkrummstab gibt uns ein Bild
der in Frankreich in der Mitte des sch Jahrhunderts herr-
schenden Kunstübung.
Der Griff und die Volute stellen einen großen ge-
bogenen Ahornzweig dar, der mit breiten Blättern bedeckt
ist, welche in Flachrelief gearbeitet sind. Aus den: ebenfalls
mit Blättern besetzten und etwas platt gedrückten Nodus
wächst noch ein zweiter Zweig en:por, der das umgebogene
Ende der Volute unterstützt. Km diesen Zweig windet sich,
als Symbol des bösen Dämons, eine Schlange. Innerhalb
der Volute sehen wir zwei mit den: Rücken aneinander-
gelehnte Darstellungen in Pochrelief und durchbrochen ge-
arbeitet. Auf der Vorderseite sehen wir die langgewandete
und gekrönte Jungfrau mit den: Iesukindlein auf der Linken.
Rechts und links steht ein langgewandeter geflügelter Engel
mit einer Fackel in den pänden. Die Rückseite zeigt den
gekreuzigten peiland. Links steht :nit gefalteten pänden
und abgewendeten: Kopfe die Jungfrau, rechts der heilige
Johannes.
Ein Vergleich dieses Krummstabes :nit den: ähnlichen
und aus derselben Zeit stammenden oberitalienischen Krumm
stabe, der in dem Katalog Spitzer die Nummer 90 führt,
zeigt am klarsten den Unterschied zwischen der damaligen
italienischen und französischen KunstÜbung. Bei der italie-
nischen Arbeit ist der Verlauf der Volute von: Griffe uud
zum Griffe zurück wohl viel graziöser, aber das Blattwerk
erscheint vollkommen als Beiwerk. Die Blätter selbst sind
:nehr stylisirt und erscheinen nur als Ornament der kon-
structiven Theile. Bei unserem Krummstabe aber erscheinen
Griff und Volute als ein wirklicher Zweig, aus den: die
ganz naturalistisch gebildeten Blätter herauswachsen. Die
heilige Maria auf unserer Darstellung verräth auch schon den
Typus, der an: Ende des Jahrhunderts ganz allgemein
q. Elfenbein.
Orientalische Arbeit des IsH. Jahrhunderts. Höhe 0,^5 ra. Durchmesser 0,^0 m.
Darstellung des Engels, die Kostüme sowie der Kuppelbau
sind durchaus byzantinisch.
Dieser byzantinische Einfluß erstreckte sich bis tief ins
\2. Jahrhundert und im \3. Jahrhunderte begann die
originale Schule wieder allmälig Oberhand zu bekommen.
Die Arbeiten jener Zeit zeigen wohl stets eine gewisse Rohheit
in der Komposition und Ausführung, die zugleich aber ver-
bunden ist mit einem großen Gefühle für Dekoration und
Wirkung. Mit dem Vordringen des gothischen Stiles be-
gann auch ein neuer Aufschwung in den skulpturellen
Künsten, besonders in Frankreich und Italien. Aber wäh-
rend in Italien unter der Einwirkung -er pisaner Künstler,
die Regeneration der Skulptur von den antiken Monu-
menten ausging, erfolgte sie in: Norden ausschließlich unter
dem Einflüsse der großen Bauthätigkeit. In den Bauhütten
der zahlreichen im Bau begriffenen Kirchen wurde eine
große Anzahl Bildhauer herangezogen, die nun mit Vor-
liebe das architektonische Element in die Bildhauerkunst
einführten. Dieser Zug übertrug sich auch auf die Klein-
künste und speziell auf die Elsenbeinarbeiten. Nebstdem
verrathen aber die Skulpturen der Frühgothik auch ein
ernsthaftes Studium der Natur. Aber so wie im Anfang
des Jahrhunderts die gothifche Architektur bald vom
natürlichen Wege der richtigen Proportion abirrte und sich
den subtilen Feinheiten und Vergeistigungen hingab —
dieser Scholastik der Kunst — verlor auch die Skulptur
bald ihr natürliches Gefühl und gab sich den verschrobensten
und übertriebensten Bizarrerien hin. Nur in der Klein-
kunst bewahrte man noch im sch Jahrhunderte das Gefühl
für natürliche Formen und Bewegungen. Der unter Figur
Nr. 5 reproduzirte Elfenbeinkrummstab gibt uns ein Bild
der in Frankreich in der Mitte des sch Jahrhunderts herr-
schenden Kunstübung.
Der Griff und die Volute stellen einen großen ge-
bogenen Ahornzweig dar, der mit breiten Blättern bedeckt
ist, welche in Flachrelief gearbeitet sind. Aus den: ebenfalls
mit Blättern besetzten und etwas platt gedrückten Nodus
wächst noch ein zweiter Zweig en:por, der das umgebogene
Ende der Volute unterstützt. Km diesen Zweig windet sich,
als Symbol des bösen Dämons, eine Schlange. Innerhalb
der Volute sehen wir zwei mit den: Rücken aneinander-
gelehnte Darstellungen in Pochrelief und durchbrochen ge-
arbeitet. Auf der Vorderseite sehen wir die langgewandete
und gekrönte Jungfrau mit den: Iesukindlein auf der Linken.
Rechts und links steht ein langgewandeter geflügelter Engel
mit einer Fackel in den pänden. Die Rückseite zeigt den
gekreuzigten peiland. Links steht :nit gefalteten pänden
und abgewendeten: Kopfe die Jungfrau, rechts der heilige
Johannes.
Ein Vergleich dieses Krummstabes :nit den: ähnlichen
und aus derselben Zeit stammenden oberitalienischen Krumm
stabe, der in dem Katalog Spitzer die Nummer 90 führt,
zeigt am klarsten den Unterschied zwischen der damaligen
italienischen und französischen KunstÜbung. Bei der italie-
nischen Arbeit ist der Verlauf der Volute von: Griffe uud
zum Griffe zurück wohl viel graziöser, aber das Blattwerk
erscheint vollkommen als Beiwerk. Die Blätter selbst sind
:nehr stylisirt und erscheinen nur als Ornament der kon-
structiven Theile. Bei unserem Krummstabe aber erscheinen
Griff und Volute als ein wirklicher Zweig, aus den: die
ganz naturalistisch gebildeten Blätter herauswachsen. Die
heilige Maria auf unserer Darstellung verräth auch schon den
Typus, der an: Ende des Jahrhunderts ganz allgemein
q. Elfenbein.
Orientalische Arbeit des IsH. Jahrhunderts. Höhe 0,^5 ra. Durchmesser 0,^0 m.