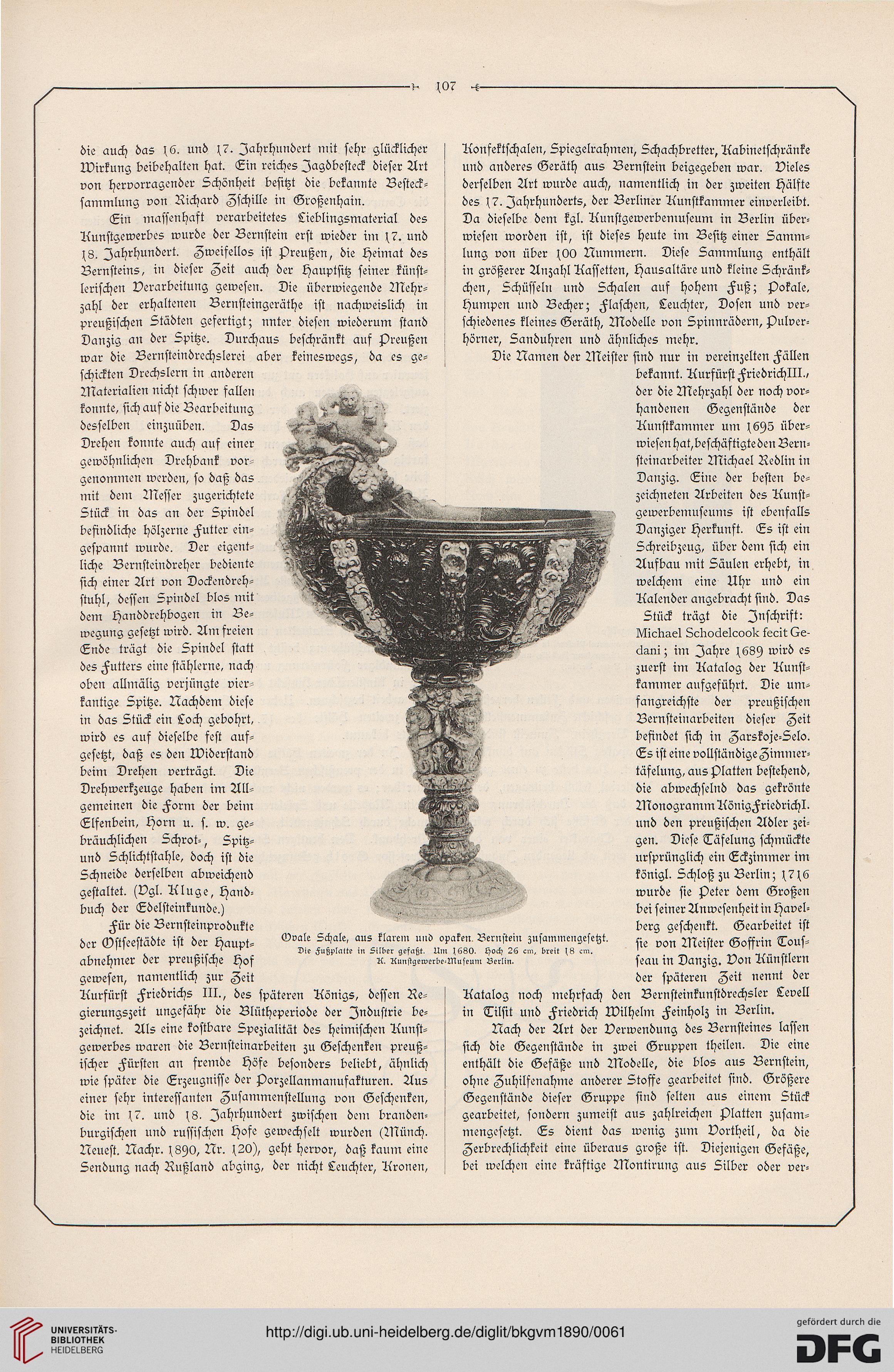die auch das (6. und (7. Jahrhundert mit sehr glücklicher
Wirkung beibehalteu hat. Lin reiches Iagdbestcck dieser Art
von hervorragender Schönheit besitzt die bekannte Besteck-
sammlung von Richard Zschille in Großenhain.
Lin massenhaft verarbeitetes Lieblingsmaterial des
Kunstgewerbes wurde der Bernstein erst wieder im (7. und
(8. Jahrhundert. Zweifellos ist Preußen, die peimat des
Bernsteins, in dieser Zeit auch der Pauptsitz seiner künst-
lerischen Verarbeitung gewesen. Die überwiegende Abehr-
zahl der erhaltenen Bernsteingeräthe ist nachweislich in
preußischen Städten gefertigt; unter diesen wiederum stand
Danzig au der Spitze. Durchaus beschränkt aus Preußen
war die Bernsteindrechslerei aber keineswegs, da es ge-
schickten Drechslern in anderen
Materialien nicht schwer fallen
konnte, sich auf die Bearbeitung
desselben einzuüben. Das
Drehen konnte auch auf einer
gewöhnlichen Drehbank vor-
genommen werden, so daß das
mit dem Messer zugerichtete
Stück in das an der Spindel
befindliche hölzerne Futter ein-
gefpannt wurde. Der eigent-
liche Bernsteindreher bediente
sich einer Art von Dockendreh-
stuhl, dessen Spindel blos mit
dem pauddrehbogen in Be-
wegung gesetzt wird. Am freien
Lnde trägt die Spindel statt
des Futters eine stählerne, nach
oben allmälig verjüngte vier-
kantige Spitze. Nachdem diese
in das Stück ein Loch gebohrt,
wird es auf dieselbe fest auf-
gesetzt, daß cs den widerstand
beim Drehen verträgt. Die
Drehwerkzeuge haben in: All-
gemeinen die Form der beim
Llfenbein, porn u. s. w. ge-
bräuchlichen Schrot-, Spitz-
und Schlichtstahle, doch ist die
Schneide derselben abweichend
gestaltet, (vgl. Kluge, pand-
buch der Ldelsteinkuude.)
Für die Bernsteinprodukte
der Gstscestädte ist der Haupt-
abnehmer der preußische Pos
gewesen, namentlich zur Zeit
Kurfürst Friedrichs III., des späteren Königs, dessen Re-
gierungszcit ungefähr die Blütheperiode der Industrie be-
zeichnet. Als eine kostbare Spezialität des heimischen Kuust-
gewerbes waren die Bernsteinarbeiten zu Geschenken preuß-
ischer Fürsten an freiude pöfe besonders beliebt, ähnlich
wie später die Erzeugnisse der porzellamuauufakturen. Aus
einer sehr interessanten Zusammenstellung von Geschenken,
die im (7. und (8. Jahrhundert zwischen dem branden-
burgischen und russischen Pose gewechselt wurden (Münch.
Neuest. Nachr. (890, Nr. (20), geht hervor, daß kaum eine
Sendung nach Rußland abging, der nicht Leuchter, Kronen,
Konfektschalen, Spiegelrahineu, Schachbretter, Kabinetschränke
und anderes Geräth aus Bernstein beigegeben war. Vieles
derselben Art wurde auch, namentlich in der zweiten pulste
des (7. Jahrhunderts, der Berliner Kunstkammer einverleibt.
Da dieselbe dem kgl. Kunstgewerbemuseuin in Berlin über-
wiesen worden ist, ist dieses heute im Besitz einer Samm-
lung von über (00 Nummern. Diese Sammlung enthält
in größerer Anzahl Kassetten, Pausaltäre und kleine Schränk-
chen, Schüsseln und Schalen auf hohem Fuß; Pokale,
Pumpen und Becher; Flaschen, Leuchter, Dosen und ver-
schiedenes kleines Geräth, Modelle von Spinnrädern, Pulver-
hörner, Sanduhren und ähnliches mehr.
Die Namen der Meister sind nur in vereinzelten Fällen
bekannt. Kurfürst Friedrichlll.,
der die Mehrzahl der noch vor-
handenen Gegenstände der
Kunstkammer um (695 über-
wiesen hatcheschäftigtedeu Bern-
steinarbeiter Michael Redlin in
Danzig. Line der besten be-
zeichneten Arbeiten des Kunst-
gewerbemuseums ist ebenfalls
Danziger perkuuft. Ls ist ein
Schreibzeug, über dem sich ein
Aufbau mit Säulen erhebt, in
welchem eine Uhr und ein
Kalender angebracht sind. Das
Stück trägt die Inschrift:
Michael Schodelcook fecit Ge-
dani; im Jahre (689 wird es
zuerst im Katalog der Kunst-
kammer aufgeführt. Die um-
fangreichste der preußischen
Bernsteinarbeiten dieser Zeit
befindet sich in Zarskoje-Selo.
Ls ist eine vollständigeZimmer-
täfelung, aus Platten bestehend,
die abwechselnd das gekrönte
Monogramm KönigFriedrichl.
und den preußischen Adler zei-
gen. Diese Täfelung schmückte
ursprünglich ein Eckzimmer im
köuigl. Schloß zu Berlin; (7(6
wurde sie Peter den: Großen
bei seiner Anwesenheit in pavel-
berg geschenkt. Gearbeitet ist
sie von Meister Gosfrin Tous-
seau in Danzig. Von Künstlern
der späteren Zeit nennt der
Katalog noch mehrfach den Bernsteinkunstdrechsler Levell
in Tilsit und Friedrich Wilhelm Feinholz in Berlin.
Nach der Art der Verwendung des Bernsteines lassen
sich die Gegenstände in zwei Gruppen theilen. Die eine
enthält die Gefäße und Modelle, die blos aus Bernstein,
ohne Zuhilfenahme anderer Stoffe gearbeitet sind. Größere
Gegenstände dieser Gruppe sind selten aus einem Stück
gearbeitet, sondern zumeist aus zahlreichen Platten zusam-
mengesetzt. Ls dient das wenig zum Vortheil, da die
Zerbrechlichkeit eine überaus große ist. Diejenigen Gefäße,
bei welchen eine kräftige Montirung aus Silber oder ver-
Gvale Schale, aus klarem und opaken. Bernstein zusammengesetzt.
Die Fußplatte in Silber gefaßt. Um J680. Hoch 26 cm, breit \8 cm.
K. Aunstgewerbe-Museum Berlin.
Wirkung beibehalteu hat. Lin reiches Iagdbestcck dieser Art
von hervorragender Schönheit besitzt die bekannte Besteck-
sammlung von Richard Zschille in Großenhain.
Lin massenhaft verarbeitetes Lieblingsmaterial des
Kunstgewerbes wurde der Bernstein erst wieder im (7. und
(8. Jahrhundert. Zweifellos ist Preußen, die peimat des
Bernsteins, in dieser Zeit auch der Pauptsitz seiner künst-
lerischen Verarbeitung gewesen. Die überwiegende Abehr-
zahl der erhaltenen Bernsteingeräthe ist nachweislich in
preußischen Städten gefertigt; unter diesen wiederum stand
Danzig au der Spitze. Durchaus beschränkt aus Preußen
war die Bernsteindrechslerei aber keineswegs, da es ge-
schickten Drechslern in anderen
Materialien nicht schwer fallen
konnte, sich auf die Bearbeitung
desselben einzuüben. Das
Drehen konnte auch auf einer
gewöhnlichen Drehbank vor-
genommen werden, so daß das
mit dem Messer zugerichtete
Stück in das an der Spindel
befindliche hölzerne Futter ein-
gefpannt wurde. Der eigent-
liche Bernsteindreher bediente
sich einer Art von Dockendreh-
stuhl, dessen Spindel blos mit
dem pauddrehbogen in Be-
wegung gesetzt wird. Am freien
Lnde trägt die Spindel statt
des Futters eine stählerne, nach
oben allmälig verjüngte vier-
kantige Spitze. Nachdem diese
in das Stück ein Loch gebohrt,
wird es auf dieselbe fest auf-
gesetzt, daß cs den widerstand
beim Drehen verträgt. Die
Drehwerkzeuge haben in: All-
gemeinen die Form der beim
Llfenbein, porn u. s. w. ge-
bräuchlichen Schrot-, Spitz-
und Schlichtstahle, doch ist die
Schneide derselben abweichend
gestaltet, (vgl. Kluge, pand-
buch der Ldelsteinkuude.)
Für die Bernsteinprodukte
der Gstscestädte ist der Haupt-
abnehmer der preußische Pos
gewesen, namentlich zur Zeit
Kurfürst Friedrichs III., des späteren Königs, dessen Re-
gierungszcit ungefähr die Blütheperiode der Industrie be-
zeichnet. Als eine kostbare Spezialität des heimischen Kuust-
gewerbes waren die Bernsteinarbeiten zu Geschenken preuß-
ischer Fürsten an freiude pöfe besonders beliebt, ähnlich
wie später die Erzeugnisse der porzellamuauufakturen. Aus
einer sehr interessanten Zusammenstellung von Geschenken,
die im (7. und (8. Jahrhundert zwischen dem branden-
burgischen und russischen Pose gewechselt wurden (Münch.
Neuest. Nachr. (890, Nr. (20), geht hervor, daß kaum eine
Sendung nach Rußland abging, der nicht Leuchter, Kronen,
Konfektschalen, Spiegelrahineu, Schachbretter, Kabinetschränke
und anderes Geräth aus Bernstein beigegeben war. Vieles
derselben Art wurde auch, namentlich in der zweiten pulste
des (7. Jahrhunderts, der Berliner Kunstkammer einverleibt.
Da dieselbe dem kgl. Kunstgewerbemuseuin in Berlin über-
wiesen worden ist, ist dieses heute im Besitz einer Samm-
lung von über (00 Nummern. Diese Sammlung enthält
in größerer Anzahl Kassetten, Pausaltäre und kleine Schränk-
chen, Schüsseln und Schalen auf hohem Fuß; Pokale,
Pumpen und Becher; Flaschen, Leuchter, Dosen und ver-
schiedenes kleines Geräth, Modelle von Spinnrädern, Pulver-
hörner, Sanduhren und ähnliches mehr.
Die Namen der Meister sind nur in vereinzelten Fällen
bekannt. Kurfürst Friedrichlll.,
der die Mehrzahl der noch vor-
handenen Gegenstände der
Kunstkammer um (695 über-
wiesen hatcheschäftigtedeu Bern-
steinarbeiter Michael Redlin in
Danzig. Line der besten be-
zeichneten Arbeiten des Kunst-
gewerbemuseums ist ebenfalls
Danziger perkuuft. Ls ist ein
Schreibzeug, über dem sich ein
Aufbau mit Säulen erhebt, in
welchem eine Uhr und ein
Kalender angebracht sind. Das
Stück trägt die Inschrift:
Michael Schodelcook fecit Ge-
dani; im Jahre (689 wird es
zuerst im Katalog der Kunst-
kammer aufgeführt. Die um-
fangreichste der preußischen
Bernsteinarbeiten dieser Zeit
befindet sich in Zarskoje-Selo.
Ls ist eine vollständigeZimmer-
täfelung, aus Platten bestehend,
die abwechselnd das gekrönte
Monogramm KönigFriedrichl.
und den preußischen Adler zei-
gen. Diese Täfelung schmückte
ursprünglich ein Eckzimmer im
köuigl. Schloß zu Berlin; (7(6
wurde sie Peter den: Großen
bei seiner Anwesenheit in pavel-
berg geschenkt. Gearbeitet ist
sie von Meister Gosfrin Tous-
seau in Danzig. Von Künstlern
der späteren Zeit nennt der
Katalog noch mehrfach den Bernsteinkunstdrechsler Levell
in Tilsit und Friedrich Wilhelm Feinholz in Berlin.
Nach der Art der Verwendung des Bernsteines lassen
sich die Gegenstände in zwei Gruppen theilen. Die eine
enthält die Gefäße und Modelle, die blos aus Bernstein,
ohne Zuhilfenahme anderer Stoffe gearbeitet sind. Größere
Gegenstände dieser Gruppe sind selten aus einem Stück
gearbeitet, sondern zumeist aus zahlreichen Platten zusam-
mengesetzt. Ls dient das wenig zum Vortheil, da die
Zerbrechlichkeit eine überaus große ist. Diejenigen Gefäße,
bei welchen eine kräftige Montirung aus Silber oder ver-
Gvale Schale, aus klarem und opaken. Bernstein zusammengesetzt.
Die Fußplatte in Silber gefaßt. Um J680. Hoch 26 cm, breit \8 cm.
K. Aunstgewerbe-Museum Berlin.