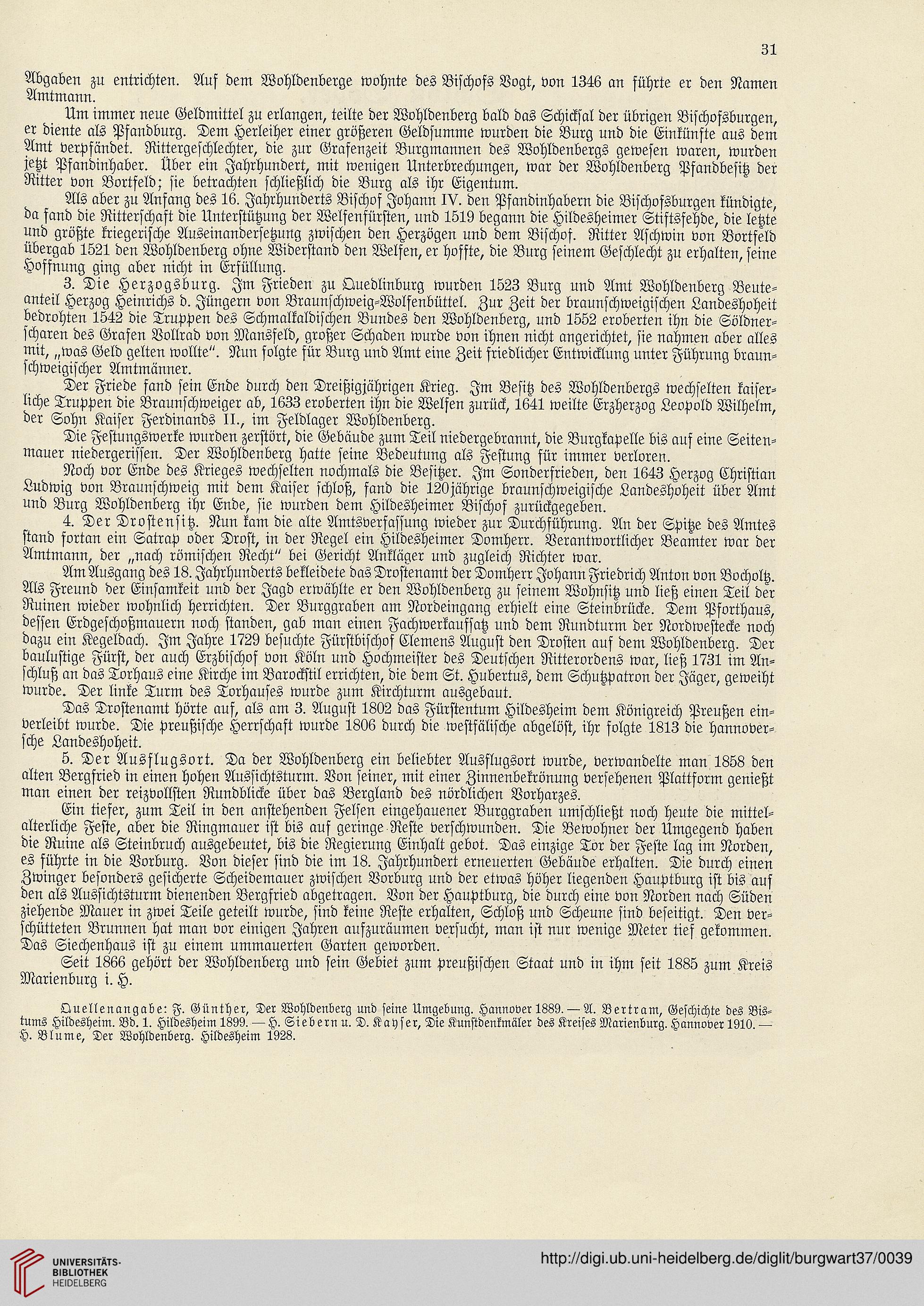31
Abgaben zu entrichten. Auf dem Wohldenbergs wohnte des Bischofs Vogt, von 1346 an führte er den Namen
Amtmann.
Um immer neue Geldmittel zu erlangen, teilte der Wohldenberg bald das Schicksal der übrigen Bischofsburgen,
er diente als Pfandburg. Dem Herleiher einer größeren Geldsumme wurden die Burg und die Einkünfte aus dem
Amt verpfändet. Rittergeschlechter, die zur Grafenzeit Burgmannen des Wohldenbergs gewesen waren, wurden
jetzt Pfandinhaber. Über ein Jahrhundert, mit wenigen Unterbrechungen, war der Wohldenberg Pfandbesitz der
Ritter von Bortfeld; sie betrachten schließlich die Burg als ihr Eigentum.
Als aber zu Anfang des 16. Jahrhunderts Bischof Johann IV. den Pfandinhabern die Bischofsburgen kündigte,
da fand die Ritterschaft die Unterstützung der Welfenfürsten, und 1519 begann die Hildesheimer Stiftsfehde, die letzte
und größte kriegerische Auseinandersetzung zwischen den Herzögen und dem Bischof. Ritter Aschwin von Bortfeld
übergab 1521 den Wohldenberg ohne Widerstand den Welfen, er hoffte, die Burg seinem Geschlecht zu erhalten, seine
Hoffnung ging aber nicht in Erfüllung.
3. Die Herzogsburg. Im Frieden zu Quedlinburg wurden 1523 Burg und Amt Wohldenberg Beute-
anteil Herzog Heinrichs d. Jüngern von Braunschweig-Wolfenbüttel. Zur Zeit der braunschweigischen Landeshoheit
bedrohten 1542 die Truppen des Schmalkaldischen Bundes den Wohldenberg, und 1552 eroberten ihn die Söldner-
scharen des Grafen Vollrad von Mansfeld, großer Schaden wurde von ihnen nicht angerichtet, sie nahmen aber alles
mit, „was Geld gelten wollte". Nun folgte für Burg und Amt eine Zeit friedlicher Entwicklung unter Führung braun-
schweigischer Amtmänner.
Der Friede fand sein Ende durch den Dreißigjährigen Krieg. Im Besitz des Wohldenbergs wechselten kaiser-
liche Truppen die Braunschweiger ab, 1633 eroberten ihn die Welfen zurück, 1641 weilte Erzherzog Leopold Wilhelm,
der Sohn Kaiser Ferdinands II., im Feldlager Wohldenberg.
Die Festungswerke wurden zerstört, die Gebäude zum Teil niedergebrannt, die Burgkapelle bis auf eine Seiten-
mauer niedergerissen. Der Wohldenberg hatte seine Bedeutung als Festung für immer verloren.
Noch vor Ende des Krieges wechselten nochmals die Besitzer. Im Sonderfrieden, den 1643 Herzog Christian
Ludwig von Braunschweig mit dem Kaiser schloß, fand die 120jährige braunschweigische Landeshoheit über Amt
und Burg Wohldenberg ihr Ende, sie wurden dem Hildesheimer Bischof zurückgegeben.
4. Der Drostensitz. Nun kam die alte Amtsverfassung wieder zur Durchführung. An der Spitze des Amtes
stand fortan ein Satrap oder Drost, in der Regel ein Hildesheimer Domherr. Verantwortlicher Beamter war der
Amtmann, der „nach römischen Recht" bei Gericht Ankläger und zugleich Richter war.
Am Ausgang des 18. Jahrhunderts bekleidete das Drostenamt der Domherr Johann Friedrich Anton von Bocholtz.
Als Freund der Einsamkeit und der Jagd erwählte er den Wohldenberg zu seinem Wohnsitz und ließ einen Teil der
Ruinen wieder wohnlich Herrichten. Der Burggraben am Nordeingang erhielt eine Steinbrücke. Dem Pforthaus,
dessen Erdgeschoßmauern noch standen, gab man einen Fachwerkaufsatz und dem Rundturm der Nordwestecke noch
dazu ein Kegeldach. Im Jahre 1729 besuchte Fürstbischof Clemens August den Drosten ans dem Wohldenberg. Der
baulustige Fürst, der auch Erzbischof von Köln und Hochmeister des Deutschen Ritterordens war, ließ 1731 im An-
schluß an das Torhaus eine Kirche im Barockstil errichten, die dem St. Hubertus, dem Schutzpatron der Jäger, geweiht
wurde. Der linke Turm des Torhauses wurde zum Kirchturm ausgebaut.
Das Drostenamt hörte auf, als am 3. August 1802 das Fürstentum Hildesheim dem Königreich Preußen ein-
verleibt wurde. Die preußische Herrschaft wurde 1806 durch die westfälische abgelöst, ihr folgte 1813 die hannover-
sche Landeshoheit.
5. Der Ausflugsort. Da der Wohldenberg ein beliebter Ausflugsort wurde, verwandelte man 1858 den
alten Bergfried in einen hohen Aussichtsturm. Von seiner, mit einer Zinnenbekrönung versehenen Plattform genießt
man einen der reizvollsten Rundblicke über das Bergland des nördlichen Vorharzes.
Ein tiefer, zum Teil in den anstehenden Felsen eingehauener Burggraben umschließt noch heute die mittel-
alterliche Feste, aber die Ringmauer ist bis auf geringe Reste verschwunden. Die Bewohner der Umgegend haben
die Ruine als Steinbruch ausgebeutet, bis die Regierung Einhalt gebot. Das einzige Tor der Feste lag im Norden,
es führte in die Vorburg. Von dieser sind die im 18. Jahrhundert erneuerten Gebäude erhalten. Die durch einen
Zwinger besonders gesicherte Scheidemauer zwischen Vorburg und der etwas höher liegenden Hauptburg ist bis aus
den als Aussichtsturm dienenden Bergfried abgetragen. Von der Hauptburg, die durch eine von Norden nach Süden
ziehende Malier in zwei Teile geteilt wurde, sind keine Reste erhalten, Schloß und Scheune sind beseitigt. Den ver-
schütteten Brunnen hat man vor einigen Jahren aufzuräumen versucht, man ist nur wenige Meter tief gekommen.
Das Siechenhaus ist zu einem ummauerten Garten geworden.
Seit 1866 gehört der Wohldenberg und sein Gebiet zum preußischen Staat und in ihm seit 1885 zum Kreis
Marienburg i. H.
Quellenangabe: F. Günther, Der Wohldenberg und seine Umgebung. Hannover 1889. — A. Bertram, Geschichte des Bis-
tums Hildesheim. Bd. 1. Hildesheim 1899. —H. Siebern u. D. Kayser, Die Kunstdenkmäler des Kreises Marienburg. Hannover 1910. —
H. Blume, Der Wohldenberg. Hildesheim 1928.
Abgaben zu entrichten. Auf dem Wohldenbergs wohnte des Bischofs Vogt, von 1346 an führte er den Namen
Amtmann.
Um immer neue Geldmittel zu erlangen, teilte der Wohldenberg bald das Schicksal der übrigen Bischofsburgen,
er diente als Pfandburg. Dem Herleiher einer größeren Geldsumme wurden die Burg und die Einkünfte aus dem
Amt verpfändet. Rittergeschlechter, die zur Grafenzeit Burgmannen des Wohldenbergs gewesen waren, wurden
jetzt Pfandinhaber. Über ein Jahrhundert, mit wenigen Unterbrechungen, war der Wohldenberg Pfandbesitz der
Ritter von Bortfeld; sie betrachten schließlich die Burg als ihr Eigentum.
Als aber zu Anfang des 16. Jahrhunderts Bischof Johann IV. den Pfandinhabern die Bischofsburgen kündigte,
da fand die Ritterschaft die Unterstützung der Welfenfürsten, und 1519 begann die Hildesheimer Stiftsfehde, die letzte
und größte kriegerische Auseinandersetzung zwischen den Herzögen und dem Bischof. Ritter Aschwin von Bortfeld
übergab 1521 den Wohldenberg ohne Widerstand den Welfen, er hoffte, die Burg seinem Geschlecht zu erhalten, seine
Hoffnung ging aber nicht in Erfüllung.
3. Die Herzogsburg. Im Frieden zu Quedlinburg wurden 1523 Burg und Amt Wohldenberg Beute-
anteil Herzog Heinrichs d. Jüngern von Braunschweig-Wolfenbüttel. Zur Zeit der braunschweigischen Landeshoheit
bedrohten 1542 die Truppen des Schmalkaldischen Bundes den Wohldenberg, und 1552 eroberten ihn die Söldner-
scharen des Grafen Vollrad von Mansfeld, großer Schaden wurde von ihnen nicht angerichtet, sie nahmen aber alles
mit, „was Geld gelten wollte". Nun folgte für Burg und Amt eine Zeit friedlicher Entwicklung unter Führung braun-
schweigischer Amtmänner.
Der Friede fand sein Ende durch den Dreißigjährigen Krieg. Im Besitz des Wohldenbergs wechselten kaiser-
liche Truppen die Braunschweiger ab, 1633 eroberten ihn die Welfen zurück, 1641 weilte Erzherzog Leopold Wilhelm,
der Sohn Kaiser Ferdinands II., im Feldlager Wohldenberg.
Die Festungswerke wurden zerstört, die Gebäude zum Teil niedergebrannt, die Burgkapelle bis auf eine Seiten-
mauer niedergerissen. Der Wohldenberg hatte seine Bedeutung als Festung für immer verloren.
Noch vor Ende des Krieges wechselten nochmals die Besitzer. Im Sonderfrieden, den 1643 Herzog Christian
Ludwig von Braunschweig mit dem Kaiser schloß, fand die 120jährige braunschweigische Landeshoheit über Amt
und Burg Wohldenberg ihr Ende, sie wurden dem Hildesheimer Bischof zurückgegeben.
4. Der Drostensitz. Nun kam die alte Amtsverfassung wieder zur Durchführung. An der Spitze des Amtes
stand fortan ein Satrap oder Drost, in der Regel ein Hildesheimer Domherr. Verantwortlicher Beamter war der
Amtmann, der „nach römischen Recht" bei Gericht Ankläger und zugleich Richter war.
Am Ausgang des 18. Jahrhunderts bekleidete das Drostenamt der Domherr Johann Friedrich Anton von Bocholtz.
Als Freund der Einsamkeit und der Jagd erwählte er den Wohldenberg zu seinem Wohnsitz und ließ einen Teil der
Ruinen wieder wohnlich Herrichten. Der Burggraben am Nordeingang erhielt eine Steinbrücke. Dem Pforthaus,
dessen Erdgeschoßmauern noch standen, gab man einen Fachwerkaufsatz und dem Rundturm der Nordwestecke noch
dazu ein Kegeldach. Im Jahre 1729 besuchte Fürstbischof Clemens August den Drosten ans dem Wohldenberg. Der
baulustige Fürst, der auch Erzbischof von Köln und Hochmeister des Deutschen Ritterordens war, ließ 1731 im An-
schluß an das Torhaus eine Kirche im Barockstil errichten, die dem St. Hubertus, dem Schutzpatron der Jäger, geweiht
wurde. Der linke Turm des Torhauses wurde zum Kirchturm ausgebaut.
Das Drostenamt hörte auf, als am 3. August 1802 das Fürstentum Hildesheim dem Königreich Preußen ein-
verleibt wurde. Die preußische Herrschaft wurde 1806 durch die westfälische abgelöst, ihr folgte 1813 die hannover-
sche Landeshoheit.
5. Der Ausflugsort. Da der Wohldenberg ein beliebter Ausflugsort wurde, verwandelte man 1858 den
alten Bergfried in einen hohen Aussichtsturm. Von seiner, mit einer Zinnenbekrönung versehenen Plattform genießt
man einen der reizvollsten Rundblicke über das Bergland des nördlichen Vorharzes.
Ein tiefer, zum Teil in den anstehenden Felsen eingehauener Burggraben umschließt noch heute die mittel-
alterliche Feste, aber die Ringmauer ist bis auf geringe Reste verschwunden. Die Bewohner der Umgegend haben
die Ruine als Steinbruch ausgebeutet, bis die Regierung Einhalt gebot. Das einzige Tor der Feste lag im Norden,
es führte in die Vorburg. Von dieser sind die im 18. Jahrhundert erneuerten Gebäude erhalten. Die durch einen
Zwinger besonders gesicherte Scheidemauer zwischen Vorburg und der etwas höher liegenden Hauptburg ist bis aus
den als Aussichtsturm dienenden Bergfried abgetragen. Von der Hauptburg, die durch eine von Norden nach Süden
ziehende Malier in zwei Teile geteilt wurde, sind keine Reste erhalten, Schloß und Scheune sind beseitigt. Den ver-
schütteten Brunnen hat man vor einigen Jahren aufzuräumen versucht, man ist nur wenige Meter tief gekommen.
Das Siechenhaus ist zu einem ummauerten Garten geworden.
Seit 1866 gehört der Wohldenberg und sein Gebiet zum preußischen Staat und in ihm seit 1885 zum Kreis
Marienburg i. H.
Quellenangabe: F. Günther, Der Wohldenberg und seine Umgebung. Hannover 1889. — A. Bertram, Geschichte des Bis-
tums Hildesheim. Bd. 1. Hildesheim 1899. —H. Siebern u. D. Kayser, Die Kunstdenkmäler des Kreises Marienburg. Hannover 1910. —
H. Blume, Der Wohldenberg. Hildesheim 1928.