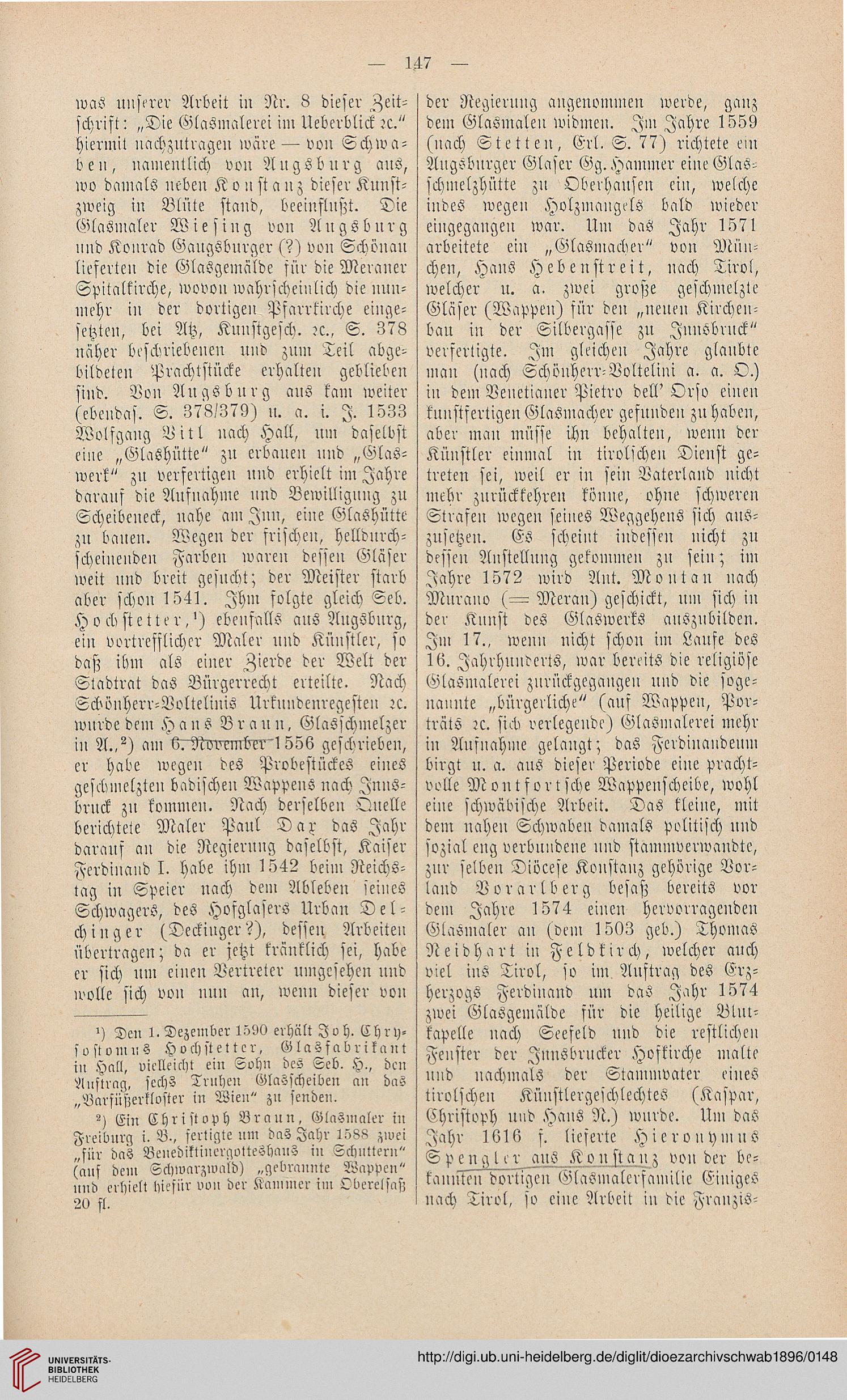147
waS unserer Arbeit in Nr. 8 dieser Zeit-
schrift: „Die Glasmalerei im Ueberblick?c."
hiermit nachzutragen wäre — von Schwa-
den, namentlich von Augsburg aus,
wo damals neben Konstanz dieser Kunst-
zweig in Blüte stand, beeinflußt. Die
Glasmaler Wie sing von Augsburg
und Konrad GaugSburger (?) von Schönau
lieferten die GlaSgemälde für die Meraner
Spitalkirche, wovon wahrscheinlich die nun-
mehr in der dortigen Pfarrkirche einge-
setzten, bei Atz, Kunstgesch. ic., S. 378
näher beschriebenen und zum Teil abge-
bildeten Prachtstücke erhalten geblieben
sind. Von Augsburg ans kam weiter
(ebendas. S. 378/379) n. a. i. I. 1533
Wolfgang Vitl nach Hall, um daselbst
eine „Glashütte" zu erbauen und „Glas-
werk" zu verfertigen und erhielt im Jahre
darauf die Aufnahme und Bewilligung zu
Scheibeueck, nahe am Inn, eine Glashütte
zu bauen. Wegen der frischen, helldurch-
scheinendcn Farben waren dessen Gläser
weit und breit gesucht; der Meister starb
aber schon 1541. Ihm folgte gleich Seb.
H o eh sietter,') ebenfalls aus Augsburg,
ein vortrefflicher Maler und Künstler, so
daß ihm als einer Zierde der Welt der
Stadtrat das Bürgerrecht erteilte. Nach
Scbönherr-VolteliniS Urknndenregesten ic.
wurde dem H ans Bra u n, Glasschmelzer
in A.Z) am 67MDvemberA 556 geschrieben,
er habe wegen des Probestückes eines
geschmelzten badischen Wappens nach Inns-
bruck zu kommen. Nach derselben Quelle
berichtete Maler Paul Dax das Jahr
darauf an die Negierung daselbst, Kaiser
Ferdinand I. habe ihm 1542 beim Reichs-
tag in Speier nach dem Ableben seines
Schwagers, des Hofglasers Urban Del-
chiuger (Deckiuger?), dessen Arbeiten
übertragen; da er jetzt kränklich sei, habe
er sich um einen Vertreter umgcsehen und
wolle sich von nnn an, wenn dieser von
l) Den 1- Dezember 1590 erhalt Jo h. Chry-
sostomi! s HvchsteIter, Glasfabrikant
in Halt, vielleicht ein Sohn des Seb. H., den
Auftrag, sechs Truhen Glasscheiben an das
„Bnrfüßerkloster in Wien" zu senden.
ch Ein Christoph Braun, Glasmaler in
Freibnrg i. B-, fertigte nm das Jahr 1588 zwei
„für das Benediktinergvtteshaus in Schlittern"
(aus dem Schwarzwald) „gebrannte Wappen"
und erhielt hiefür von der Kammer im Oberelsas;
20 fl.
der Negierung angenommen werde, ganz
dem Glaömalen widmen. Im Jahre 1559
(nach Stetten, Erl. S. 77) richtete eui
Augsburger Glaser Gg. Hammer eineGlaS-
schmelzhütte zu Oberhausen ein, welche
indes wegen Holzmangels bald wieder
eiugegangen war. Um das Jahr 1571
arbeitete ein „Glasmacher" von Mün-
chen, HanS Hebenstreit, nach Tirol,
welcher u. a. zwei große geschmelzte
Gläser (Wappen) für den „neuen Kirchen-
bau in der Silbergasse zu Innsbruck"
verfertigte. Im gleichen Jahre glaubte
man (nach Schönherr-Voltelini a. a. O.)
in dem Venetianer Pietro dell' Orso einen
kunstfertigen Glasmacher gefunden zu haben,
aber man müsse ihn behalten, wenn der
Künstler einmal in tirolschen Dienst ge-
treten sei, weil er in sein Vaterland nicht
mehr zurückkehren könne, ohne schweren
Strafen wegen seines Weggehens sich ans-
zusetzen. Es scheint indessen nicht zu
dessen Anstellung gekommen zu sein; im
Jahre 1572 wird Aut. Montan nach
Mnrano (— Meran) geschickt, um sich in
der Kunst des Glaswerks ansznbilden.
Im 17., wenn nicht schon im Laufe des
16. Jahrhunderts, war bereits die religiöse
Glasmalerei znrückgegangen und die soge-
nannte „bürgerliche" (auf Wappen, Por-
träts :c. sieh verlegende) Glasmalerei mehr
in Aufnahme gelangt; das Ferdinandeum
birgt n. a. aus dieser Periode eine pracht-
volle Mont fort sehe Wappenscheibe, wohl
eine schwäbische Arbeit. Das kleine, mit
dem nahen Schwaben damals politisch und
sozial eng verbundene und stammverwandte,
zur selben Diöcese Konstanz gehörige Vor-
land Vorarlberg besaß bereits vor
dem Jahre 1574 einen hervorragenden
Glasmaler an (dem 1503 geb.) Thomas
Neid hart in Feldkirch, welcher auch
viel ins Tirol, so im Auftrag des Erz-
herzogs Ferdinand nm das Jahr 1574
zwei Glasgemälde für die heilige Blut-
kapelle nach Seefeld und die restliche»
Fenster der Innsbrucker Hofkirche malte
und nachmals der Stammvater eines
tirolschen Knnstlergeschlechtes (Kaspar,
Christoph und Hans N.) wurde. Um das
Jahr 1616 f. lieferte Hieronymus
Spengler aus Konstanz von der be-
kannten dortigen Glasmalerfamilie Einiges
nach Tirol, so eine Arbeit in die Franzis-
waS unserer Arbeit in Nr. 8 dieser Zeit-
schrift: „Die Glasmalerei im Ueberblick?c."
hiermit nachzutragen wäre — von Schwa-
den, namentlich von Augsburg aus,
wo damals neben Konstanz dieser Kunst-
zweig in Blüte stand, beeinflußt. Die
Glasmaler Wie sing von Augsburg
und Konrad GaugSburger (?) von Schönau
lieferten die GlaSgemälde für die Meraner
Spitalkirche, wovon wahrscheinlich die nun-
mehr in der dortigen Pfarrkirche einge-
setzten, bei Atz, Kunstgesch. ic., S. 378
näher beschriebenen und zum Teil abge-
bildeten Prachtstücke erhalten geblieben
sind. Von Augsburg ans kam weiter
(ebendas. S. 378/379) n. a. i. I. 1533
Wolfgang Vitl nach Hall, um daselbst
eine „Glashütte" zu erbauen und „Glas-
werk" zu verfertigen und erhielt im Jahre
darauf die Aufnahme und Bewilligung zu
Scheibeueck, nahe am Inn, eine Glashütte
zu bauen. Wegen der frischen, helldurch-
scheinendcn Farben waren dessen Gläser
weit und breit gesucht; der Meister starb
aber schon 1541. Ihm folgte gleich Seb.
H o eh sietter,') ebenfalls aus Augsburg,
ein vortrefflicher Maler und Künstler, so
daß ihm als einer Zierde der Welt der
Stadtrat das Bürgerrecht erteilte. Nach
Scbönherr-VolteliniS Urknndenregesten ic.
wurde dem H ans Bra u n, Glasschmelzer
in A.Z) am 67MDvemberA 556 geschrieben,
er habe wegen des Probestückes eines
geschmelzten badischen Wappens nach Inns-
bruck zu kommen. Nach derselben Quelle
berichtete Maler Paul Dax das Jahr
darauf an die Negierung daselbst, Kaiser
Ferdinand I. habe ihm 1542 beim Reichs-
tag in Speier nach dem Ableben seines
Schwagers, des Hofglasers Urban Del-
chiuger (Deckiuger?), dessen Arbeiten
übertragen; da er jetzt kränklich sei, habe
er sich um einen Vertreter umgcsehen und
wolle sich von nnn an, wenn dieser von
l) Den 1- Dezember 1590 erhalt Jo h. Chry-
sostomi! s HvchsteIter, Glasfabrikant
in Halt, vielleicht ein Sohn des Seb. H., den
Auftrag, sechs Truhen Glasscheiben an das
„Bnrfüßerkloster in Wien" zu senden.
ch Ein Christoph Braun, Glasmaler in
Freibnrg i. B-, fertigte nm das Jahr 1588 zwei
„für das Benediktinergvtteshaus in Schlittern"
(aus dem Schwarzwald) „gebrannte Wappen"
und erhielt hiefür von der Kammer im Oberelsas;
20 fl.
der Negierung angenommen werde, ganz
dem Glaömalen widmen. Im Jahre 1559
(nach Stetten, Erl. S. 77) richtete eui
Augsburger Glaser Gg. Hammer eineGlaS-
schmelzhütte zu Oberhausen ein, welche
indes wegen Holzmangels bald wieder
eiugegangen war. Um das Jahr 1571
arbeitete ein „Glasmacher" von Mün-
chen, HanS Hebenstreit, nach Tirol,
welcher u. a. zwei große geschmelzte
Gläser (Wappen) für den „neuen Kirchen-
bau in der Silbergasse zu Innsbruck"
verfertigte. Im gleichen Jahre glaubte
man (nach Schönherr-Voltelini a. a. O.)
in dem Venetianer Pietro dell' Orso einen
kunstfertigen Glasmacher gefunden zu haben,
aber man müsse ihn behalten, wenn der
Künstler einmal in tirolschen Dienst ge-
treten sei, weil er in sein Vaterland nicht
mehr zurückkehren könne, ohne schweren
Strafen wegen seines Weggehens sich ans-
zusetzen. Es scheint indessen nicht zu
dessen Anstellung gekommen zu sein; im
Jahre 1572 wird Aut. Montan nach
Mnrano (— Meran) geschickt, um sich in
der Kunst des Glaswerks ansznbilden.
Im 17., wenn nicht schon im Laufe des
16. Jahrhunderts, war bereits die religiöse
Glasmalerei znrückgegangen und die soge-
nannte „bürgerliche" (auf Wappen, Por-
träts :c. sieh verlegende) Glasmalerei mehr
in Aufnahme gelangt; das Ferdinandeum
birgt n. a. aus dieser Periode eine pracht-
volle Mont fort sehe Wappenscheibe, wohl
eine schwäbische Arbeit. Das kleine, mit
dem nahen Schwaben damals politisch und
sozial eng verbundene und stammverwandte,
zur selben Diöcese Konstanz gehörige Vor-
land Vorarlberg besaß bereits vor
dem Jahre 1574 einen hervorragenden
Glasmaler an (dem 1503 geb.) Thomas
Neid hart in Feldkirch, welcher auch
viel ins Tirol, so im Auftrag des Erz-
herzogs Ferdinand nm das Jahr 1574
zwei Glasgemälde für die heilige Blut-
kapelle nach Seefeld und die restliche»
Fenster der Innsbrucker Hofkirche malte
und nachmals der Stammvater eines
tirolschen Knnstlergeschlechtes (Kaspar,
Christoph und Hans N.) wurde. Um das
Jahr 1616 f. lieferte Hieronymus
Spengler aus Konstanz von der be-
kannten dortigen Glasmalerfamilie Einiges
nach Tirol, so eine Arbeit in die Franzis-