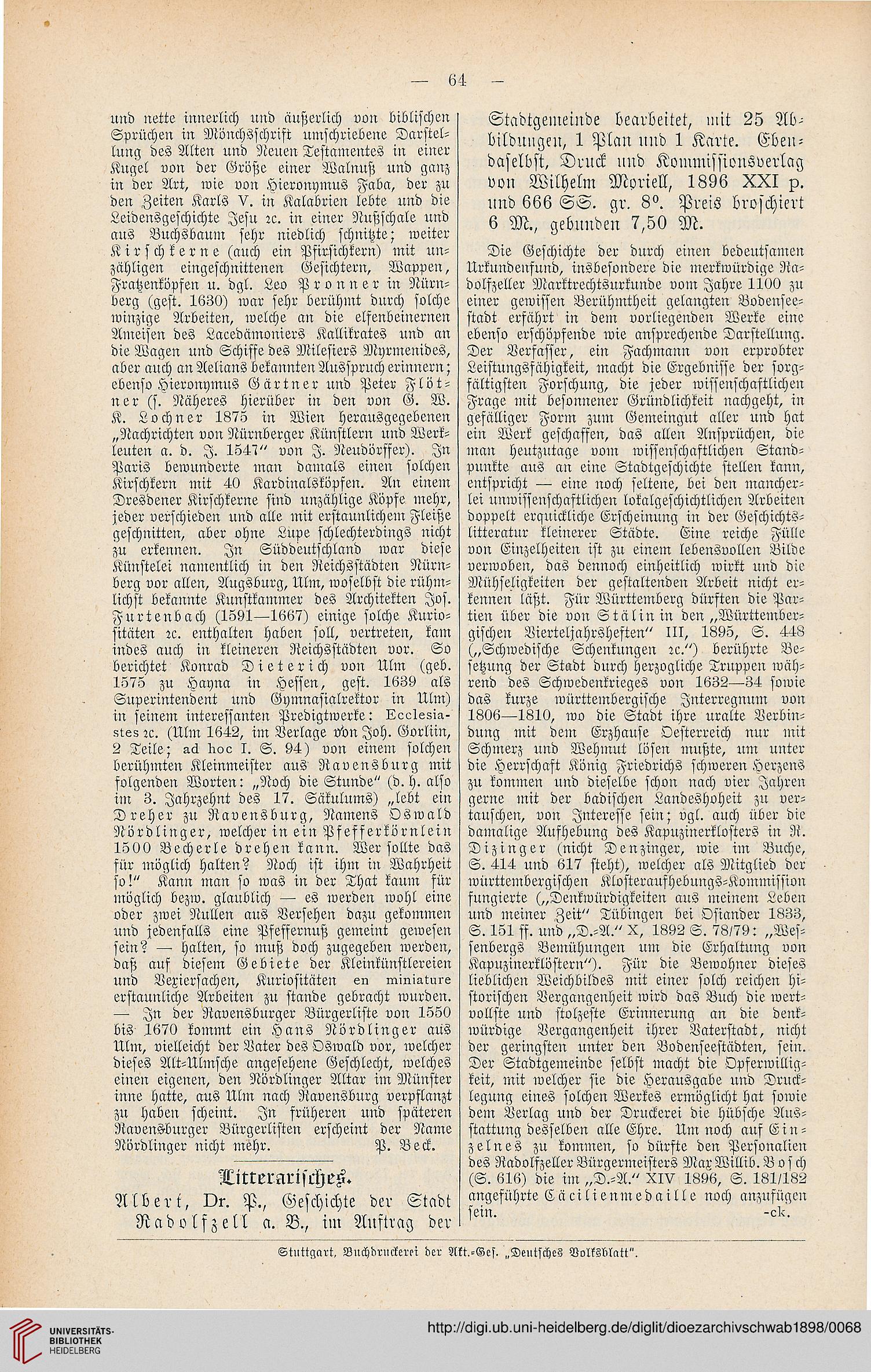und nette innerlich und äußerlich von biblischen
Sprüchen in Mönchsschrift umschriebene Darstel-
lung des Alten und Neuen Testamentes in einer
Kugel von der Größe einer Walnuß und ganz
in der Art, wie von Hieronymus Faba, der zu
den Zeiten Karls V. in Kalabrien lebte und die
Leidensgeschichte Jesu re. in einer Nußschale und
aus Buchsbauin sehr niedlich schnitzte; weiter
Kirschkerne (auch ein Pfirsichkern) mit un-
zähligen eingeschnittenen Gesichtern, Wappen,
Fratzenköpfen n. dgl. Leo Pronne r in Nürn-
berg (gest. 1630) war sehr berühmt durch solche
winzige Arbeiten, welche an die elfenbeinernen
Ameisen des Lacedämoniers Kallikrates und an
die Wagen und Schiffe des Milesiers Myrmenides,
aber auch an Aelians bekannten Ausspruch erinnern;
ebenso Hieronymus Gärtner und Peter Flöt-
ner (s. Näheres hierüber in den von G. W.
K. Lochner 1875 in Wien herausgegebenen
„Nachrichten von Nürnberger Künstlern und Werk-
leuten a. d. I. 1541" von I. Neudörffer). In
Paris bewunderte man damals einen solchen
Kirschkern mit 40 Kardinalsköpfen. An einem
Dresdener Kirschkerne sind unzählige Köpfe mehr,
jeder verschieden und alle mit erstaunlichen: Fleiße
geschnitten, aber ohne Lupe schlechterdings nicht
zu erkennen. In Süddeutschland war diese
Künstelei namentlich in den Reichsstädten Nürn-
berg vor allen, Augsburg, Ulm, woselbst die rühin-
lichst bekannte Kunstkammer des Architekten Jos.
Furtenbach (1591—1667) einige solche Kurio-
sitäten rc. enthalten haben soll, vertreten, kam
indes auch in kleineren Reichsstädten vor. So
berichtet Konrad Dieterich von Ulm (geb.
1575 zu Hayna in Hessen, gest. 1639 als
Superintendent und Gymnasialrektor in Ulm)
in seinem interessanten Predigtwerke: Heelssia-
8tes rc. (Ulm 1642, im Berlage vdn Joh. Gorliin,
2 Teile; ack lloc I. S. 94) von einem solchen
berühmten Kleinmeister aus Ravensburg mit
folgenden Worten: „Noch die Stunde" (d. h. also
im 3. Jahrzehnt des 17. Säkulums) „lebt ein
Dreher zu Ravensburg, Namens Oswald
Nördlinger, welcher in ein Pfefferkörnlein
1500 Becherle drehen kann. Wer sollte das
für möglich halten? Noch ist ihm in Wahrheit
so!" Kann man so was in der That kaum für
möglich bezw. glaublich — es werden wohl eine
oder zwei Nullen aus Versehen dazu gekommen
und jedenfalls eine Pfeffernuß gemeint gewesen
sein? —> halten, so muß doch zugegeben werden,
daß auf diesem Gebiete der Kleinkünstlereien
und Vexiersachen, Kuriositäten en miniature
erstaunliche Arbeiten zu stände gebracht wurden.
— In der Ravensburger Bürgerliste von 1550
bis 1670 kommt ein Hans Nördlinger aus
Ulm, vielleicht der Vater des Oswald vor, welcher
dieses Alt-Ulmsche angesehene Geschlecht, welches
einen eigenen, den Nördlinger Altar im Münster
inne hatte, aus Ulm nach Ravensburg verpflanzt
zu haben scheint. In früheren und späteren
Ravensburger Bürgerlisten erscheint der Name
Nördlinger nicht mehr. P. Beck.
TirrerarischeF.
Albert, Or. P., Geschichte der Stadt
Radolfzell a. B., im Auftrag der
Stadtgemeiude bearbeitet, mit 25 Ab-
bildungen, 1 Plan und 1 Karte. Eben-
daselbst, Druck und Kommissionsverlag
von Wilhelm Moriell, 1896 XXI p.
und 666 SS. gr. 8°. Preis broschiert
6 M., gebunden 7,50 M.
Die Geschichte der durch einen bedeutsamen
Urkundenfund, insbesondere die merkwürdige Ra-
dolfzeller Marktrschtsurkunde vom Jahre 1100 zu
einer gewissen Berühmtheit gelangten Bodensee-
stadt erfährt in dem vorliegenden Werke eine
ebenso erschöpfende wie ansprechende Darstellung.
Der Verfasser, ein Fachmann von erprobter
Leistungsfähigkeit, macht die Ergebnisse der sorg-
fältigsten Forschung, die jeder wissenschaftlichen
Frage mit besonnener Gründlichkeit nachgeht, in
gefälliger Form zum Gemeingut aller und hat
ein Werk geschaffen, das allen Ansprüchen, die
inan heutzutage vom wissenschaftlichen Stand-
punkte aus an eine Stndtgeschichte stellen kann,
entspricht — eine noch seltene, bei den mancher-
lei unwissenschaftlichen lokalgeschichtlichen Arbeiten
doppelt erquickliche Erscheinung in der Geschichts-
litteratur kleinerer Städte. Eins reiche Fülle
von Einzelheiten ist zu einem lebensvollen Bilde
verwoben, das dennoch einheitlich wirkt und die
Mühseligkeiten der gestaltenden Arbeit nicht er-
kennen läßt. Für Württemberg dürften die Par-
tien über die von Stälinin den „Württember-
gischen Vierteljahrsheften" III, 1895, S. 448
(„Schwedische Schenkungen rc.") berührte Be-
setzung der Stadt durch herzogliche Truppen wäh-
rend des Schwedenkrieges von 1632—34 sowie
das kurze württembergische Interregnum von
1806—1810, wo die Stadt ihre uralte Verbin-
dung mit den: Erzhause Oesterreich nur mit
Schrnerz und Wehmut lösen mußte, um unter
die Herrschaft König Friedrichs schweren Herzens
zu kommen und dieselbe schon nach vier Jahren
gerne mit der badischen Landeshoheit zu ver-
tauschen, voir Interesse sein; vgl. auch über die
damalige Aufhebung des Kapuzinerklosters in R.
Dizinger (nicht Denzinger, wie im Buche,
S. 414 und 617 steht), welcher als Mitglied der
württembergischen Klosteraufhebungs-Kommission
fungierte („Denkwürdigkeiten aus meinem Leben
und meiner Zeit" Tübingen bei Osiander 1833,
S. 151 ff. und „D.-A." X, 1892 S. 78/79: „Wes-
senbergs Bemühungen um die Erhaltung von
Knpuzinerklöstern"). Für die Bewohner dieses
lieblichen Weichbildes mit einer solch reichen hi-
storischen Vergangenheit wird das Buch die wert-
vollste und stolzeste Erinnerung an die denk-
würdige Vergangenheit ihrer Vaterstadt, nicht
der geringsten unter den Bodenseestädten, sein.
Der Stadtgemeiude selbst macht die Opferwillig-
keit, mit welcher sie die Herausgabe und Druck-
legung eines solchen Werkes ermöglicht hat sowie
dem Verlag und der Druckerei die hübsche Aus-
stattung desselben alle Ehre. Um noch auf Ein-
zelnes zu kommen, so dürfte den Personalien
des Radolfzeller Bürgermeisters MaxWillib. Bosch
(S. 616) die in: „D.-A." XIV 1896, S. 181/182
angeführte Cücilienmednille noch nnzufügen
sein. -cll.
Stuttgart. Buchdruckern der Nkt.-Ges. „Deutsches Bolkslilutt".
Sprüchen in Mönchsschrift umschriebene Darstel-
lung des Alten und Neuen Testamentes in einer
Kugel von der Größe einer Walnuß und ganz
in der Art, wie von Hieronymus Faba, der zu
den Zeiten Karls V. in Kalabrien lebte und die
Leidensgeschichte Jesu re. in einer Nußschale und
aus Buchsbauin sehr niedlich schnitzte; weiter
Kirschkerne (auch ein Pfirsichkern) mit un-
zähligen eingeschnittenen Gesichtern, Wappen,
Fratzenköpfen n. dgl. Leo Pronne r in Nürn-
berg (gest. 1630) war sehr berühmt durch solche
winzige Arbeiten, welche an die elfenbeinernen
Ameisen des Lacedämoniers Kallikrates und an
die Wagen und Schiffe des Milesiers Myrmenides,
aber auch an Aelians bekannten Ausspruch erinnern;
ebenso Hieronymus Gärtner und Peter Flöt-
ner (s. Näheres hierüber in den von G. W.
K. Lochner 1875 in Wien herausgegebenen
„Nachrichten von Nürnberger Künstlern und Werk-
leuten a. d. I. 1541" von I. Neudörffer). In
Paris bewunderte man damals einen solchen
Kirschkern mit 40 Kardinalsköpfen. An einem
Dresdener Kirschkerne sind unzählige Köpfe mehr,
jeder verschieden und alle mit erstaunlichen: Fleiße
geschnitten, aber ohne Lupe schlechterdings nicht
zu erkennen. In Süddeutschland war diese
Künstelei namentlich in den Reichsstädten Nürn-
berg vor allen, Augsburg, Ulm, woselbst die rühin-
lichst bekannte Kunstkammer des Architekten Jos.
Furtenbach (1591—1667) einige solche Kurio-
sitäten rc. enthalten haben soll, vertreten, kam
indes auch in kleineren Reichsstädten vor. So
berichtet Konrad Dieterich von Ulm (geb.
1575 zu Hayna in Hessen, gest. 1639 als
Superintendent und Gymnasialrektor in Ulm)
in seinem interessanten Predigtwerke: Heelssia-
8tes rc. (Ulm 1642, im Berlage vdn Joh. Gorliin,
2 Teile; ack lloc I. S. 94) von einem solchen
berühmten Kleinmeister aus Ravensburg mit
folgenden Worten: „Noch die Stunde" (d. h. also
im 3. Jahrzehnt des 17. Säkulums) „lebt ein
Dreher zu Ravensburg, Namens Oswald
Nördlinger, welcher in ein Pfefferkörnlein
1500 Becherle drehen kann. Wer sollte das
für möglich halten? Noch ist ihm in Wahrheit
so!" Kann man so was in der That kaum für
möglich bezw. glaublich — es werden wohl eine
oder zwei Nullen aus Versehen dazu gekommen
und jedenfalls eine Pfeffernuß gemeint gewesen
sein? —> halten, so muß doch zugegeben werden,
daß auf diesem Gebiete der Kleinkünstlereien
und Vexiersachen, Kuriositäten en miniature
erstaunliche Arbeiten zu stände gebracht wurden.
— In der Ravensburger Bürgerliste von 1550
bis 1670 kommt ein Hans Nördlinger aus
Ulm, vielleicht der Vater des Oswald vor, welcher
dieses Alt-Ulmsche angesehene Geschlecht, welches
einen eigenen, den Nördlinger Altar im Münster
inne hatte, aus Ulm nach Ravensburg verpflanzt
zu haben scheint. In früheren und späteren
Ravensburger Bürgerlisten erscheint der Name
Nördlinger nicht mehr. P. Beck.
TirrerarischeF.
Albert, Or. P., Geschichte der Stadt
Radolfzell a. B., im Auftrag der
Stadtgemeiude bearbeitet, mit 25 Ab-
bildungen, 1 Plan und 1 Karte. Eben-
daselbst, Druck und Kommissionsverlag
von Wilhelm Moriell, 1896 XXI p.
und 666 SS. gr. 8°. Preis broschiert
6 M., gebunden 7,50 M.
Die Geschichte der durch einen bedeutsamen
Urkundenfund, insbesondere die merkwürdige Ra-
dolfzeller Marktrschtsurkunde vom Jahre 1100 zu
einer gewissen Berühmtheit gelangten Bodensee-
stadt erfährt in dem vorliegenden Werke eine
ebenso erschöpfende wie ansprechende Darstellung.
Der Verfasser, ein Fachmann von erprobter
Leistungsfähigkeit, macht die Ergebnisse der sorg-
fältigsten Forschung, die jeder wissenschaftlichen
Frage mit besonnener Gründlichkeit nachgeht, in
gefälliger Form zum Gemeingut aller und hat
ein Werk geschaffen, das allen Ansprüchen, die
inan heutzutage vom wissenschaftlichen Stand-
punkte aus an eine Stndtgeschichte stellen kann,
entspricht — eine noch seltene, bei den mancher-
lei unwissenschaftlichen lokalgeschichtlichen Arbeiten
doppelt erquickliche Erscheinung in der Geschichts-
litteratur kleinerer Städte. Eins reiche Fülle
von Einzelheiten ist zu einem lebensvollen Bilde
verwoben, das dennoch einheitlich wirkt und die
Mühseligkeiten der gestaltenden Arbeit nicht er-
kennen läßt. Für Württemberg dürften die Par-
tien über die von Stälinin den „Württember-
gischen Vierteljahrsheften" III, 1895, S. 448
(„Schwedische Schenkungen rc.") berührte Be-
setzung der Stadt durch herzogliche Truppen wäh-
rend des Schwedenkrieges von 1632—34 sowie
das kurze württembergische Interregnum von
1806—1810, wo die Stadt ihre uralte Verbin-
dung mit den: Erzhause Oesterreich nur mit
Schrnerz und Wehmut lösen mußte, um unter
die Herrschaft König Friedrichs schweren Herzens
zu kommen und dieselbe schon nach vier Jahren
gerne mit der badischen Landeshoheit zu ver-
tauschen, voir Interesse sein; vgl. auch über die
damalige Aufhebung des Kapuzinerklosters in R.
Dizinger (nicht Denzinger, wie im Buche,
S. 414 und 617 steht), welcher als Mitglied der
württembergischen Klosteraufhebungs-Kommission
fungierte („Denkwürdigkeiten aus meinem Leben
und meiner Zeit" Tübingen bei Osiander 1833,
S. 151 ff. und „D.-A." X, 1892 S. 78/79: „Wes-
senbergs Bemühungen um die Erhaltung von
Knpuzinerklöstern"). Für die Bewohner dieses
lieblichen Weichbildes mit einer solch reichen hi-
storischen Vergangenheit wird das Buch die wert-
vollste und stolzeste Erinnerung an die denk-
würdige Vergangenheit ihrer Vaterstadt, nicht
der geringsten unter den Bodenseestädten, sein.
Der Stadtgemeiude selbst macht die Opferwillig-
keit, mit welcher sie die Herausgabe und Druck-
legung eines solchen Werkes ermöglicht hat sowie
dem Verlag und der Druckerei die hübsche Aus-
stattung desselben alle Ehre. Um noch auf Ein-
zelnes zu kommen, so dürfte den Personalien
des Radolfzeller Bürgermeisters MaxWillib. Bosch
(S. 616) die in: „D.-A." XIV 1896, S. 181/182
angeführte Cücilienmednille noch nnzufügen
sein. -cll.
Stuttgart. Buchdruckern der Nkt.-Ges. „Deutsches Bolkslilutt".