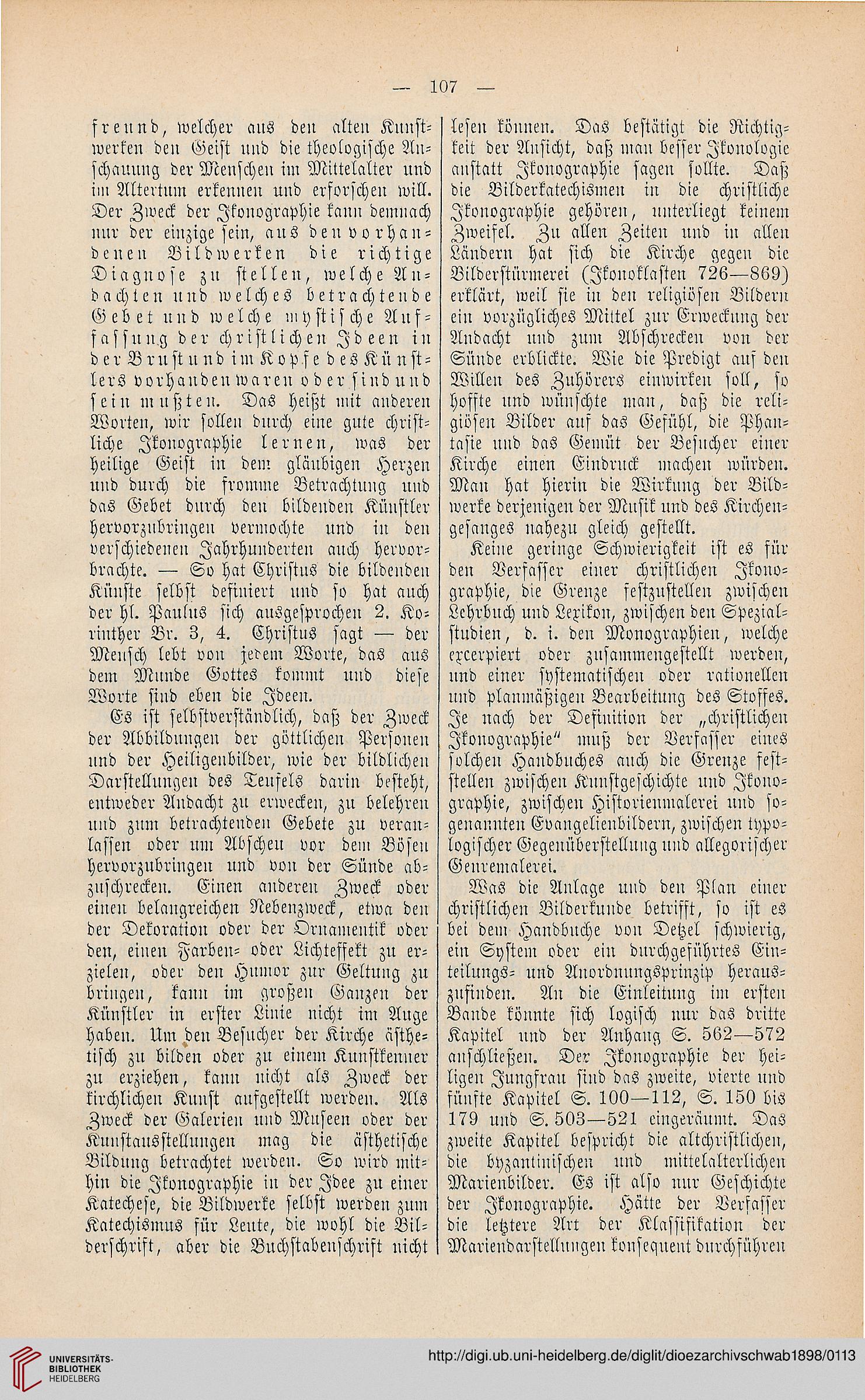107
freund, welcher aus den alten Kunst-
werken den Geist und die theologische An-
schauung der Menschen im Mittelalter und
im Altertum erkennen und erforschen will.
Der Zweck der Ikonographie kann demnach
nur der einzige sein, aus den vorhan-
denen Bildwerken die richtige
Diagnose zu stellen, welche An-
dachten und welches betrachtende
Gebet und welche mystische Auf-
fassung der christlichen Ideen in
dcrBrustund imKopfe deS K ü n st -
lers vorhanden waren oder sind und
sein mußten. Das heißt mit anderen
Worten, wir solle» durch eine gute christ-
liche Ikonographie lernen, was der
heilige Geist in dem gläubigen Herzen
und durch die fromme Betrachtung und
das Gebet durch deu bildendeu Künstler
hervorznbringen vermochte und in den
verschiedenen Jahrhunderten auch hervor-
brachte. — So hat Christus die bildenden
Künste selbst definiert und so hat auch
der hl. Paulus sich ausgesprochen 2. Ko-
rinther Br. 3, 4. Christus sagt — der
Mensch lebt von jedem Worte, das aus
dem Munde Gottes kommt und diese
Worte sind eben die Ideen.
Es ist selbstverständlich, daß der Zweck
der Abbildungen der göttlichen Personen
und der Heiligenbilder, wie der bildlichen
Darstellungen des Teufels darin besteht,
entweder Andacht zu erwecken, zu belehre»
und znm betrachtenden Gebete zu veran-
lassen oder um Abscheu vor dein Bösen
hervorzubringen und von der Sünde ab-
zuschrecken. Einen anderen Zweck oder
einen belangreichen Nebenzweck, etwa den
der Dekoration oder der Ornamentik oder
den, einen Farben- oder Lichteffekt zu er-
zielen, oder den Humor zur Geltung zu
bringen, kann im großen Ganzen der
Künstler in erster Linie nicht im Auge
haben. Um den Besucher der Kirche ästhe-
tisch zu bilden oder zu einem Kunstkenner
zu erziehen, kann nicht als Zweck der
kirchlichen Kunst aufgestellt werden. Als
Zweck der Galerien und Museen oder der
Kunstausstellungen mag die ästhetische
Bildung betrachtet werden. Do wird mit-
hin die Ikonographie in der Idee zu einer
Katechese, die Bildwerke selbst werden zum
Katechismus für Leute, die wohl die Bil-
derschrift, aber die Buchstabenschrift nicht
lesen können. Das bestätigt die Richtig-
keit der Ansicht, daß man besser Jkonvlogie
anstatt Ikonographie sagen sollte. Daß
die Bilderkatechismen in die christliche
Ikonographie gehöre», unterliegt keinem
Zweifel. Zu allen Zeiten und in allen
Ländern hat sich die Kirche gegen die
Bilderstürmerei (Jkouoklasten 726—869)
erklärt, weil sie in den religiösen Bildern
ein vorzügliches Mittel zur Erweckung der
Andacht und zum Abschrecken von der
Sünde erblickte. Wie die Predigt auf den
Willen des Zuhörers einwirken soll, so
hoffte und wünschte man, daß die reli-
giösen Bilder ans das Gefühl, die Phan-
tasie und das Gemüt der Besucher einer
Kirche einen Eindruck machen würden.
Man hat hierin die Wirkung der Bild-
werke derjenigen der Musik und des Kirchen-
gesanges nahezu gleich gestellt.
Keine geringe Schwierigkeit ist es für
den Verfasser einer christlichen Ikono-
graphie, die Grenze festzustellen zwischen
Lehrbuch und Lexikon, zwischen den Spezial-
studien, d. i. den Monographien, welche
cxcerpiert oder znsammengestellt werden,
und einer systematischen oder rationellen
und planmäßigen Bearbeitung des Stoffes.
Je nach der Definition der „christlichen
Ikonographie" muß der Verfasser eines
solchen Handbuches auch die Grenze fest-
stellen zwischen Kunstgeschichte und Ikono-
graphie, zwischen Historienmalerei und so-
genannten Evangelienbildern, zwischen typo-
logischer Gegenüberstellung und allegorischer
Genremalerei.
Was die Anlage und den Plan einer
christlichen Bilderkunde betrifft, so ist eS
bei dem Handbuche von Detzel schwierig,
ein System oder ein durchgeführtes Ein-
teilungs- und Anordnungsprinzip herauö-
zusinden. An die Einleitung im ersten
Bande könnte sich logisch nur das dritte
Kapitel und der Anhang S. 562—572
anschließen. Der Ikonographie der hei-
ligen Jungfrau sind das zweite, vierte und
fünfte Kapitel S. 100—112, S. 150 bis
179 und S. 503—521 cingeräumt. Das
zweite Kapitel bespricht die altchristlichen,
die byzantinischen und mittelalterlichen
Marienbilder. Es ist also nur Geschichte
der Ikonographie. Hätte der Verfasser
die letztere Art der Klassifikation der
Mariendarstellungen konsequent durchführen
freund, welcher aus den alten Kunst-
werken den Geist und die theologische An-
schauung der Menschen im Mittelalter und
im Altertum erkennen und erforschen will.
Der Zweck der Ikonographie kann demnach
nur der einzige sein, aus den vorhan-
denen Bildwerken die richtige
Diagnose zu stellen, welche An-
dachten und welches betrachtende
Gebet und welche mystische Auf-
fassung der christlichen Ideen in
dcrBrustund imKopfe deS K ü n st -
lers vorhanden waren oder sind und
sein mußten. Das heißt mit anderen
Worten, wir solle» durch eine gute christ-
liche Ikonographie lernen, was der
heilige Geist in dem gläubigen Herzen
und durch die fromme Betrachtung und
das Gebet durch deu bildendeu Künstler
hervorznbringen vermochte und in den
verschiedenen Jahrhunderten auch hervor-
brachte. — So hat Christus die bildenden
Künste selbst definiert und so hat auch
der hl. Paulus sich ausgesprochen 2. Ko-
rinther Br. 3, 4. Christus sagt — der
Mensch lebt von jedem Worte, das aus
dem Munde Gottes kommt und diese
Worte sind eben die Ideen.
Es ist selbstverständlich, daß der Zweck
der Abbildungen der göttlichen Personen
und der Heiligenbilder, wie der bildlichen
Darstellungen des Teufels darin besteht,
entweder Andacht zu erwecken, zu belehre»
und znm betrachtenden Gebete zu veran-
lassen oder um Abscheu vor dein Bösen
hervorzubringen und von der Sünde ab-
zuschrecken. Einen anderen Zweck oder
einen belangreichen Nebenzweck, etwa den
der Dekoration oder der Ornamentik oder
den, einen Farben- oder Lichteffekt zu er-
zielen, oder den Humor zur Geltung zu
bringen, kann im großen Ganzen der
Künstler in erster Linie nicht im Auge
haben. Um den Besucher der Kirche ästhe-
tisch zu bilden oder zu einem Kunstkenner
zu erziehen, kann nicht als Zweck der
kirchlichen Kunst aufgestellt werden. Als
Zweck der Galerien und Museen oder der
Kunstausstellungen mag die ästhetische
Bildung betrachtet werden. Do wird mit-
hin die Ikonographie in der Idee zu einer
Katechese, die Bildwerke selbst werden zum
Katechismus für Leute, die wohl die Bil-
derschrift, aber die Buchstabenschrift nicht
lesen können. Das bestätigt die Richtig-
keit der Ansicht, daß man besser Jkonvlogie
anstatt Ikonographie sagen sollte. Daß
die Bilderkatechismen in die christliche
Ikonographie gehöre», unterliegt keinem
Zweifel. Zu allen Zeiten und in allen
Ländern hat sich die Kirche gegen die
Bilderstürmerei (Jkouoklasten 726—869)
erklärt, weil sie in den religiösen Bildern
ein vorzügliches Mittel zur Erweckung der
Andacht und zum Abschrecken von der
Sünde erblickte. Wie die Predigt auf den
Willen des Zuhörers einwirken soll, so
hoffte und wünschte man, daß die reli-
giösen Bilder ans das Gefühl, die Phan-
tasie und das Gemüt der Besucher einer
Kirche einen Eindruck machen würden.
Man hat hierin die Wirkung der Bild-
werke derjenigen der Musik und des Kirchen-
gesanges nahezu gleich gestellt.
Keine geringe Schwierigkeit ist es für
den Verfasser einer christlichen Ikono-
graphie, die Grenze festzustellen zwischen
Lehrbuch und Lexikon, zwischen den Spezial-
studien, d. i. den Monographien, welche
cxcerpiert oder znsammengestellt werden,
und einer systematischen oder rationellen
und planmäßigen Bearbeitung des Stoffes.
Je nach der Definition der „christlichen
Ikonographie" muß der Verfasser eines
solchen Handbuches auch die Grenze fest-
stellen zwischen Kunstgeschichte und Ikono-
graphie, zwischen Historienmalerei und so-
genannten Evangelienbildern, zwischen typo-
logischer Gegenüberstellung und allegorischer
Genremalerei.
Was die Anlage und den Plan einer
christlichen Bilderkunde betrifft, so ist eS
bei dem Handbuche von Detzel schwierig,
ein System oder ein durchgeführtes Ein-
teilungs- und Anordnungsprinzip herauö-
zusinden. An die Einleitung im ersten
Bande könnte sich logisch nur das dritte
Kapitel und der Anhang S. 562—572
anschließen. Der Ikonographie der hei-
ligen Jungfrau sind das zweite, vierte und
fünfte Kapitel S. 100—112, S. 150 bis
179 und S. 503—521 cingeräumt. Das
zweite Kapitel bespricht die altchristlichen,
die byzantinischen und mittelalterlichen
Marienbilder. Es ist also nur Geschichte
der Ikonographie. Hätte der Verfasser
die letztere Art der Klassifikation der
Mariendarstellungen konsequent durchführen