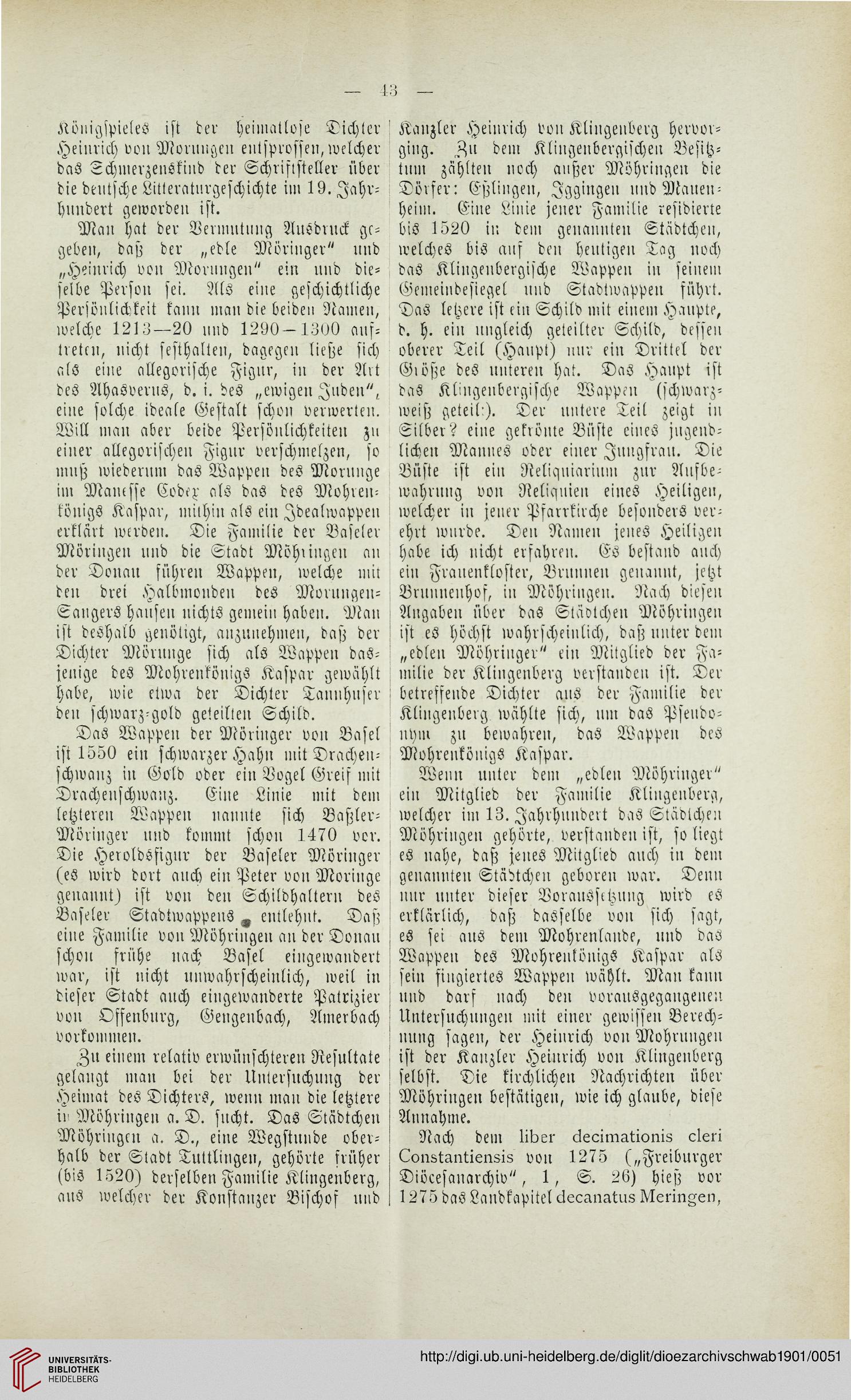Königspieles ist der heimatlose Dichter
Heinrich von Mornngen entsprossen, welcher
das Schmerzenskind der Schriftsteller über
die deutsche Litteratnrgeschichte im 19. Jahr-
hundert geworden ist.
Man hat der Vermutung Ausdruck ge-
geben, daß der „edle Möringer" und
„Heinrich von Mornngen" ein und die-
selbe Person sei. Als eine geschichtliche
Persönlichkeit kann man die beiden blamen,
welche 1213—20 und 1290—1300 auf-
tretcn, nicht sesthalten, dagegen liehe sich
als eine allegorische Figur, in der Art
des Ahasverns, d. i. des „ewigen Juden",
eine solche ideale Gestalt schon verwerten.
Will man aber beide Persönlichkeiten zu
einer allegorischen Figur verschmelzen, so
muß wiederum das Wappen des Morunge
im Malusse Codex als das des Mohren-
köuigs Kaspar, mithin als ein Jdealwappen
erklärt werden. Die Familie der Baseler
Möringen und die Stadt Möhringen an
der Donau führen Wappen, welche mit
deir drei Halbmonden des Mornngen-
SangerS Hausen nichts gemein haben. Blau
ist deshalb genötigt, anzunehmen, daß der
Dichter Mörunge sich als Wappen das-
jenige des Mohrenkönigs Kaspar gewählt
habe, wie etwa der Dichter Tannhnser
den schwarz-gold geteilten Schild.
Das Wappen der Möringer von Basel
ist 1550 ein schwarzer Hahn mit Drachen-
schwanz in Gold oder ein Vogel Greis mit
Drachenschwauz. Eine Linie mit dem
letzteren Wappen nannte sich Baßler-
Möringer und kommt schon 1470 vor.
Die Heroldsfigur der Baseler Möringer
(es wird dort auch ein Peter von Moringe
genannt) ist von den Schildhaltern des
Baseler Stadtwappens ^ entlehnt. Daß
eine Familie von Möhringen an der Donau
schon frühe nach Basel eingewandert
war, ist nicht unwahrscheinlich, weil in
dieser Stadt auch eingewanderte Patrizier
von Ofsenburg, Gengenbach, Amerbach
Vorkommen.
Zn einem relativ erwünschteren Resultate
gelangt man bei der Untersuchung der
Heimat des Dichters, wenn man die letztere
ir Möhringen a. D. sucht. Das Städtchen
Möhringen a. D., eine Wegstunde ober-
halb der Stadt Tuttlingen, gehörte früher
(bis 1520) derselben Familie Klingenberg,
ans welcher der Konstanzer Bischof und
! Kanzler Heinrich von Klingenberg hervor-
ging. Zn dem Klingenbergischen Besitz-
tum zählten noch außer Möhringen die
Dörfer: Eßlingen, Iggingen und Manen-
heim. Eine Linie jener Familie residierte
bis 1520 in dem genannten Städtchen,
welches bis auf den heutigen Tag noch
das Klingenbergische Wappen in seinem
Gemeindesiegel und Stadtwappen führt.
Das letzere ist ein Schild mit einem Haupte,
d. h. ein ungleich geteilter Schild, dessen
oberer Teil (Haupt) nur ein Drittel der
Giöße des unteren hat. Das Haupt ist
das Klingenbergische Wappen (schwarz-
weiß geteilt). Der untere Teil zeigt in
Silber? eine gekrönte Büste eines jugend-
lichen Mannes oder einer Jungfrau. Die
Büste ist ein Neliqniarinm zur Aufbe-
wahrung von Reliquien eines Heiligen,
welcher in jener Pfarrkirche besonders ver-
ehrt wurde. Den Namen jenes Heiligen
habe ich nicht erfahren. Es bestand auch
ein Franenkloster, Brunnen genannt, jetzt
Brnnnenhof, in Möhringen. Nach diesen
Angaben über das Städtchen Möhringen
ist es höchst wahrscheinlich, daß unter dem
„edlen Möhringer" ein Mitglied der Fa-
milie der Klingenberg verstanden ist. Der
betreffende Dichter ans der Familie der
Klingenberg wählte sich, um das Pseudo-
nym zu bewahren, das Wappen des
Mohrenkönigs Kaspar.
Wenn unter dem „edlen Möhringer"
ein Mitglied der Familie Klingenberg,
welcher im 13. Jahrhundert das Städtchen
Möhringen gehörte, verstanden ist, so liegt
es nahe, daß jenes Mitglied auch in dem
genannten Städtchen geboren war. Denn
nur unter dieser Voranösttznng wird es
erklärlich, daß dasselbe von sich sagt,
es sei ans dem Mohrentande, und das
Wappen des Mohrenkönigs Kaspar als
sein fingiertes Wappen wählt. Man kann
und darf nach den voransgegangenen
Untersuchungen mit einer gewisseil Berech-
nung sagen, der Heinrich von Mohrnngen
ist der Kanzler Heinrich von Klingenberg
selbst. Die kirchlichen Nachrichten über
Möhringen bestätigen, wie ich glaube, diese
Annahme.
Nach dem über ckecimntioiris cleri
Eoirstnirtiensis von 1275 („Freiburger
Diöcesanarchiv", 1, S. 26) hieß vor
1275 das Landkapitel äecemnkus Nennten,
Heinrich von Mornngen entsprossen, welcher
das Schmerzenskind der Schriftsteller über
die deutsche Litteratnrgeschichte im 19. Jahr-
hundert geworden ist.
Man hat der Vermutung Ausdruck ge-
geben, daß der „edle Möringer" und
„Heinrich von Mornngen" ein und die-
selbe Person sei. Als eine geschichtliche
Persönlichkeit kann man die beiden blamen,
welche 1213—20 und 1290—1300 auf-
tretcn, nicht sesthalten, dagegen liehe sich
als eine allegorische Figur, in der Art
des Ahasverns, d. i. des „ewigen Juden",
eine solche ideale Gestalt schon verwerten.
Will man aber beide Persönlichkeiten zu
einer allegorischen Figur verschmelzen, so
muß wiederum das Wappen des Morunge
im Malusse Codex als das des Mohren-
köuigs Kaspar, mithin als ein Jdealwappen
erklärt werden. Die Familie der Baseler
Möringen und die Stadt Möhringen an
der Donau führen Wappen, welche mit
deir drei Halbmonden des Mornngen-
SangerS Hausen nichts gemein haben. Blau
ist deshalb genötigt, anzunehmen, daß der
Dichter Mörunge sich als Wappen das-
jenige des Mohrenkönigs Kaspar gewählt
habe, wie etwa der Dichter Tannhnser
den schwarz-gold geteilten Schild.
Das Wappen der Möringer von Basel
ist 1550 ein schwarzer Hahn mit Drachen-
schwanz in Gold oder ein Vogel Greis mit
Drachenschwauz. Eine Linie mit dem
letzteren Wappen nannte sich Baßler-
Möringer und kommt schon 1470 vor.
Die Heroldsfigur der Baseler Möringer
(es wird dort auch ein Peter von Moringe
genannt) ist von den Schildhaltern des
Baseler Stadtwappens ^ entlehnt. Daß
eine Familie von Möhringen an der Donau
schon frühe nach Basel eingewandert
war, ist nicht unwahrscheinlich, weil in
dieser Stadt auch eingewanderte Patrizier
von Ofsenburg, Gengenbach, Amerbach
Vorkommen.
Zn einem relativ erwünschteren Resultate
gelangt man bei der Untersuchung der
Heimat des Dichters, wenn man die letztere
ir Möhringen a. D. sucht. Das Städtchen
Möhringen a. D., eine Wegstunde ober-
halb der Stadt Tuttlingen, gehörte früher
(bis 1520) derselben Familie Klingenberg,
ans welcher der Konstanzer Bischof und
! Kanzler Heinrich von Klingenberg hervor-
ging. Zn dem Klingenbergischen Besitz-
tum zählten noch außer Möhringen die
Dörfer: Eßlingen, Iggingen und Manen-
heim. Eine Linie jener Familie residierte
bis 1520 in dem genannten Städtchen,
welches bis auf den heutigen Tag noch
das Klingenbergische Wappen in seinem
Gemeindesiegel und Stadtwappen führt.
Das letzere ist ein Schild mit einem Haupte,
d. h. ein ungleich geteilter Schild, dessen
oberer Teil (Haupt) nur ein Drittel der
Giöße des unteren hat. Das Haupt ist
das Klingenbergische Wappen (schwarz-
weiß geteilt). Der untere Teil zeigt in
Silber? eine gekrönte Büste eines jugend-
lichen Mannes oder einer Jungfrau. Die
Büste ist ein Neliqniarinm zur Aufbe-
wahrung von Reliquien eines Heiligen,
welcher in jener Pfarrkirche besonders ver-
ehrt wurde. Den Namen jenes Heiligen
habe ich nicht erfahren. Es bestand auch
ein Franenkloster, Brunnen genannt, jetzt
Brnnnenhof, in Möhringen. Nach diesen
Angaben über das Städtchen Möhringen
ist es höchst wahrscheinlich, daß unter dem
„edlen Möhringer" ein Mitglied der Fa-
milie der Klingenberg verstanden ist. Der
betreffende Dichter ans der Familie der
Klingenberg wählte sich, um das Pseudo-
nym zu bewahren, das Wappen des
Mohrenkönigs Kaspar.
Wenn unter dem „edlen Möhringer"
ein Mitglied der Familie Klingenberg,
welcher im 13. Jahrhundert das Städtchen
Möhringen gehörte, verstanden ist, so liegt
es nahe, daß jenes Mitglied auch in dem
genannten Städtchen geboren war. Denn
nur unter dieser Voranösttznng wird es
erklärlich, daß dasselbe von sich sagt,
es sei ans dem Mohrentande, und das
Wappen des Mohrenkönigs Kaspar als
sein fingiertes Wappen wählt. Man kann
und darf nach den voransgegangenen
Untersuchungen mit einer gewisseil Berech-
nung sagen, der Heinrich von Mohrnngen
ist der Kanzler Heinrich von Klingenberg
selbst. Die kirchlichen Nachrichten über
Möhringen bestätigen, wie ich glaube, diese
Annahme.
Nach dem über ckecimntioiris cleri
Eoirstnirtiensis von 1275 („Freiburger
Diöcesanarchiv", 1, S. 26) hieß vor
1275 das Landkapitel äecemnkus Nennten,