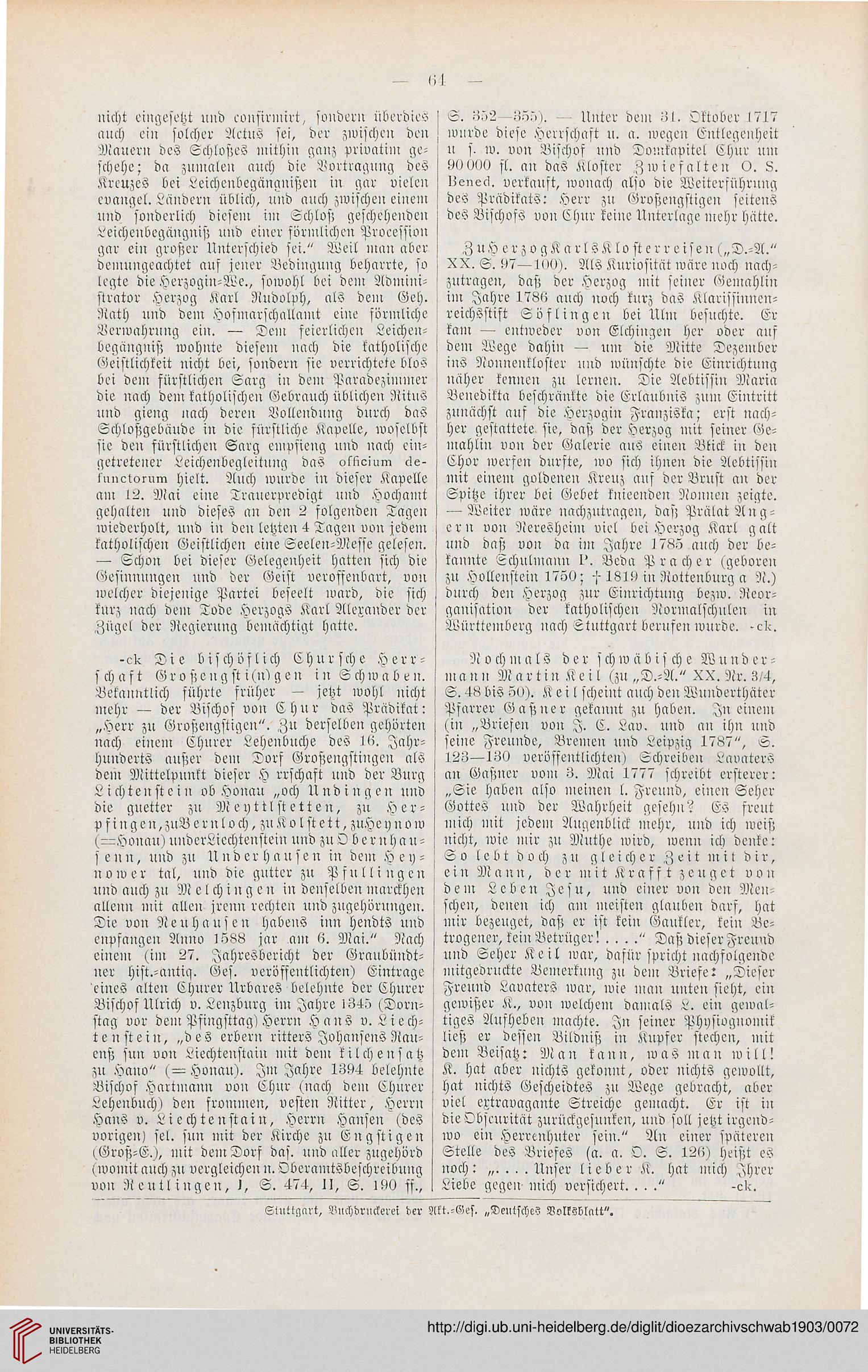»icht eingesetzt und ronfirmirt, sondern überdies
auch ei» solcher Actus sei, der zwischen den
Mauern des Schlosses mithin ganz privatim ge-
schehe; da zumalen auch die Vortragung des
Kreuzes bei Leichenbegängnissen in gar vielen
cvangel. Landern üblich, und auch zwischen einen,
und sonderlich diesem im Schloss geschehenden
Leichenbegängnis; und einer förmlichen Proeession
gar ein großer Unterschied sei." Weil inan aber
deniungeachtet auf jener Bedingung beharrte, so
legte die Herzogin-We., sowohl bei dem Admini-
strator Herzog Karl Rudolph, als dem Geh.
Rath und dem .Hofmarschnllamt eine förmliche
Verwahrung ein. — Dem feierlichen Leichen-
begängnis; wohnte diesem nach die katholische
Geistlichkeit nicht bei, sondern sie verrichtete blos
bei dein fürstlichen Sarg in dem Parndezimmer
die nach den, katholischen Gebrauch üblichen Ritus
und gieng nach deren Vollendung durch das
Schloßgebnude in die fürstliche Kapelle, woselbst
sie den fürstlichen Sarg einpfieng und nach cin-
getretener Leichenbegleitung das okbcium cle-
lünctoram hielt. Auch wurde in dieser Kapelle
am 12. Mai eine Trauerpredigt und Hochamt
gehalten und dieses an den 2 folgenden Tagen
wiederholt, und in den letzten 4 Tagen von jedem
katholischen Geistlichen eine Seelen-Messe gelesen.
— Schon bei dieser Gelegenheit hatten sich die
Gesinnungen und der Geist veroffenbart, von
welcher diejenige Partei beseelt ward, die sich
kurz nach den, Tode Herzogs Karl Alexander der
Zügel der Regierung bemächtigt hatte.
-ck Die bischöflich CH ursche Herr-
schaft Großcngstilnlgen in Schwaben.
Bekanntlich führte früher — jetzt wohl nicht
mehr — der Bischof von Chur das Prädikat:
„Herr zu Großengstigen". Zu derselben gehörten
nach einem Churer Lehenbuche des 16. Jahr-
hunderts außer dem Dorf Großengstingen als
dem Mittelpunkt dieser H rrschaft und der Burg
L i chten st e i n ob Honau „och Undingen und
die guetter zu Meyttlstetten, zu Her-
p fi»gen,zuB ernloch, zuKo lstett, zuHeynoiv
(^Honau) underLiechtenstein und zuObernhau-
senn, und zu Und er Hausen in dem Hey-
n o wer tnl, und die gutter zu Pfullingen
und auch zu Melchinge n in denselben marckhen
allen» mit allen jrenn rechten und zugehörungen.
Die von dien Hausen Habens inn hendts und
enpfangen Anno 1588 jar am 6. Mai." Nach
einem (im 27. Jahresbericht der Graubündt-
uer hist.-nntig. Ges. veröffentlichten) Eintrags
eines alten Churer Urbares belehnte der Churer
Bischof Ulrich v. Lenzburg im Jahre 1345 (Dorn-
stag vor dem Pfingsttag) Herrn Hans v. Liech-
tenstein, „des erber» ritters Johansens Rau-
ens; sun von Liechtenstain mit dem kilchensatz
zu Hano" (— Honau). Im Jahre 1394 belehnte
Bischof .Hartmann von Chur (nach dem Churer
Lehenbuch) den frommen, vesten Ritter, Herrn
Hans v. Liechtenstain, Herrn Hansen (des
vorigen) sei. sun mit der Kirche zu Engstigeir
(Groß-E.), mit dem Dorf das. und aller zugehörd
(womit nuch zu vergleichen n. Oberamtsbeschreibuirg
von Reutlingen, I, S. 474, II, S. >90 ff.,
S. 352 -355). — Unter dem 3l. Oktober 1717
wurde diese Herrschaft u. a. wegen Entlegenheit
u s. iv. von Bischof und Domkapitel Chur um
90 000 fl. an das Kloster Zwiefalten O. 8.
Ilenecl. verkauft, wonach also die Wetterführung
des Prädikats: Herr zu Großengstigen seitens
des Bischofs von Chur keine Unterlage mehr hätte.
Z u.H er z o g K a r l s K lo st e r r e iss n („D.-A."
XX. S. 97—100). Als Kuriosität wäre noch nnch-
zutragen, daß der Herzog mit seiner Gemahlin
im Jahre 1786 auch noch kurz das Klarissinnen-
reichsstift Söflingen bei Ulm besuchte. Er
kam — entweder von Elchingen her oder auf
dem Wege dahin — um die Mitte Dezember
ins Nonnenkloster und wünschte dis Einrichtung
näher kennen zu lernen. Die Aebtissin Maria
Benedikta beschränkte die Erlaubnis zum Eintritt
zunächst auf die Herzogin Franziska; erst nach-
her gestattete sie, daß der Herzog mit seiner Ge-
mahlin von der Galerie aus einen Blick in den
Chor werfen durfte, wo sich ihnen die Aebtissin
mit einem güldenen Kreuz auf der Brust an der
Spitze ihrer bei Gebet knieenden Nonnen zeigte.
— Weiter wäre nachzutrngen, daß Prälat Ang-
e r n von Neresheim viel bei Herzog Karl g alt
und daß von da im Jahre 178.5 nuch der be-
kannte Schulmann 1'. Beda Pracher (geboren
zu Höllenstein 1750; ft 1819 in Rottenburg a N.)
durch den Herzog zur Einrichtung bezw. Reor-
ganisation der katholischen Norinalschulcn in
Württemberg nach Stuttgart berufen würde, -cd.
N o ch mals de r s ch w äbische Wunder-
mann MartinKeil (zu „D.-A." XX. Nr. 3/4,
S. 48 bis 50). Keil scheint auch den Wunderthätcr
Pfarrer Gähner gekannt zu haben. In einem
(in „Briefen von I. C. Lav. und an ihn und
seine Freunde, Breiuen und Leipzig 1787", S.
128—130 veröffentlichten) Schreiben Lavnters
an Gaßner vom 3. Mai 1777 schreibt ersterer:
„Sie habe» also meinen l. Freund, einen Seher
Gottes und der Wahrheit gesehn? Es freut
mich mit jedem Augenblick mehr, und ich weis;
nicht, wie mir zu Muthe wird, wenn ich denke:
So lebt doch zu gleicher Zeit mit dir,
e i n M ann, der mit Krafft zeuget von
dem Leben Jesu, und einer von den Men-
schen, denen ich am meisten glauben darf, hat
mir bezeuget, daß er ist kein Gaukler, kein Be-
trogener, kein Betrüger! . . . ." Daß dieser Freund
und Seher Keil war, dafür spricht nachfolgende
mitgedruckte Bemerkung zu dem Briefe: „Dieser
Freund Lavaters war, wie man unten sieht, ein
gewißer K., von welchem damals L. ein gewal-
tiges Aufheben machte. In seiner Physiognomik
ließ er dessen Bildnis; in Kupfer stechen, mit
dem Beisatz: Ri an kann, was man will!
K. hat aber nichts gekonnt, oder nichts gewollt,
hat nichts Gescheidtes zu Wege gebracht, aber
viel extravagante Streiche gemacht. Er ist in
die Obscurität zurückgesunken, und soll jetzt irgend-
wo ein Herrenhuter sein." An einer späteren
Stelle des Briefes (a. a. O. S. 126) heißt es
noch: „. . . . Unser lieber K. hat mich Ihrer
Liebe gegen mich versichert. . . ." -eie.
Stuttgart, Buchdruckerei der Akt.-Ges. „Deutsche? Volksblatt".
auch ei» solcher Actus sei, der zwischen den
Mauern des Schlosses mithin ganz privatim ge-
schehe; da zumalen auch die Vortragung des
Kreuzes bei Leichenbegängnissen in gar vielen
cvangel. Landern üblich, und auch zwischen einen,
und sonderlich diesem im Schloss geschehenden
Leichenbegängnis; und einer förmlichen Proeession
gar ein großer Unterschied sei." Weil inan aber
deniungeachtet auf jener Bedingung beharrte, so
legte die Herzogin-We., sowohl bei dem Admini-
strator Herzog Karl Rudolph, als dem Geh.
Rath und dem .Hofmarschnllamt eine förmliche
Verwahrung ein. — Dem feierlichen Leichen-
begängnis; wohnte diesem nach die katholische
Geistlichkeit nicht bei, sondern sie verrichtete blos
bei dein fürstlichen Sarg in dem Parndezimmer
die nach den, katholischen Gebrauch üblichen Ritus
und gieng nach deren Vollendung durch das
Schloßgebnude in die fürstliche Kapelle, woselbst
sie den fürstlichen Sarg einpfieng und nach cin-
getretener Leichenbegleitung das okbcium cle-
lünctoram hielt. Auch wurde in dieser Kapelle
am 12. Mai eine Trauerpredigt und Hochamt
gehalten und dieses an den 2 folgenden Tagen
wiederholt, und in den letzten 4 Tagen von jedem
katholischen Geistlichen eine Seelen-Messe gelesen.
— Schon bei dieser Gelegenheit hatten sich die
Gesinnungen und der Geist veroffenbart, von
welcher diejenige Partei beseelt ward, die sich
kurz nach den, Tode Herzogs Karl Alexander der
Zügel der Regierung bemächtigt hatte.
-ck Die bischöflich CH ursche Herr-
schaft Großcngstilnlgen in Schwaben.
Bekanntlich führte früher — jetzt wohl nicht
mehr — der Bischof von Chur das Prädikat:
„Herr zu Großengstigen". Zu derselben gehörten
nach einem Churer Lehenbuche des 16. Jahr-
hunderts außer dem Dorf Großengstingen als
dem Mittelpunkt dieser H rrschaft und der Burg
L i chten st e i n ob Honau „och Undingen und
die guetter zu Meyttlstetten, zu Her-
p fi»gen,zuB ernloch, zuKo lstett, zuHeynoiv
(^Honau) underLiechtenstein und zuObernhau-
senn, und zu Und er Hausen in dem Hey-
n o wer tnl, und die gutter zu Pfullingen
und auch zu Melchinge n in denselben marckhen
allen» mit allen jrenn rechten und zugehörungen.
Die von dien Hausen Habens inn hendts und
enpfangen Anno 1588 jar am 6. Mai." Nach
einem (im 27. Jahresbericht der Graubündt-
uer hist.-nntig. Ges. veröffentlichten) Eintrags
eines alten Churer Urbares belehnte der Churer
Bischof Ulrich v. Lenzburg im Jahre 1345 (Dorn-
stag vor dem Pfingsttag) Herrn Hans v. Liech-
tenstein, „des erber» ritters Johansens Rau-
ens; sun von Liechtenstain mit dem kilchensatz
zu Hano" (— Honau). Im Jahre 1394 belehnte
Bischof .Hartmann von Chur (nach dem Churer
Lehenbuch) den frommen, vesten Ritter, Herrn
Hans v. Liechtenstain, Herrn Hansen (des
vorigen) sei. sun mit der Kirche zu Engstigeir
(Groß-E.), mit dem Dorf das. und aller zugehörd
(womit nuch zu vergleichen n. Oberamtsbeschreibuirg
von Reutlingen, I, S. 474, II, S. >90 ff.,
S. 352 -355). — Unter dem 3l. Oktober 1717
wurde diese Herrschaft u. a. wegen Entlegenheit
u s. iv. von Bischof und Domkapitel Chur um
90 000 fl. an das Kloster Zwiefalten O. 8.
Ilenecl. verkauft, wonach also die Wetterführung
des Prädikats: Herr zu Großengstigen seitens
des Bischofs von Chur keine Unterlage mehr hätte.
Z u.H er z o g K a r l s K lo st e r r e iss n („D.-A."
XX. S. 97—100). Als Kuriosität wäre noch nnch-
zutragen, daß der Herzog mit seiner Gemahlin
im Jahre 1786 auch noch kurz das Klarissinnen-
reichsstift Söflingen bei Ulm besuchte. Er
kam — entweder von Elchingen her oder auf
dem Wege dahin — um die Mitte Dezember
ins Nonnenkloster und wünschte dis Einrichtung
näher kennen zu lernen. Die Aebtissin Maria
Benedikta beschränkte die Erlaubnis zum Eintritt
zunächst auf die Herzogin Franziska; erst nach-
her gestattete sie, daß der Herzog mit seiner Ge-
mahlin von der Galerie aus einen Blick in den
Chor werfen durfte, wo sich ihnen die Aebtissin
mit einem güldenen Kreuz auf der Brust an der
Spitze ihrer bei Gebet knieenden Nonnen zeigte.
— Weiter wäre nachzutrngen, daß Prälat Ang-
e r n von Neresheim viel bei Herzog Karl g alt
und daß von da im Jahre 178.5 nuch der be-
kannte Schulmann 1'. Beda Pracher (geboren
zu Höllenstein 1750; ft 1819 in Rottenburg a N.)
durch den Herzog zur Einrichtung bezw. Reor-
ganisation der katholischen Norinalschulcn in
Württemberg nach Stuttgart berufen würde, -cd.
N o ch mals de r s ch w äbische Wunder-
mann MartinKeil (zu „D.-A." XX. Nr. 3/4,
S. 48 bis 50). Keil scheint auch den Wunderthätcr
Pfarrer Gähner gekannt zu haben. In einem
(in „Briefen von I. C. Lav. und an ihn und
seine Freunde, Breiuen und Leipzig 1787", S.
128—130 veröffentlichten) Schreiben Lavnters
an Gaßner vom 3. Mai 1777 schreibt ersterer:
„Sie habe» also meinen l. Freund, einen Seher
Gottes und der Wahrheit gesehn? Es freut
mich mit jedem Augenblick mehr, und ich weis;
nicht, wie mir zu Muthe wird, wenn ich denke:
So lebt doch zu gleicher Zeit mit dir,
e i n M ann, der mit Krafft zeuget von
dem Leben Jesu, und einer von den Men-
schen, denen ich am meisten glauben darf, hat
mir bezeuget, daß er ist kein Gaukler, kein Be-
trogener, kein Betrüger! . . . ." Daß dieser Freund
und Seher Keil war, dafür spricht nachfolgende
mitgedruckte Bemerkung zu dem Briefe: „Dieser
Freund Lavaters war, wie man unten sieht, ein
gewißer K., von welchem damals L. ein gewal-
tiges Aufheben machte. In seiner Physiognomik
ließ er dessen Bildnis; in Kupfer stechen, mit
dem Beisatz: Ri an kann, was man will!
K. hat aber nichts gekonnt, oder nichts gewollt,
hat nichts Gescheidtes zu Wege gebracht, aber
viel extravagante Streiche gemacht. Er ist in
die Obscurität zurückgesunken, und soll jetzt irgend-
wo ein Herrenhuter sein." An einer späteren
Stelle des Briefes (a. a. O. S. 126) heißt es
noch: „. . . . Unser lieber K. hat mich Ihrer
Liebe gegen mich versichert. . . ." -eie.
Stuttgart, Buchdruckerei der Akt.-Ges. „Deutsche? Volksblatt".