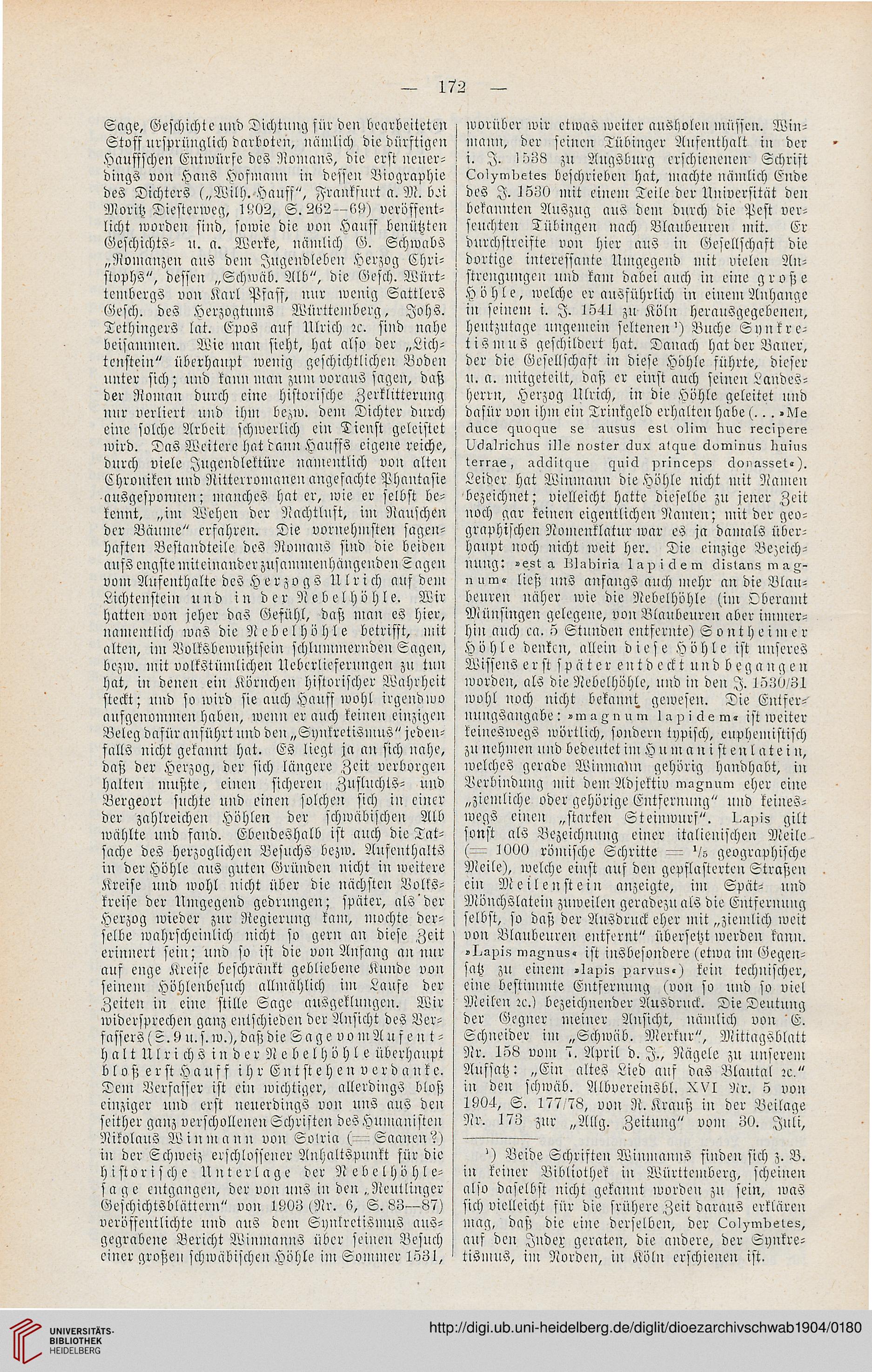— 1/
Sage. Geschichte und Dichtung für den bearbeiteten
Stoff ursprünglich darboten, nämlich die dürftigen
Hnnfssche» Entwürfe deS Romans, die erst neuer-
dings von Hans Hofmann in dessen Biographie
des Dichters („Wilh. Hauff", Frankfurt a, M, b.ü
Moritz Diesterweg, 1909, S. S62—l>9) veröffent-
licht worden find, sowie die von Hanfs benutzten
Geschichts- u, a. Werke, nämlich G. Schwabs
„Romanzen ans dem Jugendleben Herzog Chri-
stophs", dessen „Schwab. Alb", die Gesch. Würt-
tembergs von Karl Psass, nur wenig Sattlers
Gesch. des Herzogtnms Württemberg, Johs.
Tethingers lat. Epos ans Ulrich ?c. sind nahe
beisammen. Wie man sieht, hat also der „Lich-
tenstein" überhaupt wenig geschichtlichen Boden
unter sich; und kann man zum voraus sagen, daß
der Roman durch eine historische Zerklitternng
nur verliert und ihm bezw. dein Dichter durch
eine solche Arbeit schwerlich ein Tienst geleistet
wird. Das Weitere hat dann Hansss eigene reiche,
dnrch viele Jugendlektüre namentlich von alten
Chroniken und Nitterromanen angefachte Phantasie
nusgesponnen; manches hat er, wie er selbst be-
kennt, „im Wehen der Nachtluft, im Rauschen
der Bäume" erfahren. Die vornehmsten sagen-
haften Bestandteile des Romans sind die beiden
anss engste miteinander zusammenhangenden Z agen
vom Aufenthalte deS H e rzog s Ulri ch anf dein
Lichtenstein und in der Neb et höhle. Wir
hatten von jeher das Gefühl, daß man es hier,
namentlich was die Nebelhöhle betrifft, mit
alten, im Volksbewußtfein schlnmmernden Sagen,
bezw. mit volkstümlichen Ueberliefernngen zn tun
hat, in denen ein Körnchen historischer Wahrheit
steckt; und so wird sie anch Hanfs wohl irgendwo
aufgenommen haben, wenn er auch keinen einzigen
Beleg dafür anführt nnd den „Synkretismus" jeden-
falls nicht gekannt hat. Es liegt ja an sich nahe,
daß der Herzog, der sich längere Zeit verborgen
halten mußte, einen sicheren Zusluchts- und
Bergeort suchte und einen solchen sich in einer
der zahlreiche» Höhlen der schwäbischen Alb
wählte nnd fand. Ebendeshalb ist auch die Tat-
sache des herzoglichen Besuchs bezw. Aufenthalts
in der Höhle aus guten Gründen nicht in weitere
Kreise und wohl nicht über die nächsten Bolks-
kreise der Umgegend gedrungen; später, als'der I
Herzog wieder zur Regierung kam, mochte der-
selbe wahrscheinlich nicht so gern an diese Zeit
erinnert sein; und so ist die von Ansang an mir
ans enge Kreise beschränkt gebliebene Kunde von
seinem Hö.hlenbesuch allmählich im Laufe der
Zeiten in eine stille Sage ausgeklnngen. Wir
widersprechen ganz entschieden der Ansicht des Ver-
fassers (L. 9 n.s. w.), daß die Sa g e vo mA us e » t -
halt Ulrichs inder Nebelhöhle überhaupt
bloß erst Hauff ihr Entstehen verdanke.
Dem Verfasser ist ein wichtiger, allerdings bloß
einziger nnd erst neuerdings von nns ans den
seither ganz verschollenen Schriften des Humanisten
Nikolaus Winmann von Solria ( Saanen?)
in der Schweiz erschlossener Anhaltspunkt für die
historische Unterlage der Nebelhöhle-
sage entgangen, der von uns in den „Reutlinger
Geschichtsblättern" von 1903 (Nr. 6, S. 83—87)
veröffentlichte uud aus dem Synlretismns aus-
gegrabene Bericht Winmanns über feinen Besuch
einer großen schwäbischen Höhle im Sommer 1331,
worüber wir etwas weiter ausholen müsse». Win-
mann, der seinen Tübinger Aufenthalt in der
i. I. 1538 zn Augsburg erschienenen' Schrift
Lnl^mdeles beschriebe» hat, »lachte nämlich Ende
des I. 1530 mit einem Teile der Universität den
bekannten Auszug aus dem durch die Pest ver-
seuchten Tübingen nach Blaubeuren mit. Er
durchstreifte von hier aus in Gesellschaft die
dortige interessante Umgegend mit vielen An-
strengungen nnd kam dabei auch in eine große
Höhle, welche er ausführlich i» eine»! Anhange
in feine»! i. I. 1541 zu Köln Heransgegebene»,
heutzutage nngemein seltenen') Buche Synkre-
tismus geschildert hat. Danach Haider Bauer,
der die Gesellschaft in diese Höhle führte, dieser
u. a. mitgeteilt, daß er einst anch seinen Laiides-
Herrn, Herzog Ulrich, in die Höhle geleitet nnd
dafür von ihm ein Trinkgeld erhalte» habe (... -Ns
cluce ss Ausus est. olim linc reeipers
!!Is noster 6ux alc^us cloinlnus liuius
terrss, aäclitHue <zu!6 pr!nce^>s 6»>iasset-).
Leider hat Winmann die Höhle nicht mit Namen
bezeichnet; vielleicht hatte dieselbe z» jener Zeit
noch gar keinen eigentlichen Namen; mit der geo-
graphischen Nomenklatur war es ja damals über-
haupt noch nicht weit her. Die einzige Bezeich-
nung: -est lU^kiria 1 Ä p i cl e m clisians m k
n um- ließ uns anfangs auch mehr an die Blau-
benren näher wie die Nebelhöhle (im Obernmt
Mü»fingen gelegene, vo» Blanbeuren aber immer-
hin anch ca. 5 Stunden entfernte) Sontheimer
Höhle denkcn, allein diese Höhle ist nnseres
Wissens er st sp ä t er e»td e ckt u » d b eg a ng e »
worden, als die Nebelhöhle, nnd in de» A 1530/31
wohl noch nicht bekannt, gewesen. Die Entser-
nnngsangabe: -m a g n u m I » p > cie m- ist weiter
keineswegs wörtlich, sondern typisch, euphemistisch
zn nehme» nnd bedeutet im Hu manistenlatei n,
welches gerade Winmawi gehörig handhabt, in
Verbindung mit dem Adjektiv ma^num eher eine
„ziemliche oder gehörige Entfernung" uud keines-
wegs einen „starken Steinwnrf". I^apis gilt
sonst als Bezeichnung einer italienischen Meile
(^ 1000 römische Schritte ^ '/s geographische
Meile), welche einst auf deu gepflasterten Straßen
ein Vi eil enst ein anzeigte, im Spät- und
I Mönchslatein zuweilen geradezu als die Eutferuuug
selbst, so daß der Ausdruck eher mit „ziemlich weit
von Blaubeuren entfernt" übersetzt werden kann.
Magnus, ist insbesondere (etwa im Gegen-
satz zu einem -lupis p»rv>is.) kein technischer,
eine bestimmte Entsernung (von so nnd so viel
Meilen !e.) bezeichnender Ausdruck. Die Deutung
der Gegner meiner Ansicht, nämlich von 'E.
Schneider im „Schwab. Merknr", Miktagsblatt
Nr. 158 vom 7. April d. I., Nägele zu unserem
Aussatz: „Em altes Lied auf das Blautal -e,"
in de» schivab. Albvereinsbl. XVI Nr. 5 von
1904, S. 177 78, von R. Kraus; in der Beilage
Nr. 173 zur „Allg. Zeitung" vom 30. Juli,
') Beide Schriften Winmanns finden sich z. B.
i» keiner Bibliothek i» Württemberg, scheinen
also daselbst nicht gekannt worden zn sein, was
sich vielleicht für die frühere Zeit darans erklären
mag, daß die eine derselben, der Lol^mdeles,
anf de» Index geraten, die andere, der Synkre-
tismus, im Norde», in Köln erschienen ist.
Sage. Geschichte und Dichtung für den bearbeiteten
Stoff ursprünglich darboten, nämlich die dürftigen
Hnnfssche» Entwürfe deS Romans, die erst neuer-
dings von Hans Hofmann in dessen Biographie
des Dichters („Wilh. Hauff", Frankfurt a, M, b.ü
Moritz Diesterweg, 1909, S. S62—l>9) veröffent-
licht worden find, sowie die von Hanfs benutzten
Geschichts- u, a. Werke, nämlich G. Schwabs
„Romanzen ans dem Jugendleben Herzog Chri-
stophs", dessen „Schwab. Alb", die Gesch. Würt-
tembergs von Karl Psass, nur wenig Sattlers
Gesch. des Herzogtnms Württemberg, Johs.
Tethingers lat. Epos ans Ulrich ?c. sind nahe
beisammen. Wie man sieht, hat also der „Lich-
tenstein" überhaupt wenig geschichtlichen Boden
unter sich; und kann man zum voraus sagen, daß
der Roman durch eine historische Zerklitternng
nur verliert und ihm bezw. dein Dichter durch
eine solche Arbeit schwerlich ein Tienst geleistet
wird. Das Weitere hat dann Hansss eigene reiche,
dnrch viele Jugendlektüre namentlich von alten
Chroniken und Nitterromanen angefachte Phantasie
nusgesponnen; manches hat er, wie er selbst be-
kennt, „im Wehen der Nachtluft, im Rauschen
der Bäume" erfahren. Die vornehmsten sagen-
haften Bestandteile des Romans sind die beiden
anss engste miteinander zusammenhangenden Z agen
vom Aufenthalte deS H e rzog s Ulri ch anf dein
Lichtenstein und in der Neb et höhle. Wir
hatten von jeher das Gefühl, daß man es hier,
namentlich was die Nebelhöhle betrifft, mit
alten, im Volksbewußtfein schlnmmernden Sagen,
bezw. mit volkstümlichen Ueberliefernngen zn tun
hat, in denen ein Körnchen historischer Wahrheit
steckt; und so wird sie anch Hanfs wohl irgendwo
aufgenommen haben, wenn er auch keinen einzigen
Beleg dafür anführt nnd den „Synkretismus" jeden-
falls nicht gekannt hat. Es liegt ja an sich nahe,
daß der Herzog, der sich längere Zeit verborgen
halten mußte, einen sicheren Zusluchts- und
Bergeort suchte und einen solchen sich in einer
der zahlreiche» Höhlen der schwäbischen Alb
wählte nnd fand. Ebendeshalb ist auch die Tat-
sache des herzoglichen Besuchs bezw. Aufenthalts
in der Höhle aus guten Gründen nicht in weitere
Kreise und wohl nicht über die nächsten Bolks-
kreise der Umgegend gedrungen; später, als'der I
Herzog wieder zur Regierung kam, mochte der-
selbe wahrscheinlich nicht so gern an diese Zeit
erinnert sein; und so ist die von Ansang an mir
ans enge Kreise beschränkt gebliebene Kunde von
seinem Hö.hlenbesuch allmählich im Laufe der
Zeiten in eine stille Sage ausgeklnngen. Wir
widersprechen ganz entschieden der Ansicht des Ver-
fassers (L. 9 n.s. w.), daß die Sa g e vo mA us e » t -
halt Ulrichs inder Nebelhöhle überhaupt
bloß erst Hauff ihr Entstehen verdanke.
Dem Verfasser ist ein wichtiger, allerdings bloß
einziger nnd erst neuerdings von nns ans den
seither ganz verschollenen Schriften des Humanisten
Nikolaus Winmann von Solria ( Saanen?)
in der Schweiz erschlossener Anhaltspunkt für die
historische Unterlage der Nebelhöhle-
sage entgangen, der von uns in den „Reutlinger
Geschichtsblättern" von 1903 (Nr. 6, S. 83—87)
veröffentlichte uud aus dem Synlretismns aus-
gegrabene Bericht Winmanns über feinen Besuch
einer großen schwäbischen Höhle im Sommer 1331,
worüber wir etwas weiter ausholen müsse». Win-
mann, der seinen Tübinger Aufenthalt in der
i. I. 1538 zn Augsburg erschienenen' Schrift
Lnl^mdeles beschriebe» hat, »lachte nämlich Ende
des I. 1530 mit einem Teile der Universität den
bekannten Auszug aus dem durch die Pest ver-
seuchten Tübingen nach Blaubeuren mit. Er
durchstreifte von hier aus in Gesellschaft die
dortige interessante Umgegend mit vielen An-
strengungen nnd kam dabei auch in eine große
Höhle, welche er ausführlich i» eine»! Anhange
in feine»! i. I. 1541 zu Köln Heransgegebene»,
heutzutage nngemein seltenen') Buche Synkre-
tismus geschildert hat. Danach Haider Bauer,
der die Gesellschaft in diese Höhle führte, dieser
u. a. mitgeteilt, daß er einst anch seinen Laiides-
Herrn, Herzog Ulrich, in die Höhle geleitet nnd
dafür von ihm ein Trinkgeld erhalte» habe (... -Ns
cluce ss Ausus est. olim linc reeipers
!!Is noster 6ux alc^us cloinlnus liuius
terrss, aäclitHue <zu!6 pr!nce^>s 6»>iasset-).
Leider hat Winmann die Höhle nicht mit Namen
bezeichnet; vielleicht hatte dieselbe z» jener Zeit
noch gar keinen eigentlichen Namen; mit der geo-
graphischen Nomenklatur war es ja damals über-
haupt noch nicht weit her. Die einzige Bezeich-
nung: -est lU^kiria 1 Ä p i cl e m clisians m k
n um- ließ uns anfangs auch mehr an die Blau-
benren näher wie die Nebelhöhle (im Obernmt
Mü»fingen gelegene, vo» Blanbeuren aber immer-
hin anch ca. 5 Stunden entfernte) Sontheimer
Höhle denkcn, allein diese Höhle ist nnseres
Wissens er st sp ä t er e»td e ckt u » d b eg a ng e »
worden, als die Nebelhöhle, nnd in de» A 1530/31
wohl noch nicht bekannt, gewesen. Die Entser-
nnngsangabe: -m a g n u m I » p > cie m- ist weiter
keineswegs wörtlich, sondern typisch, euphemistisch
zn nehme» nnd bedeutet im Hu manistenlatei n,
welches gerade Winmawi gehörig handhabt, in
Verbindung mit dem Adjektiv ma^num eher eine
„ziemliche oder gehörige Entfernung" uud keines-
wegs einen „starken Steinwnrf". I^apis gilt
sonst als Bezeichnung einer italienischen Meile
(^ 1000 römische Schritte ^ '/s geographische
Meile), welche einst auf deu gepflasterten Straßen
ein Vi eil enst ein anzeigte, im Spät- und
I Mönchslatein zuweilen geradezu als die Eutferuuug
selbst, so daß der Ausdruck eher mit „ziemlich weit
von Blaubeuren entfernt" übersetzt werden kann.
Magnus, ist insbesondere (etwa im Gegen-
satz zu einem -lupis p»rv>is.) kein technischer,
eine bestimmte Entsernung (von so nnd so viel
Meilen !e.) bezeichnender Ausdruck. Die Deutung
der Gegner meiner Ansicht, nämlich von 'E.
Schneider im „Schwab. Merknr", Miktagsblatt
Nr. 158 vom 7. April d. I., Nägele zu unserem
Aussatz: „Em altes Lied auf das Blautal -e,"
in de» schivab. Albvereinsbl. XVI Nr. 5 von
1904, S. 177 78, von R. Kraus; in der Beilage
Nr. 173 zur „Allg. Zeitung" vom 30. Juli,
') Beide Schriften Winmanns finden sich z. B.
i» keiner Bibliothek i» Württemberg, scheinen
also daselbst nicht gekannt worden zn sein, was
sich vielleicht für die frühere Zeit darans erklären
mag, daß die eine derselben, der Lol^mdeles,
anf de» Index geraten, die andere, der Synkre-
tismus, im Norde», in Köln erschienen ist.