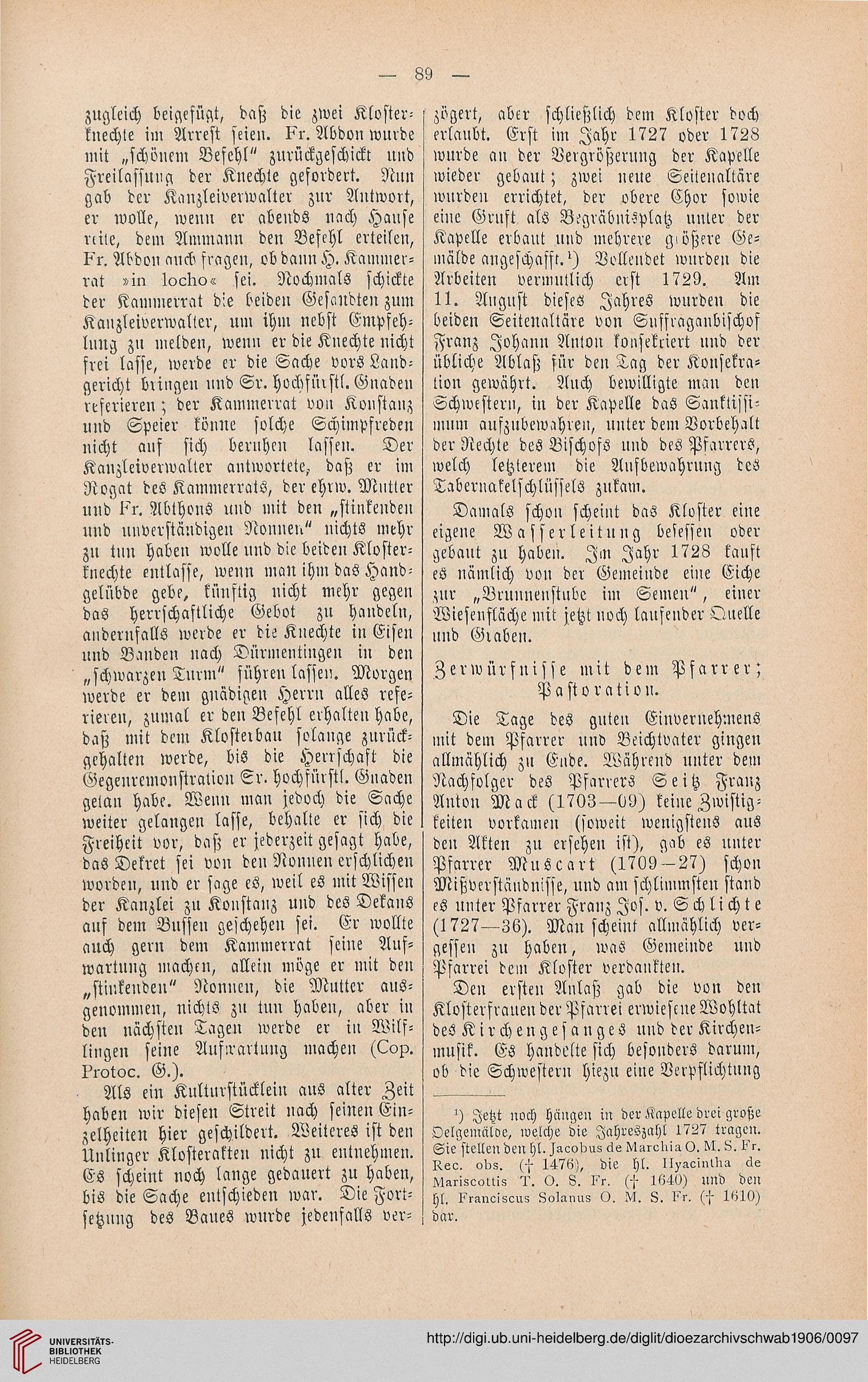89
zugleich beigefügt, daß die zwei Kloster-
knechle im Arrest seien, kr. Abdon wurde
mit „schönem Befehl" zurückgeschickt und
Freilassung der Knechte gefordert. Nun
gab der Kanzleioerwalter zur Antwort,
er wolle, wenn er abends nach Hause
reite, dem Ammann den Befehl erteilen,
kr. Abdon aneb fragen, ob dann H. Kammer-
rat »in loclro« sei. Nochmals schickte
der Kammerrat die beiden Gesandten zum
Kanzleiverwalter, um ihm nebst Empfeh-
lung zu melden, wenn er die Knechte nicht
frei lasse, werde er die Sache vors Land-
gericht bringen nnd Sr. hochfürstl. Gnaden
referieren; der Kammerrat von Konstanz
und Spcier könne solche Schimpfreden
nicht auf sich beruhen lassen. Der
Kanzleiverwalter antwortete, daß er im
Nogat des Kammerrats, der ehrw. Mutter
und kr. Abthons und mit den „stinkenden
und unverständigen Nonnen" nichts mehr
zu tun haben wolle und die beiden Kloster-
knechte entlasse, wenn man ihm das Hand-
gelübde gebe, künftig nicht mehr gegen
das herrschaftliche Gebot zu handeln,
andernfalls werde er die Knechte in Eisen
und Banden nach Dürmentingen in den
„schwarzen Turm" führen lassen. Morgen
werde er dem gnädigen Herrn alles refe-
rieren, zumal er den Befehl erhalten habe,
daß mit dem Klosteibau solange zurück-
gehalten werde, bis die Herrschaft die
Gegenremoustration Sr. hochfürstl. Gnaden
getan habe. Wenn man jedoch die Sache
weiter gelangen lasse, behalte er sich die
Freiheit vor, daß er jederzeit gesagt habe,
das Dekret sei von den Nonnen erschlichen
worden, und er sage es, weil es mit Wissen
der Kanzlei zu Konstanz und des Dekans
ans dem Bussen geschehen sei. Er wollte
auch gern dem Kammerrat seine Auf-
wartung machen, allein möge er mit den
„stinkenden" Nonnen, die Mutter aus-
genommen, nichts zu tun haben, aber in
den nächsten Tagen werde er in Wilf-
lingen seine Aufwartung machen (Lop.
krotoc. G-).
Als ein Kultnrstücklein ans alter Zeit
haben wir diesen Streit nach seinen Ein-
zelheiten hier geschildert. Weiteres ist den
Unlinger Klosterakten nicht zu entnehmen.
Es scheint noch lange gedauert zu haben,
bis die Sache entschieden war. Die Fort-
setzung des Baues wurde jedenfalls ver-
zögert, aber schließlich dem Kloster doch
erlaubt. Erst im Jahr 1727 oder 1728
wurde an der Vergrößerung der Kapelle
wieder gebaut; zwei neue Seitenaltäre
wurden errichtet, der obere Chor sowie
eine Gruft als Begräbnisplatz unter der
Kapelle erbaut nnd mehrere größere Ge-
mälde angeschafst?) Vollendet wurden die
Arbeiten vermutlich erst 1729. Am
11. August dieses Jahres wurden die
beiden Seitenaltäre von Snffraganbischof
Franz Johann Anton koasekciert und der
übliche Ablaß für den Tag der Konsekra-
tion gewährt. Auch bewilligte man den
-Schwester», in der Kapelle das Sanktissi-
mum aufznbewahren, unter dem Vorbehalt
der Rechte des Bischofs und des Pfarrers,
welch letzterem die Aufbewahrung des
Tabernakelschlüssels zukam.
Damals schon scheint das Kloster eine
eigene Wasserleitung besessen oder
gebaut zu haben. Im Jahr 1728 kauft
eö nämlich von der Gemeinde eine Eiche
zur „Vrunnenstube im Semen", einer
Wiesenfläche mit jetzt noch laufender Quelle
und Graben.
Zerwürfnisse mit dem Pfarrer;
Pastoratio».
Die Tage des guten Einvernehmens
mit dem Pfarrer nnd Beichtvater gingen
allmählich zu Ende. Während unter dem
Nachfolger des Pfarrers Seitz Franz
Anton Mack (1703-09) keine Zwistig-
keiten vorkamen (soweit wenigstens aus
den Akten zu ersehen ist), gab es unter
Pfarrer Muscart (1709 -27) schon
Mißverständnisse, und am schlimmsten stand
es unter Pfarrer Franz Jos. v. Schlichte
(1727—36). Man scheint allmählich ver-
gessen zu haben, was Gemeinde und
Pfarrei dem Kloster verdankten.
Den ersten Anlaß gab die von den
Klosterfrauen der Pfarrei erwiesene Wohltat
des Kirchengesanges und der Kirchen-
musik. Es handelte sich besonders darum,
ob die Schwestern hiezu eine Verpflichtung
0 Jetzt noch hängen in der Kapelle drei große
Oelgemäloe, welche die Jahreszahl 1727 tragen.
Sie stellen den hl. gacodus 6« Narelna 0. Ü4. 8. 1>.
Ivec. ods. 1476), die hl. IlxacnUlia cle
IVlariscottis 1'. o. 8. 1'r. lch 1640) nnd den
hl. I'ranclscus 8olanas O. !VI. 8. I'r. 1610)
dar.
zugleich beigefügt, daß die zwei Kloster-
knechle im Arrest seien, kr. Abdon wurde
mit „schönem Befehl" zurückgeschickt und
Freilassung der Knechte gefordert. Nun
gab der Kanzleioerwalter zur Antwort,
er wolle, wenn er abends nach Hause
reite, dem Ammann den Befehl erteilen,
kr. Abdon aneb fragen, ob dann H. Kammer-
rat »in loclro« sei. Nochmals schickte
der Kammerrat die beiden Gesandten zum
Kanzleiverwalter, um ihm nebst Empfeh-
lung zu melden, wenn er die Knechte nicht
frei lasse, werde er die Sache vors Land-
gericht bringen nnd Sr. hochfürstl. Gnaden
referieren; der Kammerrat von Konstanz
und Spcier könne solche Schimpfreden
nicht auf sich beruhen lassen. Der
Kanzleiverwalter antwortete, daß er im
Nogat des Kammerrats, der ehrw. Mutter
und kr. Abthons und mit den „stinkenden
und unverständigen Nonnen" nichts mehr
zu tun haben wolle und die beiden Kloster-
knechte entlasse, wenn man ihm das Hand-
gelübde gebe, künftig nicht mehr gegen
das herrschaftliche Gebot zu handeln,
andernfalls werde er die Knechte in Eisen
und Banden nach Dürmentingen in den
„schwarzen Turm" führen lassen. Morgen
werde er dem gnädigen Herrn alles refe-
rieren, zumal er den Befehl erhalten habe,
daß mit dem Klosteibau solange zurück-
gehalten werde, bis die Herrschaft die
Gegenremoustration Sr. hochfürstl. Gnaden
getan habe. Wenn man jedoch die Sache
weiter gelangen lasse, behalte er sich die
Freiheit vor, daß er jederzeit gesagt habe,
das Dekret sei von den Nonnen erschlichen
worden, und er sage es, weil es mit Wissen
der Kanzlei zu Konstanz und des Dekans
ans dem Bussen geschehen sei. Er wollte
auch gern dem Kammerrat seine Auf-
wartung machen, allein möge er mit den
„stinkenden" Nonnen, die Mutter aus-
genommen, nichts zu tun haben, aber in
den nächsten Tagen werde er in Wilf-
lingen seine Aufwartung machen (Lop.
krotoc. G-).
Als ein Kultnrstücklein ans alter Zeit
haben wir diesen Streit nach seinen Ein-
zelheiten hier geschildert. Weiteres ist den
Unlinger Klosterakten nicht zu entnehmen.
Es scheint noch lange gedauert zu haben,
bis die Sache entschieden war. Die Fort-
setzung des Baues wurde jedenfalls ver-
zögert, aber schließlich dem Kloster doch
erlaubt. Erst im Jahr 1727 oder 1728
wurde an der Vergrößerung der Kapelle
wieder gebaut; zwei neue Seitenaltäre
wurden errichtet, der obere Chor sowie
eine Gruft als Begräbnisplatz unter der
Kapelle erbaut nnd mehrere größere Ge-
mälde angeschafst?) Vollendet wurden die
Arbeiten vermutlich erst 1729. Am
11. August dieses Jahres wurden die
beiden Seitenaltäre von Snffraganbischof
Franz Johann Anton koasekciert und der
übliche Ablaß für den Tag der Konsekra-
tion gewährt. Auch bewilligte man den
-Schwester», in der Kapelle das Sanktissi-
mum aufznbewahren, unter dem Vorbehalt
der Rechte des Bischofs und des Pfarrers,
welch letzterem die Aufbewahrung des
Tabernakelschlüssels zukam.
Damals schon scheint das Kloster eine
eigene Wasserleitung besessen oder
gebaut zu haben. Im Jahr 1728 kauft
eö nämlich von der Gemeinde eine Eiche
zur „Vrunnenstube im Semen", einer
Wiesenfläche mit jetzt noch laufender Quelle
und Graben.
Zerwürfnisse mit dem Pfarrer;
Pastoratio».
Die Tage des guten Einvernehmens
mit dem Pfarrer nnd Beichtvater gingen
allmählich zu Ende. Während unter dem
Nachfolger des Pfarrers Seitz Franz
Anton Mack (1703-09) keine Zwistig-
keiten vorkamen (soweit wenigstens aus
den Akten zu ersehen ist), gab es unter
Pfarrer Muscart (1709 -27) schon
Mißverständnisse, und am schlimmsten stand
es unter Pfarrer Franz Jos. v. Schlichte
(1727—36). Man scheint allmählich ver-
gessen zu haben, was Gemeinde und
Pfarrei dem Kloster verdankten.
Den ersten Anlaß gab die von den
Klosterfrauen der Pfarrei erwiesene Wohltat
des Kirchengesanges und der Kirchen-
musik. Es handelte sich besonders darum,
ob die Schwestern hiezu eine Verpflichtung
0 Jetzt noch hängen in der Kapelle drei große
Oelgemäloe, welche die Jahreszahl 1727 tragen.
Sie stellen den hl. gacodus 6« Narelna 0. Ü4. 8. 1>.
Ivec. ods. 1476), die hl. IlxacnUlia cle
IVlariscottis 1'. o. 8. 1'r. lch 1640) nnd den
hl. I'ranclscus 8olanas O. !VI. 8. I'r. 1610)
dar.