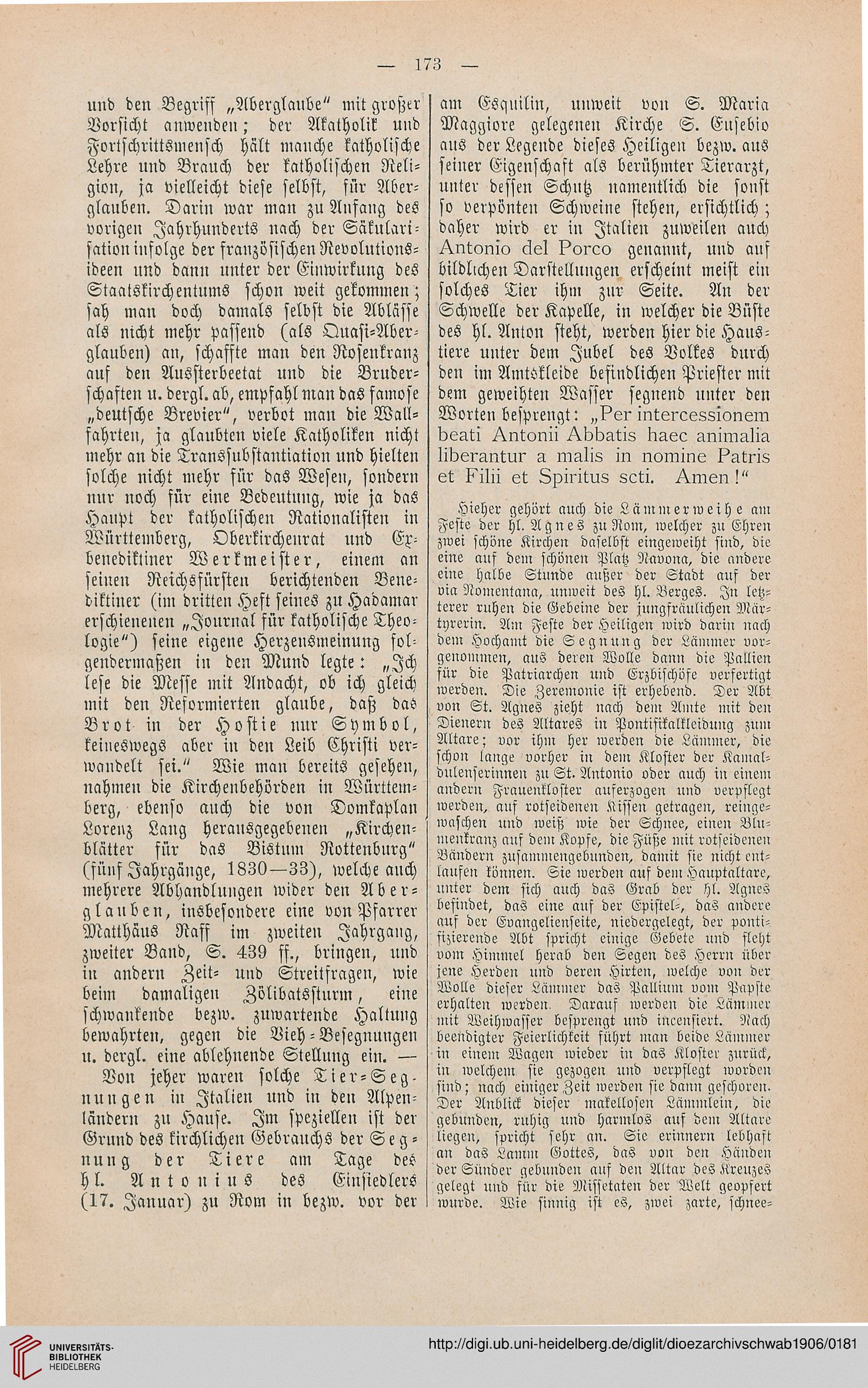173
und den Begriff „Aberglaube" mit großer
Vorsicht anwendeu; der Akatholik und
Fortschrittsmensch hält manche katholische
Lehre und Brauch der katholischen Reli-
gion, ja vielleicht diese selbst, für Aber-
glauben. Darin war mau zu Anfang des
vorigen Jahrhunderts nach der Säkulari-
sation infolge der französischen Nevolutions-
ideen und dann unter der Einwirkung des
Staatskirchentums schon weit gekommen ;
sah mau doch damals selbst die Ablässe
als nicht mehr passend (als Quasi-Aber-
glanben) an, schaffte man den Rosenkranz
auf den Aussterbeetat und die Bruder-
schaften u. dergl. ab, empfahl man das famose
„deutsche Brevier", verbot mau die Wall-
fahrten, ja glaubten viele Katholiken nicht
mehr an die TranSsubstantiation und hielten
solche nicht mehr für das Wesen, sondern
mir noch für eine Bedeutung, wie ja das
Hanpt der katholischen Nationalisten in
Württemberg, Oberkirchenrat und Ex-
benedikliner Werkmeister, einem an
seinen Reichsfürsten berichtenden Bene-
diktiner (im dritten Heft seines zu Hadamar
erschienenen „Journal für katholische Theo-
logie") seine eigene Herzensmeinung fol-
gendermaßen in den Mund legte: „Ich
lese die Messe mit Andacht, ob ich gleich
mit den Reformierten glaube, daß das
Brot in der Hostie nur Symbol,
keineswegs aber in den Leib Christi ver-
wandelt sei." Wie man bereits gesehen,
nahmen die Kirchenbehörden in Württem-
berg, ebenso auch die von Domkaplan
Lorenz Lang heransgegebenen „Kirchen-
blätter für das Bistum Nottenbnrg"
(fünf Jahrgänge, 1830—33), welche auch
mehrere Abhandlungen wider den Aber-
glauben, insbesondere eine von Pfarrer
Matthäus Raff im zweiten Jahrgang,
zweiter Band, S. 439 ff., bringen, und
in andern Zeit- und Streitfragen, wie
beim damaligen Zölibatssturm, eine
schwankende bezw. zuwartende Haltung
bewahrten, gegen die Vieh-Besegnungen
u. dergl. eine ablehnende Stellung ein. —
Von jeher waren solche Tier-Seg-
nungen in Italien und in den Alpen-
ländern zu Hause. Im speziellen ist der
Grund des kirchlichen Gebrauchs derSeg -
nung der Tiere am Tage des
hl. Antonius des Einsiedlers
(17. Januar) zu Rom in bezw. vor der
am Esquilin, unweit von S. Maria
Maggiore gelegenen Kirche S. Ensebio
aus der Legende dieses Heiligen bezw. aus
seiner Eigenschaft als berühmter Tierarzt,
unter dessen Schutz namentlich die sonst
so verpönten Schweine stehen, ersichtlich;
daher wird er in Italien zuweilen auch
Antonio 6el ?oroo genannt, und auf
bildlichen Darstellungen erscheint meist ein
solches Tier ihm zur Seite. An der
Schwelle der Kapelle, in welcher die Büste
des hl. Anton steht, werden hier die Haus-
tiere unter dem Jubel des Volkes durch
den im Amtskleide befindlichen Priester mit
dem geweihten Wasser segnend unter den
Worten besprengt: „?en intercessionem
beuti J,ntonü /rbbutiZ kuec uirimuliu
liberuntrin u mulig in nomine ?uti'i8
et imln et Lpiritus seti. /tmen!"
Hieher gehört mich die Lämmerweihe am
Feste der hl. Agnes zu Rom, welcher zu Ehren
zwei schöne Kirchen daselbst eingeweiht sind, die
eine auf dem schönen Platz Navona, die andere
eine halbe Stunde außer der Stadt auf der
via Nomentana, unweit des hl. Berges. In letz-
terer ruhen die Gebeine der jungfräulichen Mär-
tyrerin. Am Feste der Heiligen wird darin nach
dem Hochamt die Segnung der Lämmer vor-
genommen, aus deren Wolle dann die Pallien
für die Patriarchen und Erzbischöfe verfertigt
werden. Dis Zeremonie ist erhebend. Der Abt
von St. Agnes zieht nach dem Amte mit den
Dienern des Altares in Pontifikalkleidung zum
Altäre; vor ihm her werden die Lämmer, die
schon lange vorher in dem Kloster der Kauial-
dulenserinnen zu St. Antonio oder auch in einem
andern Frauenkloster auferzogen und verpflegt
werden, auf rotseidenen Kissen getragen, reinge-
waschen und weiß wie der Schnee, einen Blu-
menkranz auf dem Kopfe, die Füße mit rotseidenen
Bändern zusammengebunden, damit sie nicht ent-
laufen können. Sie werden auf de», Hauptaltnre,
unter dem sich auch das Grab der hl. Agnes
befindet, das eine auf der Epistel-, das andere
auf der Evangelienseite, niedergelegt, der ponti-
fizierende Abt spricht einige Gebete und fleht
vom Himmel herab den Segen des Herrn über
jene Herden und deren Hirten, welche von der
Wolle dieser Lämmer das Pallium von, Papste
erhalten werden. Darauf werden die Lämmer
mit Weihwasser besprengt und incensiert. Nach
beendigter Feierlichkeit führt man beide Lämmer
in einem Wagen wieder in das Kloster zurück,
in welche», sie gezogen und verpflegt worden
sind; nach einiger Zeit werden sie dann geschoren.
Der Anblick dieser makellosen Lämmlein, die
gebunden, ruhig und harmlos auf de», Altäre
liegen, spricht sehr an. Sie erinnern lebhaft
an das Lamm Gottes, das von den Händen
der Sünder gebunden auf den Altar des Kreuzes
gelegt und für die Missetaten der Welt geopfert
wurde. Wie sinnig ist es, zwei zarte, schriee-
und den Begriff „Aberglaube" mit großer
Vorsicht anwendeu; der Akatholik und
Fortschrittsmensch hält manche katholische
Lehre und Brauch der katholischen Reli-
gion, ja vielleicht diese selbst, für Aber-
glauben. Darin war mau zu Anfang des
vorigen Jahrhunderts nach der Säkulari-
sation infolge der französischen Nevolutions-
ideen und dann unter der Einwirkung des
Staatskirchentums schon weit gekommen ;
sah mau doch damals selbst die Ablässe
als nicht mehr passend (als Quasi-Aber-
glanben) an, schaffte man den Rosenkranz
auf den Aussterbeetat und die Bruder-
schaften u. dergl. ab, empfahl man das famose
„deutsche Brevier", verbot mau die Wall-
fahrten, ja glaubten viele Katholiken nicht
mehr an die TranSsubstantiation und hielten
solche nicht mehr für das Wesen, sondern
mir noch für eine Bedeutung, wie ja das
Hanpt der katholischen Nationalisten in
Württemberg, Oberkirchenrat und Ex-
benedikliner Werkmeister, einem an
seinen Reichsfürsten berichtenden Bene-
diktiner (im dritten Heft seines zu Hadamar
erschienenen „Journal für katholische Theo-
logie") seine eigene Herzensmeinung fol-
gendermaßen in den Mund legte: „Ich
lese die Messe mit Andacht, ob ich gleich
mit den Reformierten glaube, daß das
Brot in der Hostie nur Symbol,
keineswegs aber in den Leib Christi ver-
wandelt sei." Wie man bereits gesehen,
nahmen die Kirchenbehörden in Württem-
berg, ebenso auch die von Domkaplan
Lorenz Lang heransgegebenen „Kirchen-
blätter für das Bistum Nottenbnrg"
(fünf Jahrgänge, 1830—33), welche auch
mehrere Abhandlungen wider den Aber-
glauben, insbesondere eine von Pfarrer
Matthäus Raff im zweiten Jahrgang,
zweiter Band, S. 439 ff., bringen, und
in andern Zeit- und Streitfragen, wie
beim damaligen Zölibatssturm, eine
schwankende bezw. zuwartende Haltung
bewahrten, gegen die Vieh-Besegnungen
u. dergl. eine ablehnende Stellung ein. —
Von jeher waren solche Tier-Seg-
nungen in Italien und in den Alpen-
ländern zu Hause. Im speziellen ist der
Grund des kirchlichen Gebrauchs derSeg -
nung der Tiere am Tage des
hl. Antonius des Einsiedlers
(17. Januar) zu Rom in bezw. vor der
am Esquilin, unweit von S. Maria
Maggiore gelegenen Kirche S. Ensebio
aus der Legende dieses Heiligen bezw. aus
seiner Eigenschaft als berühmter Tierarzt,
unter dessen Schutz namentlich die sonst
so verpönten Schweine stehen, ersichtlich;
daher wird er in Italien zuweilen auch
Antonio 6el ?oroo genannt, und auf
bildlichen Darstellungen erscheint meist ein
solches Tier ihm zur Seite. An der
Schwelle der Kapelle, in welcher die Büste
des hl. Anton steht, werden hier die Haus-
tiere unter dem Jubel des Volkes durch
den im Amtskleide befindlichen Priester mit
dem geweihten Wasser segnend unter den
Worten besprengt: „?en intercessionem
beuti J,ntonü /rbbutiZ kuec uirimuliu
liberuntrin u mulig in nomine ?uti'i8
et imln et Lpiritus seti. /tmen!"
Hieher gehört mich die Lämmerweihe am
Feste der hl. Agnes zu Rom, welcher zu Ehren
zwei schöne Kirchen daselbst eingeweiht sind, die
eine auf dem schönen Platz Navona, die andere
eine halbe Stunde außer der Stadt auf der
via Nomentana, unweit des hl. Berges. In letz-
terer ruhen die Gebeine der jungfräulichen Mär-
tyrerin. Am Feste der Heiligen wird darin nach
dem Hochamt die Segnung der Lämmer vor-
genommen, aus deren Wolle dann die Pallien
für die Patriarchen und Erzbischöfe verfertigt
werden. Dis Zeremonie ist erhebend. Der Abt
von St. Agnes zieht nach dem Amte mit den
Dienern des Altares in Pontifikalkleidung zum
Altäre; vor ihm her werden die Lämmer, die
schon lange vorher in dem Kloster der Kauial-
dulenserinnen zu St. Antonio oder auch in einem
andern Frauenkloster auferzogen und verpflegt
werden, auf rotseidenen Kissen getragen, reinge-
waschen und weiß wie der Schnee, einen Blu-
menkranz auf dem Kopfe, die Füße mit rotseidenen
Bändern zusammengebunden, damit sie nicht ent-
laufen können. Sie werden auf de», Hauptaltnre,
unter dem sich auch das Grab der hl. Agnes
befindet, das eine auf der Epistel-, das andere
auf der Evangelienseite, niedergelegt, der ponti-
fizierende Abt spricht einige Gebete und fleht
vom Himmel herab den Segen des Herrn über
jene Herden und deren Hirten, welche von der
Wolle dieser Lämmer das Pallium von, Papste
erhalten werden. Darauf werden die Lämmer
mit Weihwasser besprengt und incensiert. Nach
beendigter Feierlichkeit führt man beide Lämmer
in einem Wagen wieder in das Kloster zurück,
in welche», sie gezogen und verpflegt worden
sind; nach einiger Zeit werden sie dann geschoren.
Der Anblick dieser makellosen Lämmlein, die
gebunden, ruhig und harmlos auf de», Altäre
liegen, spricht sehr an. Sie erinnern lebhaft
an das Lamm Gottes, das von den Händen
der Sünder gebunden auf den Altar des Kreuzes
gelegt und für die Missetaten der Welt geopfert
wurde. Wie sinnig ist es, zwei zarte, schriee-