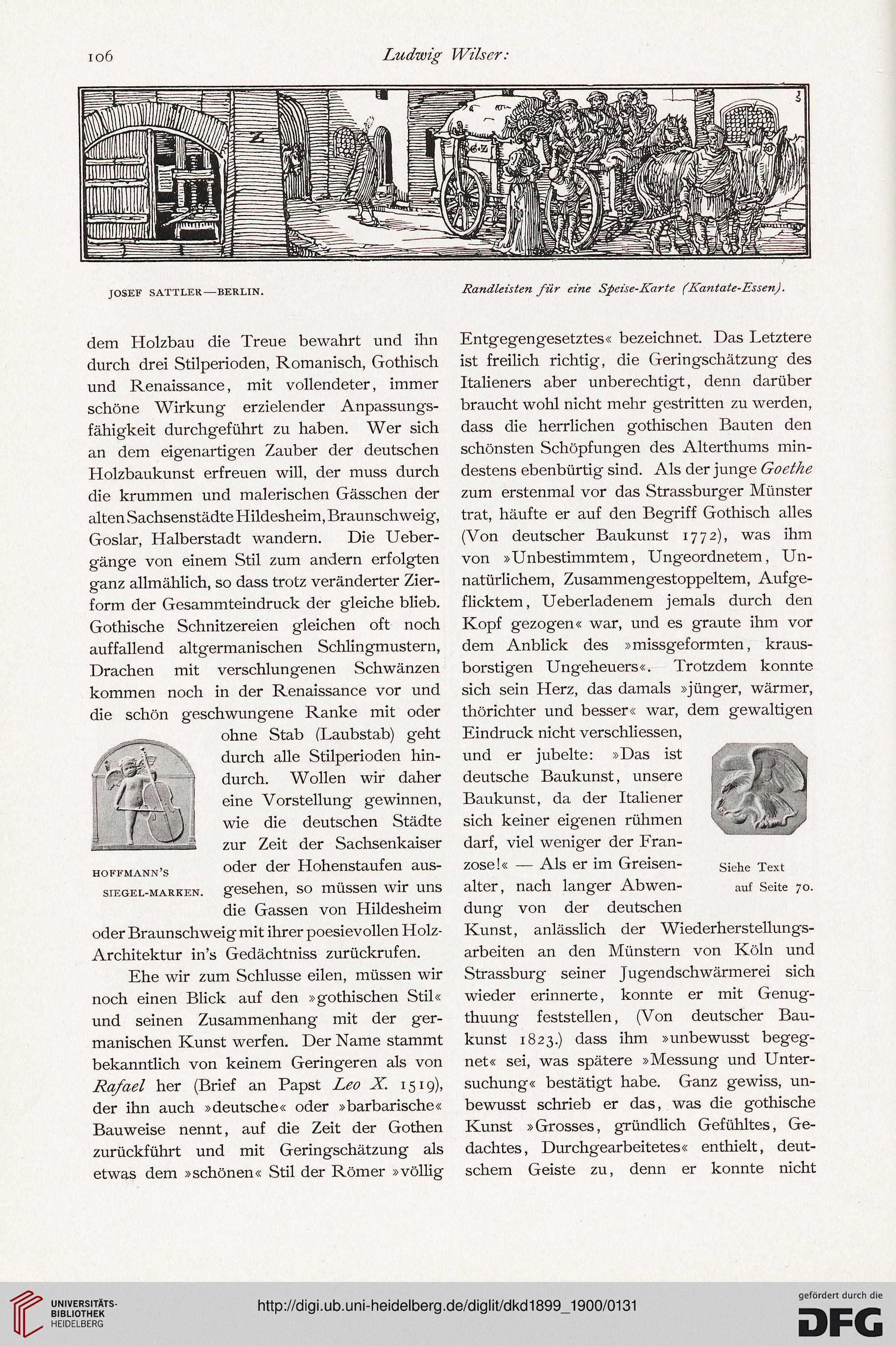io6 Ludwig Wilser:
JOSEF SATTLER—BERLIN. Randleisten für eine Speise-Karte (Kantate-Essen).
dem Holzbau die Treue bewahrt und ihn
durch drei Stilperioden, Romanisch, Gothisch
und Renaissance, mit vollendeter, immer
schöne Wirkung erzielender Anpassungs-
fähigkeit durchgeführt zu haben. Wer sich
an dem eigenartigen Zauber der deutschen
Holzbaukunst erfreuen will, der muss durch
die krummen und malerischen Gässchen der
alten Sachsenstädte Hildesheim, Braunschweig,
Goslar, Halberstadt wandern. Die Ueber-
gänge von einem Stil zum andern erfolgten
ganz allmählich, so dass trotz veränderter Zier-
form der Gesammteindruck der gleiche blieb.
Gothische Schnitzereien gleichen oft noch
auffallend altgermanischen Schlingmustern,
Drachen mit verschlungenen Schwänzen
kommen noch in der Renaissance vor und
die schön geschwungene Ranke mit oder
ohne Stab (Laubstab) geht
durch alle Stilperioden hin-
durch. Wollen wir daher
eine Vorstellung gewinnen,
wie die deutschen Städte
zur Zeit der Sachsenkaiser
oder der Hohenstaufen aus-
gesehen, so müssen wir uns
die Gassen von Hildesheim
oder Braunschweig mit ihrer poesievollen Holz-
Architektur in's Gedächtniss zurückrufen.
Ehe wir zum Schlüsse eilen, müssen wir
noch einen Blick auf den »gothischen Stil«
und seinen Zusammenhang mit der ger-
manischen Kunst werfen. Der Name stammt
bekanntlich von keinem Geringeren als von
Rafael her (Brief an Papst Leo X. 1519),
der ihn auch »deutsche« oder »barbarische«
Bauweise nennt, auf die Zeit der Gothen
zurückführt und mit Geringschätzung als
etwas dem »schönen« Stil der Römer »völlig
/
r j
HOFFMANN S
SIEGEL-MARKEN
Entgegengesetztes« bezeichnet. Das Letztere
ist freilich richtig, die Geringschätzung des
Italieners aber unberechtigt, denn darüber
braucht wohl nicht mehr gestritten zu werden,
dass die herrlichen gothischen Bauten den
schönsten Schöpfungen des Alterthums min-
destens ebenbürtig sind. Als der junge Goethe
zum erstenmal vor das Strassburger Münster
trat, häufte er auf den Begriff Gothisch alles
(Von deutscher Baukunst 1772), was ihm
von »Unbestimmtem, Ungeordnetem, Un-
natürlichem, Zusammengestoppeltem, Aufge-
flicktem, Ueberladenem jemals durch den
Kopf gezogen« war, und es graute ihm vor
dem Anblick des »missgeformten, kraus-
borstigen Ungeheuers«. Trotzdem konnte
sich sein Herz, das damals »jünger, wärmer,
thörichter und besser« war, dem gewaltigen
Eindruck nicht verschliessen,
und er jubelte: »Das ist
deutsche Baukunst, unsere
Baukunst, da der Italiener
sich keiner eigenen rühmen
darf, viel weniger der Fran-
zose!« — Als er im Greisen-
alter, nach langer Abwen-
dung von der deutschen
Kunst, anlässlich der Wiederherstellungs-
arbeiten an den Münstern von Köln und
Strassburg seiner Jugendschwärmerei sich
wieder erinnerte, konnte er mit Genug-
tuung feststellen, (Von deutscher Bau-
kunst 1823.) dass ihm »unbewusst begeg-
net« sei, was spätere »Messung und Unter-
suchung« bestätigt habe. Ganz gewiss, un-
bewusst schrieb er das, was die gothische
Kunst »Grosses, gründlich Gefühltes, Ge-
dachtes, Durchgearbeitetes« enthielt, deut-
schem Geiste zu, denn er konnte nicht
Siehe Text
auf Seite 70.
JOSEF SATTLER—BERLIN. Randleisten für eine Speise-Karte (Kantate-Essen).
dem Holzbau die Treue bewahrt und ihn
durch drei Stilperioden, Romanisch, Gothisch
und Renaissance, mit vollendeter, immer
schöne Wirkung erzielender Anpassungs-
fähigkeit durchgeführt zu haben. Wer sich
an dem eigenartigen Zauber der deutschen
Holzbaukunst erfreuen will, der muss durch
die krummen und malerischen Gässchen der
alten Sachsenstädte Hildesheim, Braunschweig,
Goslar, Halberstadt wandern. Die Ueber-
gänge von einem Stil zum andern erfolgten
ganz allmählich, so dass trotz veränderter Zier-
form der Gesammteindruck der gleiche blieb.
Gothische Schnitzereien gleichen oft noch
auffallend altgermanischen Schlingmustern,
Drachen mit verschlungenen Schwänzen
kommen noch in der Renaissance vor und
die schön geschwungene Ranke mit oder
ohne Stab (Laubstab) geht
durch alle Stilperioden hin-
durch. Wollen wir daher
eine Vorstellung gewinnen,
wie die deutschen Städte
zur Zeit der Sachsenkaiser
oder der Hohenstaufen aus-
gesehen, so müssen wir uns
die Gassen von Hildesheim
oder Braunschweig mit ihrer poesievollen Holz-
Architektur in's Gedächtniss zurückrufen.
Ehe wir zum Schlüsse eilen, müssen wir
noch einen Blick auf den »gothischen Stil«
und seinen Zusammenhang mit der ger-
manischen Kunst werfen. Der Name stammt
bekanntlich von keinem Geringeren als von
Rafael her (Brief an Papst Leo X. 1519),
der ihn auch »deutsche« oder »barbarische«
Bauweise nennt, auf die Zeit der Gothen
zurückführt und mit Geringschätzung als
etwas dem »schönen« Stil der Römer »völlig
/
r j
HOFFMANN S
SIEGEL-MARKEN
Entgegengesetztes« bezeichnet. Das Letztere
ist freilich richtig, die Geringschätzung des
Italieners aber unberechtigt, denn darüber
braucht wohl nicht mehr gestritten zu werden,
dass die herrlichen gothischen Bauten den
schönsten Schöpfungen des Alterthums min-
destens ebenbürtig sind. Als der junge Goethe
zum erstenmal vor das Strassburger Münster
trat, häufte er auf den Begriff Gothisch alles
(Von deutscher Baukunst 1772), was ihm
von »Unbestimmtem, Ungeordnetem, Un-
natürlichem, Zusammengestoppeltem, Aufge-
flicktem, Ueberladenem jemals durch den
Kopf gezogen« war, und es graute ihm vor
dem Anblick des »missgeformten, kraus-
borstigen Ungeheuers«. Trotzdem konnte
sich sein Herz, das damals »jünger, wärmer,
thörichter und besser« war, dem gewaltigen
Eindruck nicht verschliessen,
und er jubelte: »Das ist
deutsche Baukunst, unsere
Baukunst, da der Italiener
sich keiner eigenen rühmen
darf, viel weniger der Fran-
zose!« — Als er im Greisen-
alter, nach langer Abwen-
dung von der deutschen
Kunst, anlässlich der Wiederherstellungs-
arbeiten an den Münstern von Köln und
Strassburg seiner Jugendschwärmerei sich
wieder erinnerte, konnte er mit Genug-
tuung feststellen, (Von deutscher Bau-
kunst 1823.) dass ihm »unbewusst begeg-
net« sei, was spätere »Messung und Unter-
suchung« bestätigt habe. Ganz gewiss, un-
bewusst schrieb er das, was die gothische
Kunst »Grosses, gründlich Gefühltes, Ge-
dachtes, Durchgearbeitetes« enthielt, deut-
schem Geiste zu, denn er konnte nicht
Siehe Text
auf Seite 70.