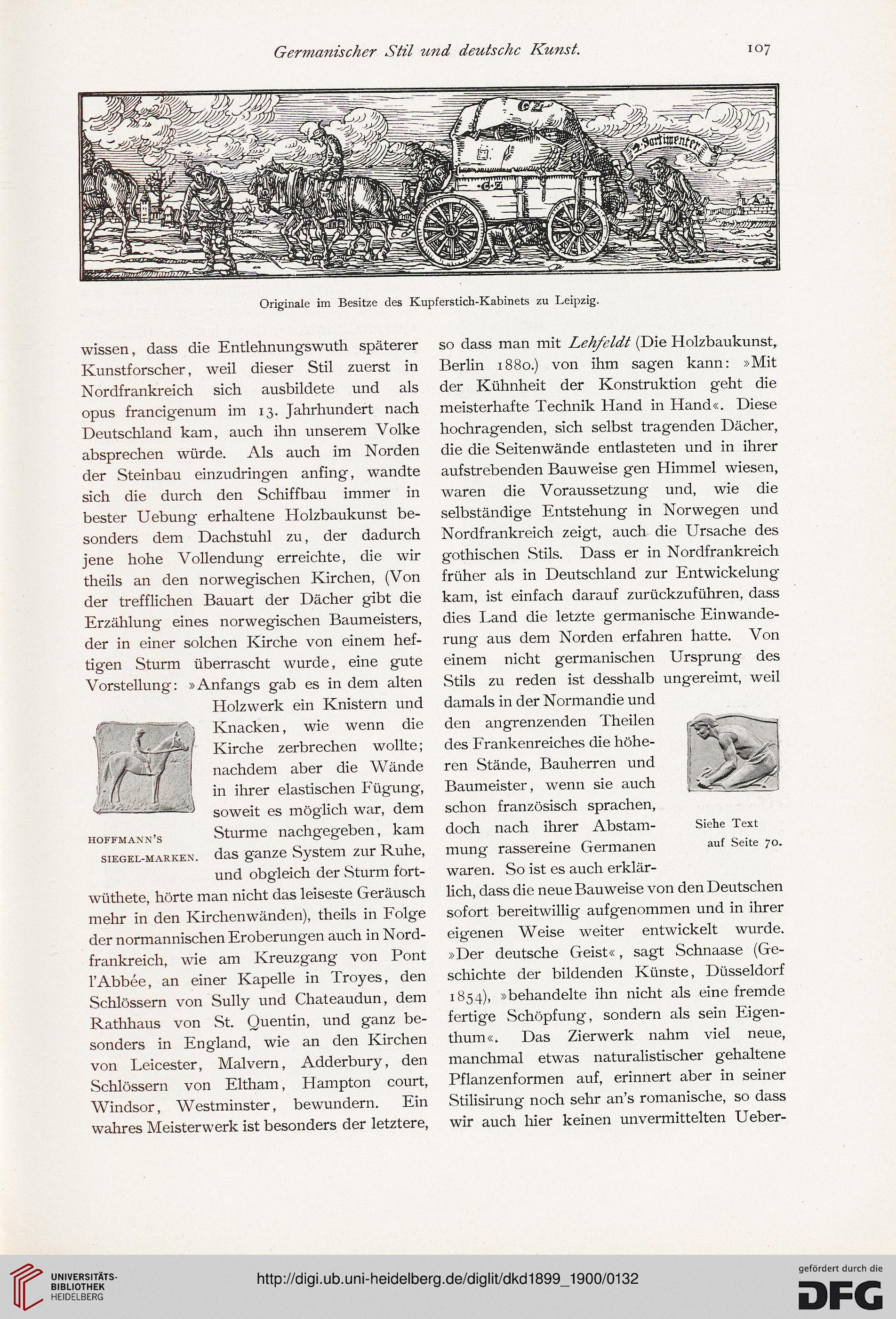Germanischer Stil und deutsche Kunst.
wissen, dass die Entlehnungswuth späterer
Kunstforscher, weil dieser Stil zuerst in
Nordfrankreich sich ausbildete und als
opus francigenum im 13. Jahrhundert nach
Deutschland kam, auch ihn unserem Volke
absprechen würde. Als auch im Norden
der Steinbau einzudringen anfing, wandte
sich die durch den Schiffbau immer in
bester Uebung erhaltene Holzbaukunst be-
sonders dem Dachstuhl zu, der dadurch
jene hohe Vollendung erreichte, die wir
theils an den norwegischen Kirchen, (Von
der trefflichen Bauart der Dächer gibt die
Erzählung eines norwegischen Baumeisters,
der in einer solchen Kirche von einem hef-
tigen Sturm überrascht wurde, eine gute
Vorstellung: »Anfangs gab es in dem alten
Holzwerk ein Knistern und
Knacken, wie wenn die
Kirche zerbrechen wollte;
nachdem aber die Wände
in ihrer elastischen Fügung,
soweit es möglich war, dem
Sturme nachgegeben, kam
siegel-marken . das ganze System zur Ruhe,
und obgleich der Sturm fort-
wüthete, hörte man nicht das leiseste Geräusch
mehr in den Kirchenwänden), theils in Folge
der normannischen Eroberungen auch in Nord-
frankreich, wie am Kreuzgang von Pont
lAbbee, an einer Kapelle in Troyes, den
Schlössern von Sully und Chateaudun, dem
Rathhaus von St. Quentin, und ganz be-
sonders in England, wie an den Kirchen
von Leicester, Malvern, Adderbury, den
Schlössern von Eltham, Hampton court,
Windsor, Westminster, bewundern. Ein
wahres Meisterwerk ist besonders der letztere,
hoffma.nn s
so dass man mit Lehfeldt (Die Holzbaukunst,
Berlin 1880.) von ihm sagen kann: »Mit
der Kühnheit der Konstruktion geht die
meisterhafte Technik Hand in Hand«. Diese
hochragenden, sich selbst tragenden Dächer,
die die Seitenwände entlasteten und in ihrer
aufstrebenden Bauweise gen Himmel wiesen,
waren die Voraussetzung und, wie die
selbständige Entstehung in Norwegen und
Nordfrankreich zeigt, auch die Ursache des
gothischen Stils. Dass er in Nordfrankreich
früher als in Deutschland zur Entwickelung
kam, ist einfach darauf zurückzuführen, dass
dies Land die letzte germanische Einwande-
rung aus dem Norden erfahren hatte. Von
einem nicht germanischen Ursprung des
Stils zu reden ist desshalb ungereimt, weil
damals in der Normandie und
den angrenzenden Theilen
des Frankenreiches die höhe-
ren Stände, Bauherren und
Baumeister, wenn sie auch
schon französisch sprachen,
doch nach ihrer Abstam-
mung rassereine Germanen
waren. So ist es auch erklär-
lich, dass die neue Bauweise von den Deutschen
sofort bereitwillig aufgenommen und in ihrer
eigenen Weise weiter entwickelt wurde.
»Der deutsche Geist«, sagt Schnaase (Ge-
schichte der bildenden Künste, Düsseldorf
1854), »behandelte ihn nicht als eine fremde
fertige Schöpfung, sondern als sein Eigen-
thum«. Das Zierwerk nahm viel neue,
manchmal etwas naturalistischer gehaltene
Pflanzenformen auf, erinnert aber in seiner
Stilisirung noch sehr an's romanische, so dass
wir auch liier keinen unvermittelten Ueber-
Siehe Text
auf Seite 70.
wissen, dass die Entlehnungswuth späterer
Kunstforscher, weil dieser Stil zuerst in
Nordfrankreich sich ausbildete und als
opus francigenum im 13. Jahrhundert nach
Deutschland kam, auch ihn unserem Volke
absprechen würde. Als auch im Norden
der Steinbau einzudringen anfing, wandte
sich die durch den Schiffbau immer in
bester Uebung erhaltene Holzbaukunst be-
sonders dem Dachstuhl zu, der dadurch
jene hohe Vollendung erreichte, die wir
theils an den norwegischen Kirchen, (Von
der trefflichen Bauart der Dächer gibt die
Erzählung eines norwegischen Baumeisters,
der in einer solchen Kirche von einem hef-
tigen Sturm überrascht wurde, eine gute
Vorstellung: »Anfangs gab es in dem alten
Holzwerk ein Knistern und
Knacken, wie wenn die
Kirche zerbrechen wollte;
nachdem aber die Wände
in ihrer elastischen Fügung,
soweit es möglich war, dem
Sturme nachgegeben, kam
siegel-marken . das ganze System zur Ruhe,
und obgleich der Sturm fort-
wüthete, hörte man nicht das leiseste Geräusch
mehr in den Kirchenwänden), theils in Folge
der normannischen Eroberungen auch in Nord-
frankreich, wie am Kreuzgang von Pont
lAbbee, an einer Kapelle in Troyes, den
Schlössern von Sully und Chateaudun, dem
Rathhaus von St. Quentin, und ganz be-
sonders in England, wie an den Kirchen
von Leicester, Malvern, Adderbury, den
Schlössern von Eltham, Hampton court,
Windsor, Westminster, bewundern. Ein
wahres Meisterwerk ist besonders der letztere,
hoffma.nn s
so dass man mit Lehfeldt (Die Holzbaukunst,
Berlin 1880.) von ihm sagen kann: »Mit
der Kühnheit der Konstruktion geht die
meisterhafte Technik Hand in Hand«. Diese
hochragenden, sich selbst tragenden Dächer,
die die Seitenwände entlasteten und in ihrer
aufstrebenden Bauweise gen Himmel wiesen,
waren die Voraussetzung und, wie die
selbständige Entstehung in Norwegen und
Nordfrankreich zeigt, auch die Ursache des
gothischen Stils. Dass er in Nordfrankreich
früher als in Deutschland zur Entwickelung
kam, ist einfach darauf zurückzuführen, dass
dies Land die letzte germanische Einwande-
rung aus dem Norden erfahren hatte. Von
einem nicht germanischen Ursprung des
Stils zu reden ist desshalb ungereimt, weil
damals in der Normandie und
den angrenzenden Theilen
des Frankenreiches die höhe-
ren Stände, Bauherren und
Baumeister, wenn sie auch
schon französisch sprachen,
doch nach ihrer Abstam-
mung rassereine Germanen
waren. So ist es auch erklär-
lich, dass die neue Bauweise von den Deutschen
sofort bereitwillig aufgenommen und in ihrer
eigenen Weise weiter entwickelt wurde.
»Der deutsche Geist«, sagt Schnaase (Ge-
schichte der bildenden Künste, Düsseldorf
1854), »behandelte ihn nicht als eine fremde
fertige Schöpfung, sondern als sein Eigen-
thum«. Das Zierwerk nahm viel neue,
manchmal etwas naturalistischer gehaltene
Pflanzenformen auf, erinnert aber in seiner
Stilisirung noch sehr an's romanische, so dass
wir auch liier keinen unvermittelten Ueber-
Siehe Text
auf Seite 70.