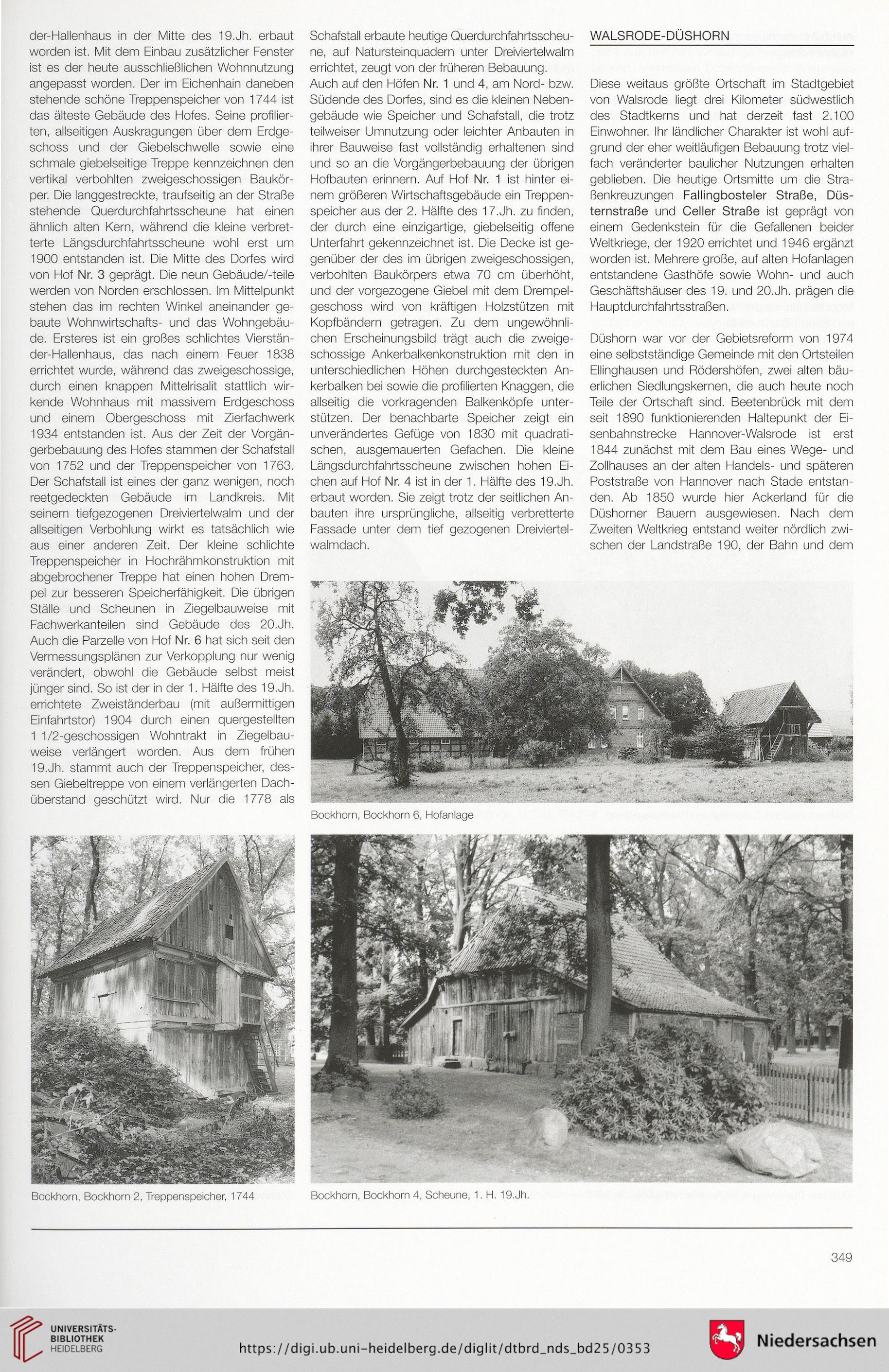der-Hallenhaus in der Mitte des 19.Jh. erbaut
worden ist. Mit dem Einbau zusätzlicher Fenster
ist es der heute ausschließlichen Wohnnutzung
angepasst worden. Der im Eichenhain daneben
stehende schöne Treppenspeicher von 1744 ist
das älteste Gebäude des Hofes. Seine profilier-
ten, allseitigen Auskragungen über dem Erdge-
schoss und der Giebelschwelle sowie eine
schmale giebelseitige Treppe kennzeichnen den
vertikal verbohlten zweigeschossigen Baukör-
per. Die langgestreckte, traufseitig an der Straße
stehende Querdurchfahrtsscheune hat einen
ähnlich alten Kern, während die kleine verbrei-
terte Längsdurchfahrtsscheune wohl erst um
1900 entstanden ist. Die Mitte des Dorfes wird
von Hof Nr. 3 geprägt. Die neun Gebäude/-teile
werden von Norden erschlossen. Im Mittelpunkt
stehen das im rechten Winkel aneinander ge-
baute Wohnwirtschafts- und das Wohngebäu-
de. Ersteres ist ein großes schlichtes Vierstän-
der-Hallenhaus, das nach einem Feuer 1838
errichtet wurde, während das zweigeschossige,
durch einen knappen Mittelrisalit stattlich wir-
kende Wohnhaus mit massivem Erdgeschoss
und einem Obergeschoss mit Zierfachwerk
1934 entstanden ist. Aus der Zeit der Vorgän-
gerbebauung des Hofes stammen der Schafstall
von 1752 und der Treppenspeicher von 1763.
Der Schafstall ist eines der ganz wenigen, noch
reetgedeckten Gebäude im Landkreis. Mit
seinem tiefgezogenen Dreiviertelwalm und der
allseitigen Verbohlung wirkt es tatsächlich wie
aus einer anderen Zeit. Der kleine schlichte
Treppenspeicher in Hochrähmkonstruktion mit
abgebrochener Treppe hat einen hohen Drem-
pel zur besseren Speicherfähigkeit. Die übrigen
Ställe und Scheunen in Ziegelbauweise mit
Fachwerkanteilen sind Gebäude des 20.Jh.
Auch die Parzelle von Hof Nr. 6 hat sich seit den
Vermessungsplänen zur Verkopplung nur wenig
verändert, obwohl die Gebäude selbst meist
jünger sind. So ist der in der 1. Hälfte des 19.Jh.
errichtete Zweiständerbau (mit außermittigen
Einfahrtstor) 1904 durch einen quergestellten
1 1/2-geschossigen Wohntrakt in Ziegelbau-
weise verlängert worden. Aus dem frühen
19.Jh. stammt auch der Treppenspeicher, des-
sen Giebeltreppe von einem verlängerten Dach-
überstand geschützt wird. Nur die 1778 als
Bockhorn, Bockhorn 2, Treppenspeicher, 1744
Schafstall erbaute heutige Querdurchfahrtsscheu-
ne, auf Natursteinquadern unter Dreiviertelwalm
errichtet, zeugt von der früheren Bebauung.
Auch auf den Höfen Nr. 1 und 4, am Nord- bzw.
Südende des Dorfes, sind es die kleinen Neben-
gebäude wie Speicher und Schafstall, die trotz
teilweiser Umnutzung oder leichter Anbauten in
ihrer Bauweise fast vollständig erhaltenen sind
und so an die Vorgängerbebauung der übrigen
Hofbauten erinnern. Auf Hof Nr. 1 ist hinter ei-
nem größeren Wirtschaftsgebäude ein Treppen-
speicher aus der 2. Hälfte des 17.Jh. zu finden,
der durch eine einzigartige, giebelseitig offene
Unterfahrt gekennzeichnet ist. Die Decke ist ge-
genüber der des im übrigen zweigeschossigen,
verbohlten Baukörpers etwa 70 cm überhöht,
und der vorgezogene Giebel mit dem Drempel-
geschoss wird von kräftigen Holzstützen mit
Kopfbändern getragen. Zu dem ungewöhnli-
chen Erscheinungsbild trägt auch die zweige-
schossige Ankerbalkenkonstruktion mit den in
unterschiedlichen Höhen durchgesteckten An-
kerbalken bei sowie die profilierten Knaggen, die
allseitig die vorkragenden Balkenköpfe unter-
stützen. Der benachbarte Speicher zeigt ein
unverändertes Gefüge von 1830 mit quadrati-
schen, ausgemauerten Gefachen. Die kleine
Längsdurchfahrtsscheune zwischen hohen Ei-
chen auf Hof Nr. 4 ist in der 1. Hälfte des 19.Jh.
erbaut worden. Sie zeigt trotz der seitlichen An-
bauten ihre ursprüngliche, allseitig verbreiterte
Fassade unter dem tief gezogenen Dreiviertel-
walmdach.
WALSRODE-DÜSHORN
Diese weitaus größte Ortschaft im Stadtgebiet
von Walsrode liegt drei Kilometer südwestlich
des Stadtkerns und hat derzeit fast 2.100
Einwohner. Ihr ländlicher Charakter ist wohl auf-
grund der eher weitläufigen Bebauung trotz viel-
fach veränderter baulicher Nutzungen erhalten
geblieben. Die heutige Ortsmitte um die Stra-
ßenkreuzungen Fallingbosteler Straße, Düs-
ternstraße und Celler Straße ist geprägt von
einem Gedenkstein für die Gefallenen beider
Weltkriege, der 1920 errichtet und 1946 ergänzt
worden ist. Mehrere große, auf alten Hofanlagen
entstandene Gasthöfe sowie Wohn- und auch
Geschäftshäuser des 19. und 20.Jh. prägen die
Hauptdurchfahrtsstraßen.
Düshorn war vor der Gebietsreform von 1974
eine selbstständige Gemeinde mit den Ortsteilen
Ellinghausen und Rödershöfen, zwei alten bäu-
erlichen Siedlungskernen, die auch heute noch
Teile der Ortschaft sind. Beetenbrück mit dem
seit 1890 funktionierenden Haltepunkt der Ei-
senbahnstrecke Hannover-Walsrode ist erst
1844 zunächst mit dem Bau eines Wege- und
Zollhauses an der alten Handels- und späteren
Poststraße von Hannover nach Stade entstan-
den. Ab 1850 wurde hier Ackerland für die
Düshorner Bauern ausgewiesen. Nach dem
Zweiten Weltkrieg entstand weiter nördlich zwi-
schen der Landstraße 190, der Bahn und dem
Bockhorn, Bockhorn 4, Scheune, 1. H. 19.Jh.
349
worden ist. Mit dem Einbau zusätzlicher Fenster
ist es der heute ausschließlichen Wohnnutzung
angepasst worden. Der im Eichenhain daneben
stehende schöne Treppenspeicher von 1744 ist
das älteste Gebäude des Hofes. Seine profilier-
ten, allseitigen Auskragungen über dem Erdge-
schoss und der Giebelschwelle sowie eine
schmale giebelseitige Treppe kennzeichnen den
vertikal verbohlten zweigeschossigen Baukör-
per. Die langgestreckte, traufseitig an der Straße
stehende Querdurchfahrtsscheune hat einen
ähnlich alten Kern, während die kleine verbrei-
terte Längsdurchfahrtsscheune wohl erst um
1900 entstanden ist. Die Mitte des Dorfes wird
von Hof Nr. 3 geprägt. Die neun Gebäude/-teile
werden von Norden erschlossen. Im Mittelpunkt
stehen das im rechten Winkel aneinander ge-
baute Wohnwirtschafts- und das Wohngebäu-
de. Ersteres ist ein großes schlichtes Vierstän-
der-Hallenhaus, das nach einem Feuer 1838
errichtet wurde, während das zweigeschossige,
durch einen knappen Mittelrisalit stattlich wir-
kende Wohnhaus mit massivem Erdgeschoss
und einem Obergeschoss mit Zierfachwerk
1934 entstanden ist. Aus der Zeit der Vorgän-
gerbebauung des Hofes stammen der Schafstall
von 1752 und der Treppenspeicher von 1763.
Der Schafstall ist eines der ganz wenigen, noch
reetgedeckten Gebäude im Landkreis. Mit
seinem tiefgezogenen Dreiviertelwalm und der
allseitigen Verbohlung wirkt es tatsächlich wie
aus einer anderen Zeit. Der kleine schlichte
Treppenspeicher in Hochrähmkonstruktion mit
abgebrochener Treppe hat einen hohen Drem-
pel zur besseren Speicherfähigkeit. Die übrigen
Ställe und Scheunen in Ziegelbauweise mit
Fachwerkanteilen sind Gebäude des 20.Jh.
Auch die Parzelle von Hof Nr. 6 hat sich seit den
Vermessungsplänen zur Verkopplung nur wenig
verändert, obwohl die Gebäude selbst meist
jünger sind. So ist der in der 1. Hälfte des 19.Jh.
errichtete Zweiständerbau (mit außermittigen
Einfahrtstor) 1904 durch einen quergestellten
1 1/2-geschossigen Wohntrakt in Ziegelbau-
weise verlängert worden. Aus dem frühen
19.Jh. stammt auch der Treppenspeicher, des-
sen Giebeltreppe von einem verlängerten Dach-
überstand geschützt wird. Nur die 1778 als
Bockhorn, Bockhorn 2, Treppenspeicher, 1744
Schafstall erbaute heutige Querdurchfahrtsscheu-
ne, auf Natursteinquadern unter Dreiviertelwalm
errichtet, zeugt von der früheren Bebauung.
Auch auf den Höfen Nr. 1 und 4, am Nord- bzw.
Südende des Dorfes, sind es die kleinen Neben-
gebäude wie Speicher und Schafstall, die trotz
teilweiser Umnutzung oder leichter Anbauten in
ihrer Bauweise fast vollständig erhaltenen sind
und so an die Vorgängerbebauung der übrigen
Hofbauten erinnern. Auf Hof Nr. 1 ist hinter ei-
nem größeren Wirtschaftsgebäude ein Treppen-
speicher aus der 2. Hälfte des 17.Jh. zu finden,
der durch eine einzigartige, giebelseitig offene
Unterfahrt gekennzeichnet ist. Die Decke ist ge-
genüber der des im übrigen zweigeschossigen,
verbohlten Baukörpers etwa 70 cm überhöht,
und der vorgezogene Giebel mit dem Drempel-
geschoss wird von kräftigen Holzstützen mit
Kopfbändern getragen. Zu dem ungewöhnli-
chen Erscheinungsbild trägt auch die zweige-
schossige Ankerbalkenkonstruktion mit den in
unterschiedlichen Höhen durchgesteckten An-
kerbalken bei sowie die profilierten Knaggen, die
allseitig die vorkragenden Balkenköpfe unter-
stützen. Der benachbarte Speicher zeigt ein
unverändertes Gefüge von 1830 mit quadrati-
schen, ausgemauerten Gefachen. Die kleine
Längsdurchfahrtsscheune zwischen hohen Ei-
chen auf Hof Nr. 4 ist in der 1. Hälfte des 19.Jh.
erbaut worden. Sie zeigt trotz der seitlichen An-
bauten ihre ursprüngliche, allseitig verbreiterte
Fassade unter dem tief gezogenen Dreiviertel-
walmdach.
WALSRODE-DÜSHORN
Diese weitaus größte Ortschaft im Stadtgebiet
von Walsrode liegt drei Kilometer südwestlich
des Stadtkerns und hat derzeit fast 2.100
Einwohner. Ihr ländlicher Charakter ist wohl auf-
grund der eher weitläufigen Bebauung trotz viel-
fach veränderter baulicher Nutzungen erhalten
geblieben. Die heutige Ortsmitte um die Stra-
ßenkreuzungen Fallingbosteler Straße, Düs-
ternstraße und Celler Straße ist geprägt von
einem Gedenkstein für die Gefallenen beider
Weltkriege, der 1920 errichtet und 1946 ergänzt
worden ist. Mehrere große, auf alten Hofanlagen
entstandene Gasthöfe sowie Wohn- und auch
Geschäftshäuser des 19. und 20.Jh. prägen die
Hauptdurchfahrtsstraßen.
Düshorn war vor der Gebietsreform von 1974
eine selbstständige Gemeinde mit den Ortsteilen
Ellinghausen und Rödershöfen, zwei alten bäu-
erlichen Siedlungskernen, die auch heute noch
Teile der Ortschaft sind. Beetenbrück mit dem
seit 1890 funktionierenden Haltepunkt der Ei-
senbahnstrecke Hannover-Walsrode ist erst
1844 zunächst mit dem Bau eines Wege- und
Zollhauses an der alten Handels- und späteren
Poststraße von Hannover nach Stade entstan-
den. Ab 1850 wurde hier Ackerland für die
Düshorner Bauern ausgewiesen. Nach dem
Zweiten Weltkrieg entstand weiter nördlich zwi-
schen der Landstraße 190, der Bahn und dem
Bockhorn, Bockhorn 4, Scheune, 1. H. 19.Jh.
349