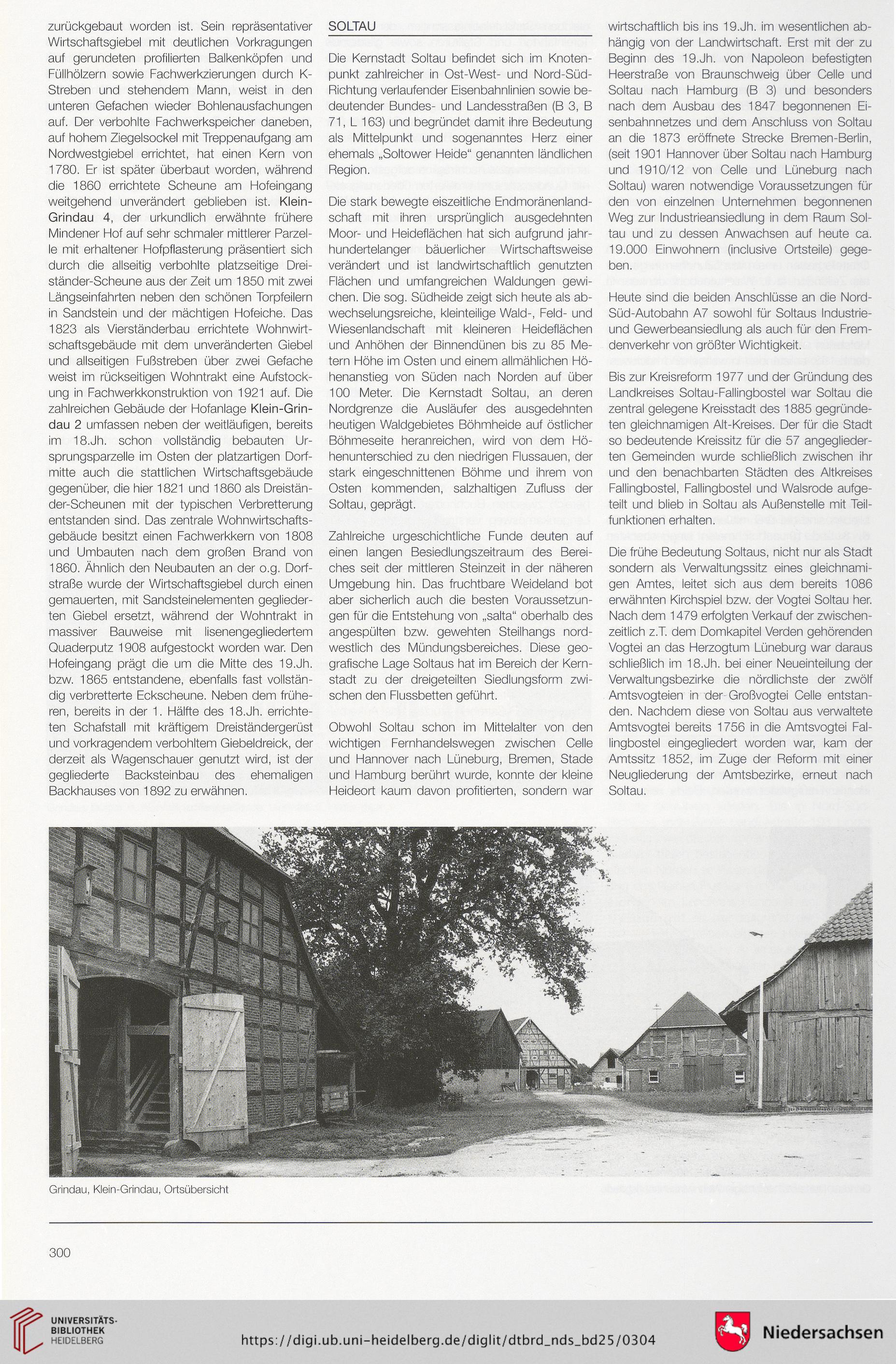zurückgebaut worden ist. Sein repräsentativer
Wirtschaftsgiebel mit deutlichen Vorkragungen
auf gerundeten profilierten Balkenköpfen und
Füllhölzern sowie Fachwerkzierungen durch K-
Streben und stehendem Mann, weist in den
unteren Gefachen wieder Bohlenausfachungen
auf. Der verbohlte Fachwerkspeicher daneben,
auf hohem Ziegelsockel mit Treppenaufgang am
Nordwestgiebel errichtet, hat einen Kern von
1780. Er ist später überbaut worden, während
die 1860 errichtete Scheune am Hofeingang
weitgehend unverändert geblieben ist. Klein-
Grindau 4, der urkundlich erwähnte frühere
Mindener Hof auf sehr schmaler mittlerer Parzel-
le mit erhaltener Hofpflasterung präsentiert sich
durch die allseitig verbohlte platzseitige Drei-
ständer-Scheune aus der Zeit um 1850 mit zwei
Längseinfahrten neben den schönen Torpfeilern
in Sandstein und der mächtigen Hofeiche. Das
1823 als Vierständerbau errichtete Wohnwirt-
schaftsgebäude mit dem unveränderten Giebel
und allseitigen Fußstreben über zwei Gefache
weist im rückseitigen Wohntrakt eine Aufstock-
ung in Fachwerkkonstruktion von 1921 auf. Die
zahlreichen Gebäude der Hofanlage Klein-Grin-
dau 2 umfassen neben der weitläufigen, bereits
im 18.Jh. schon vollständig bebauten Ur-
sprungsparzelle im Osten der platzartigen Dorf-
mitte auch die stattlichen Wirtschaftsgebäude
gegenüber, die hier 1821 und 1860 als Dreistän-
der-Scheunen mit der typischen Verbretterung
entstanden sind. Das zentrale Wohnwirtschafts-
gebäude besitzt einen Fachwerkkern von 1808
und Umbauten nach dem großen Brand von
1860. Ähnlich den Neubauten an der o.g. Dorf-
straße wurde der Wirtschaftsgiebel durch einen
gemauerten, mit Sandsteinelementen geglieder-
ten Giebel ersetzt, während der Wohntrakt in
massiver Bauweise mit lisenengegliedertem
Quaderputz 1908 aufgestockt worden war. Den
Hofeingang prägt die um die Mitte des 19.Jh.
bzw. 1865 entstandene, ebenfalls fast vollstän-
dig verbreiterte Eckscheune. Neben dem frühe-
ren, bereits in der 1. Hälfte des 18.Jh. errichte-
ten Schafstall mit kräftigem Dreiständergerüst
und vorkragendem verbohltem Giebeldreick, der
derzeit als Wagenschauer genutzt wird, ist der
gegliederte Backsteinbau des ehemaligen
Backhauses von 1892 zu erwähnen.
SOLTAU
Die Kernstadt Soltau befindet sich im Knoten-
punkt zahlreicher in Ost-West- und Nord-Süd-
Richtung verlaufender Eisenbahnlinien sowie be-
deutender Bundes- und Landesstraßen (B 3, B
71, L 163) und begründet damit ihre Bedeutung
als Mittelpunkt und sogenanntes Herz einer
ehemals „Soltower Heide“ genannten ländlichen
Region.
Die stark bewegte eiszeitliche Endmoränenland-
schaft mit ihren ursprünglich ausgedehnten
Moor- und Heideflächen hat sich aufgrund jahr-
hundertelanger bäuerlicher Wirtschaftsweise
verändert und ist landwirtschaftlich genutzten
Flächen und umfangreichen Waldungen gewi-
chen. Die sog. Südheide zeigt sich heute als ab-
wechselungsreiche, kleinteilige Wald-, Feld- und
Wiesenlandschaft mit kleineren Heideflächen
und Anhöhen der Binnendünen bis zu 85 Me-
tern Höhe im Osten und einem allmählichen Hö-
henanstieg von Süden nach Norden auf über
100 Meter. Die Kernstadt Soltau, an deren
Nordgrenze die Ausläufer des ausgedehnten
heutigen Waldgebietes Böhmheide auf östlicher
Böhmeseite heranreichen, wird von dem Hö-
henunterschied zu den niedrigen Flussauen, der
stark eingeschnittenen Böhme und ihrem von
Osten kommenden, salzhaltigen Zufluss der
Soltau, geprägt.
Zahlreiche urgeschichtliche Funde deuten auf
einen langen Besiedlungszeitraum des Berei-
ches seit der mittleren Steinzeit in der näheren
Umgebung hin. Das fruchtbare Weideland bot
aber sicherlich auch die besten Voraussetzun-
gen für die Entstehung von „salta“ oberhalb des
angespülten bzw. gewehten Steilhangs nord-
westlich des Mündungsbereiches. Diese geo-
grafische Lage Soltaus hat im Bereich der Kern-
stadt zu der dreigeteilten Siedlungsform zwi-
schen den Flussbetten geführt.
Obwohl Soltau schon im Mittelalter von den
wichtigen Fernhandelswegen zwischen Celle
und Hannover nach Lüneburg, Bremen, Stade
und Hamburg berührt wurde, konnte der kleine
Heideort kaum davon profitierten, sondern war
wirtschaftlich bis ins 19.Jh. im wesentlichen ab-
hängig von der Landwirtschaft. Erst mit der zu
Beginn des 19.Jh. von Napoleon befestigten
Heerstraße von Braunschweig über Celle und
Soltau nach Hamburg (B 3) und besonders
nach dem Ausbau des 1847 begonnenen Ei-
senbahnnetzes und dem Anschluss von Soltau
an die 1873 eröffnete Strecke Bremen-Berlin,
(seit 1901 Hannover über Soltau nach Hamburg
und 1910/12 von Celle und Lüneburg nach
Soltau) waren notwendige Voraussetzungen für
den von einzelnen Unternehmen begonnenen
Weg zur Industrieansiedlung in dem Raum Sol-
tau und zu dessen Anwachsen auf heute ca.
19.000 Einwohnern (inclusive Ortsteile) gege-
ben.
Heute sind die beiden Anschlüsse an die Nord-
Süd-Autobahn A7 sowohl für Soltaus Industrie-
und Gewerbeansiedlung als auch für den Frem-
denverkehr von größter Wichtigkeit.
Bis zur Kreisreform 1977 und der Gründung des
Landkreises Soltau-Fallingbostel war Soltau die
zentral gelegene Kreisstadt des 1885 gegründe-
ten gleichnamigen Alt-Kreises. Der für die Stadt
so bedeutende Kreissitz für die 57 angeglieder-
ten Gemeinden wurde schließlich zwischen ihr
und den benachbarten Städten des Altkreises
Fallingbostel, Fallingbostel und Walsrode aufge-
teilt und blieb in Soltau als Außenstelle mit Teil-
funktionen erhalten.
Die frühe Bedeutung Soltaus, nicht nur als Stadt
sondern als Verwaltungssitz eines gleichnami-
gen Amtes, leitet sich aus dem bereits 1086
erwähnten Kirchspiel bzw. der Vogtei Soltau her.
Nach dem 1479 erfolgten Verkauf der zwischen-
zeitlich z.T. dem Domkapitel Verden gehörenden
Vogtei an das Herzogtum Lüneburg war daraus
schließlich im 18.Jh. bei einer Neueinteilung der
Verwaltungsbezirke die nördlichste der zwölf
Amtsvogteien in der Großvogtei Celle entstan-
den. Nachdem diese von Soltau aus verwaltete
Amtsvogtei bereits 1756 in die Amtsvogtei Fal-
lingbostel eingegliedert worden war, kam der
Amtssitz 1852, im Zuge der Reform mit einer
Neugliederung der Amtsbezirke, erneut nach
Soltau.
Grindau, Klein-Grindau. Ortsübersicht
300
Wirtschaftsgiebel mit deutlichen Vorkragungen
auf gerundeten profilierten Balkenköpfen und
Füllhölzern sowie Fachwerkzierungen durch K-
Streben und stehendem Mann, weist in den
unteren Gefachen wieder Bohlenausfachungen
auf. Der verbohlte Fachwerkspeicher daneben,
auf hohem Ziegelsockel mit Treppenaufgang am
Nordwestgiebel errichtet, hat einen Kern von
1780. Er ist später überbaut worden, während
die 1860 errichtete Scheune am Hofeingang
weitgehend unverändert geblieben ist. Klein-
Grindau 4, der urkundlich erwähnte frühere
Mindener Hof auf sehr schmaler mittlerer Parzel-
le mit erhaltener Hofpflasterung präsentiert sich
durch die allseitig verbohlte platzseitige Drei-
ständer-Scheune aus der Zeit um 1850 mit zwei
Längseinfahrten neben den schönen Torpfeilern
in Sandstein und der mächtigen Hofeiche. Das
1823 als Vierständerbau errichtete Wohnwirt-
schaftsgebäude mit dem unveränderten Giebel
und allseitigen Fußstreben über zwei Gefache
weist im rückseitigen Wohntrakt eine Aufstock-
ung in Fachwerkkonstruktion von 1921 auf. Die
zahlreichen Gebäude der Hofanlage Klein-Grin-
dau 2 umfassen neben der weitläufigen, bereits
im 18.Jh. schon vollständig bebauten Ur-
sprungsparzelle im Osten der platzartigen Dorf-
mitte auch die stattlichen Wirtschaftsgebäude
gegenüber, die hier 1821 und 1860 als Dreistän-
der-Scheunen mit der typischen Verbretterung
entstanden sind. Das zentrale Wohnwirtschafts-
gebäude besitzt einen Fachwerkkern von 1808
und Umbauten nach dem großen Brand von
1860. Ähnlich den Neubauten an der o.g. Dorf-
straße wurde der Wirtschaftsgiebel durch einen
gemauerten, mit Sandsteinelementen geglieder-
ten Giebel ersetzt, während der Wohntrakt in
massiver Bauweise mit lisenengegliedertem
Quaderputz 1908 aufgestockt worden war. Den
Hofeingang prägt die um die Mitte des 19.Jh.
bzw. 1865 entstandene, ebenfalls fast vollstän-
dig verbreiterte Eckscheune. Neben dem frühe-
ren, bereits in der 1. Hälfte des 18.Jh. errichte-
ten Schafstall mit kräftigem Dreiständergerüst
und vorkragendem verbohltem Giebeldreick, der
derzeit als Wagenschauer genutzt wird, ist der
gegliederte Backsteinbau des ehemaligen
Backhauses von 1892 zu erwähnen.
SOLTAU
Die Kernstadt Soltau befindet sich im Knoten-
punkt zahlreicher in Ost-West- und Nord-Süd-
Richtung verlaufender Eisenbahnlinien sowie be-
deutender Bundes- und Landesstraßen (B 3, B
71, L 163) und begründet damit ihre Bedeutung
als Mittelpunkt und sogenanntes Herz einer
ehemals „Soltower Heide“ genannten ländlichen
Region.
Die stark bewegte eiszeitliche Endmoränenland-
schaft mit ihren ursprünglich ausgedehnten
Moor- und Heideflächen hat sich aufgrund jahr-
hundertelanger bäuerlicher Wirtschaftsweise
verändert und ist landwirtschaftlich genutzten
Flächen und umfangreichen Waldungen gewi-
chen. Die sog. Südheide zeigt sich heute als ab-
wechselungsreiche, kleinteilige Wald-, Feld- und
Wiesenlandschaft mit kleineren Heideflächen
und Anhöhen der Binnendünen bis zu 85 Me-
tern Höhe im Osten und einem allmählichen Hö-
henanstieg von Süden nach Norden auf über
100 Meter. Die Kernstadt Soltau, an deren
Nordgrenze die Ausläufer des ausgedehnten
heutigen Waldgebietes Böhmheide auf östlicher
Böhmeseite heranreichen, wird von dem Hö-
henunterschied zu den niedrigen Flussauen, der
stark eingeschnittenen Böhme und ihrem von
Osten kommenden, salzhaltigen Zufluss der
Soltau, geprägt.
Zahlreiche urgeschichtliche Funde deuten auf
einen langen Besiedlungszeitraum des Berei-
ches seit der mittleren Steinzeit in der näheren
Umgebung hin. Das fruchtbare Weideland bot
aber sicherlich auch die besten Voraussetzun-
gen für die Entstehung von „salta“ oberhalb des
angespülten bzw. gewehten Steilhangs nord-
westlich des Mündungsbereiches. Diese geo-
grafische Lage Soltaus hat im Bereich der Kern-
stadt zu der dreigeteilten Siedlungsform zwi-
schen den Flussbetten geführt.
Obwohl Soltau schon im Mittelalter von den
wichtigen Fernhandelswegen zwischen Celle
und Hannover nach Lüneburg, Bremen, Stade
und Hamburg berührt wurde, konnte der kleine
Heideort kaum davon profitierten, sondern war
wirtschaftlich bis ins 19.Jh. im wesentlichen ab-
hängig von der Landwirtschaft. Erst mit der zu
Beginn des 19.Jh. von Napoleon befestigten
Heerstraße von Braunschweig über Celle und
Soltau nach Hamburg (B 3) und besonders
nach dem Ausbau des 1847 begonnenen Ei-
senbahnnetzes und dem Anschluss von Soltau
an die 1873 eröffnete Strecke Bremen-Berlin,
(seit 1901 Hannover über Soltau nach Hamburg
und 1910/12 von Celle und Lüneburg nach
Soltau) waren notwendige Voraussetzungen für
den von einzelnen Unternehmen begonnenen
Weg zur Industrieansiedlung in dem Raum Sol-
tau und zu dessen Anwachsen auf heute ca.
19.000 Einwohnern (inclusive Ortsteile) gege-
ben.
Heute sind die beiden Anschlüsse an die Nord-
Süd-Autobahn A7 sowohl für Soltaus Industrie-
und Gewerbeansiedlung als auch für den Frem-
denverkehr von größter Wichtigkeit.
Bis zur Kreisreform 1977 und der Gründung des
Landkreises Soltau-Fallingbostel war Soltau die
zentral gelegene Kreisstadt des 1885 gegründe-
ten gleichnamigen Alt-Kreises. Der für die Stadt
so bedeutende Kreissitz für die 57 angeglieder-
ten Gemeinden wurde schließlich zwischen ihr
und den benachbarten Städten des Altkreises
Fallingbostel, Fallingbostel und Walsrode aufge-
teilt und blieb in Soltau als Außenstelle mit Teil-
funktionen erhalten.
Die frühe Bedeutung Soltaus, nicht nur als Stadt
sondern als Verwaltungssitz eines gleichnami-
gen Amtes, leitet sich aus dem bereits 1086
erwähnten Kirchspiel bzw. der Vogtei Soltau her.
Nach dem 1479 erfolgten Verkauf der zwischen-
zeitlich z.T. dem Domkapitel Verden gehörenden
Vogtei an das Herzogtum Lüneburg war daraus
schließlich im 18.Jh. bei einer Neueinteilung der
Verwaltungsbezirke die nördlichste der zwölf
Amtsvogteien in der Großvogtei Celle entstan-
den. Nachdem diese von Soltau aus verwaltete
Amtsvogtei bereits 1756 in die Amtsvogtei Fal-
lingbostel eingegliedert worden war, kam der
Amtssitz 1852, im Zuge der Reform mit einer
Neugliederung der Amtsbezirke, erneut nach
Soltau.
Grindau, Klein-Grindau. Ortsübersicht
300