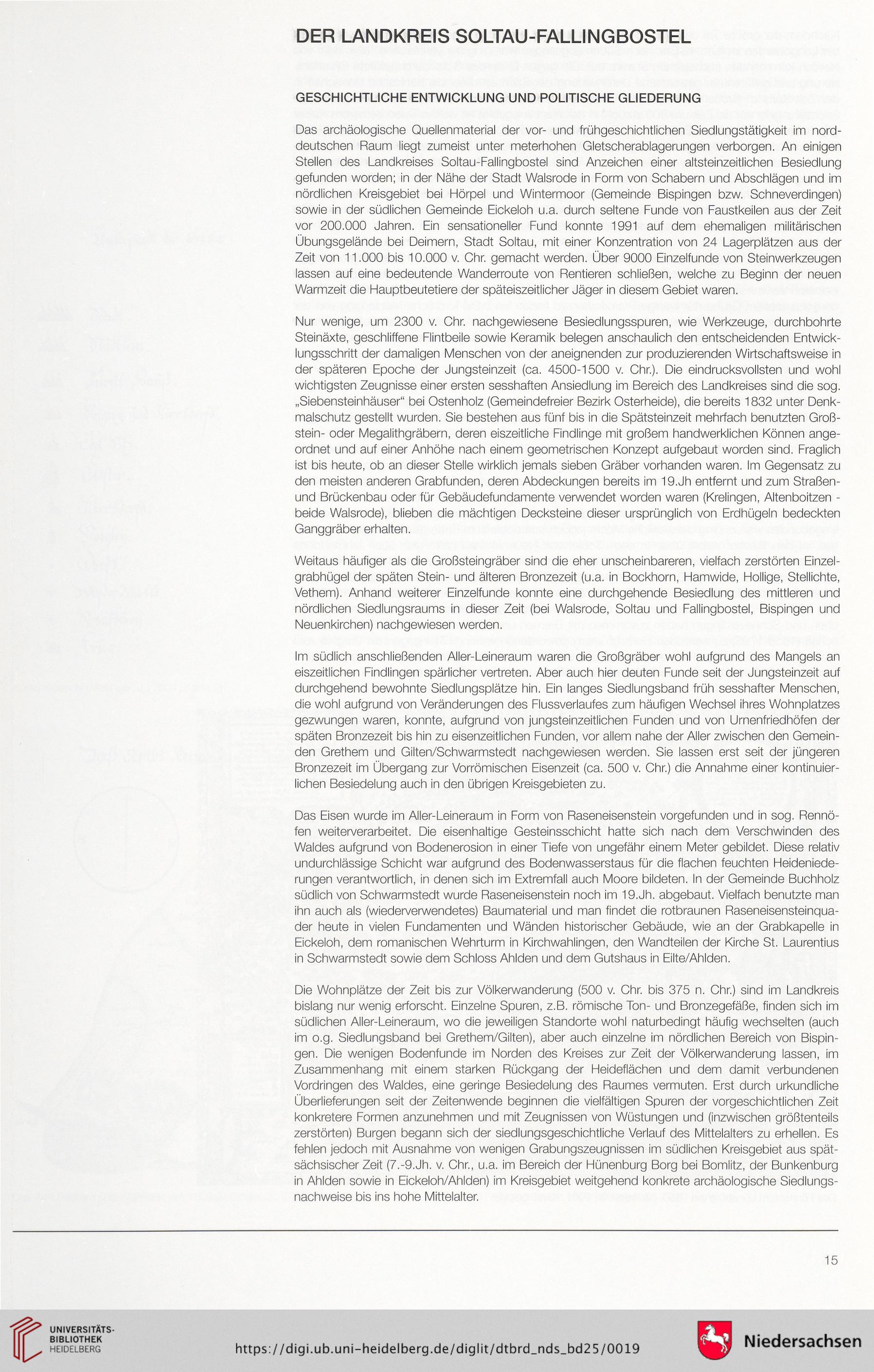DER LANDKREIS SOLTAU-FALLINGBOSTEL
GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG UND POLITISCHE GLIEDERUNG
Das archäologische Quellenmaterial der vor- und frühgeschichtlichen Siedlungstätigkeit im nord-
deutschen Raum liegt zumeist unter meterhohen Gletscherablagerungen verborgen. An einigen
Stellen des Landkreises Soltau-Fallingbostel sind Anzeichen einer altsteinzeitlichen Besiedlung
gefunden worden; in der Nähe der Stadt Walsrode in Form von Schabern und Abschlägen und im
nördlichen Kreisgebiet bei Hörpel und Wintermoor (Gemeinde Bispingen bzw. Schneverdingen)
sowie in der südlichen Gemeinde Eickeloh u.a. durch seltene Funde von Faustkeilen aus der Zeit
vor 200.000 Jahren. Ein sensationeller Fund konnte 1991 auf dem ehemaligen militärischen
Übungsgelände bei Deimern, Stadt Soltau, mit einer Konzentration von 24 Lagerplätzen aus der
Zeit von 11.000 bis 10.000 v. Chr. gemacht werden. Über 9000 Einzelfunde von Steinwerkzeugen
lassen auf eine bedeutende Wanderroute von Rentieren schließen, welche zu Beginn der neuen
Warmzeit die Hauptbeutetiere der späteiszeitlicher Jäger in diesem Gebiet waren.
Nur wenige, um 2300 v. Chr. nachgewiesene Besiedlungsspuren, wie Werkzeuge, durchbohrte
Steinäxte, geschliffene Flintbeile sowie Keramik belegen anschaulich den entscheidenden Entwick-
lungsschritt der damaligen Menschen von der aneignenden zur produzierenden Wirtschaftsweise in
der späteren Epoche der Jungsteinzeit (ca. 4500-1500 v. Chr.). Die eindrucksvollsten und wohl
wichtigsten Zeugnisse einer ersten sesshaften Ansiedlung im Bereich des Landkreises sind die sog.
„Siebensteinhäuser“ bei Ostenholz (Gemeindefreier Bezirk Osterheide), die bereits 1832 unter Denk-
malschutz gestellt wurden. Sie bestehen aus fünf bis in die Spätsteinzeit mehrfach benutzten Groß-
stein- oder Megalithgräbern, deren eiszeitliche Findlinge mit großem handwerklichen Können ange-
ordnet und auf einer Anhöhe nach einem geometrischen Konzept aufgebaut worden sind. Fraglich
ist bis heute, ob an dieser Stelle wirklich jemals sieben Gräber vorhanden waren. Im Gegensatz zu
den meisten anderen Grabfunden, deren Abdeckungen bereits im 19.Jh entfernt und zum Straßen-
und Brückenbau oder für Gebäudefundamente verwendet worden waren (Krelingen, Altenboitzen -
beide Walsrode), blieben die mächtigen Decksteine dieser ursprünglich von Erdhügeln bedeckten
Ganggräber erhalten.
Weitaus häufiger als die Großsteingräber sind die eher unscheinbareren, vielfach zerstörten Einzel-
grabhügel der späten Stein- und älteren Bronzezeit (u.a. in Bockhorn, Hamwide, Hollige, Stellichte,
Vethem). Anhand weiterer Einzelfunde konnte eine durchgehende Besiedlung des mittleren und
nördlichen Siedlungsraums in dieser Zeit (bei Walsrode, Soltau und Fallingbostel, Bispingen und
Neuenkirchen) nachgewiesen werden.
Im südlich anschließenden Aller-Leineraum waren die Großgräber wohl aufgrund des Mangels an
eiszeitlichen Findlingen spärlicher vertreten. Aber auch hier deuten Funde seit der Jungsteinzeit auf
durchgehend bewohnte Siedlungsplätze hin. Ein langes Siedlungsband früh sesshafter Menschen,
die wohl aufgrund von Veränderungen des Flussverlaufes zum häufigen Wechsel ihres Wohnplatzes
gezwungen waren, konnte, aufgrund von jungsteinzeitlichen Funden und von Urnenfriedhöfen der
späten Bronzezeit bis hin zu eisenzeitlichen Funden, vor allem nahe der Aller zwischen den Gemein-
den Grethem und Gilten/Schwarmstedt nachgewiesen werden. Sie lassen erst seit der jüngeren
Bronzezeit im Übergang zur Vorrömischen Eisenzeit (ca. 500 v. Chr.) die Annahme einer kontinuier-
lichen Besiedelung auch in den übrigen Kreisgebieten zu.
Das Eisen wurde im Aller-Leineraum in Form von Raseneisenstein vorgefunden und in sog. Rennö-
fen weiterverarbeitet. Die eisenhaltige Gesteinsschicht hatte sich nach dem Verschwinden des
Waldes aufgrund von Bodenerosion in einer Tiefe von ungefähr einem Meter gebildet. Diese relativ
undurchlässige Schicht war aufgrund des Bodenwasserstaus für die flachen feuchten Heideniede-
rungen verantwortlich, in denen sich im Extremfall auch Moore bildeten. In der Gemeinde Buchholz
südlich von Schwarmstedt wurde Raseneisenstein noch im 19.Jh. abgebaut. Vielfach benutzte man
ihn auch als (wiederverwendetes) Baumaterial und man findet die rotbraunen Raseneisensteinqua-
der heute in vielen Fundamenten und Wänden historischer Gebäude, wie an der Grabkapelle in
Eickeloh, dem romanischen Wehrturm in Kirchwahlingen, den Wandteilen der Kirche St. Laurentius
in Schwarmstedt sowie dem Schloss Ahlden und dem Gutshaus in Eilte/Ahlden.
Die Wohnplätze der Zeit bis zur Völkerwanderung (500 v. Chr. bis 375 n. Chr.) sind im Landkreis
bislang nur wenig erforscht. Einzelne Spuren, z.B. römische Ton- und Bronzegefäße, finden sich im
südlichen Aller-Leineraum, wo die jeweiligen Standorte wohl naturbedingt häufig wechselten (auch
im o.g. Siedlungsband bei Grethem/Gilten), aber auch einzelne im nördlichen Bereich von Bispin-
gen. Die wenigen Bodenfunde im Norden des Kreises zur Zeit der Völkerwanderung lassen, im
Zusammenhang mit einem starken Rückgang der Heideflächen und dem damit verbundenen
Vordringen des Waldes, eine geringe Besiedelung des Raumes vermuten. Erst durch urkundliche
Überlieferungen seit der Zeitenwende beginnen die vielfältigen Spuren der vorgeschichtlichen Zeit
konkretere Formen anzunehmen und mit Zeugnissen von Wüstungen und (inzwischen größtenteils
zerstörten) Burgen begann sich der siedlungsgeschichtliche Verlauf des Mittelalters zu erhellen. Es
fehlen jedoch mit Ausnahme von wenigen Grabungszeugnissen im südlichen Kreisgebiet aus spät-
sächsischer Zeit (7.-9.Jh. v. Chr., u.a. im Bereich der Hünenburg Borg bei Bomlitz, der Bunkenburg
in Ahlden sowie in Eickeloh/Ahlden) im Kreisgebiet weitgehend konkrete archäologische Siedlungs-
nachweise bis ins hohe Mittelalter.
15
GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG UND POLITISCHE GLIEDERUNG
Das archäologische Quellenmaterial der vor- und frühgeschichtlichen Siedlungstätigkeit im nord-
deutschen Raum liegt zumeist unter meterhohen Gletscherablagerungen verborgen. An einigen
Stellen des Landkreises Soltau-Fallingbostel sind Anzeichen einer altsteinzeitlichen Besiedlung
gefunden worden; in der Nähe der Stadt Walsrode in Form von Schabern und Abschlägen und im
nördlichen Kreisgebiet bei Hörpel und Wintermoor (Gemeinde Bispingen bzw. Schneverdingen)
sowie in der südlichen Gemeinde Eickeloh u.a. durch seltene Funde von Faustkeilen aus der Zeit
vor 200.000 Jahren. Ein sensationeller Fund konnte 1991 auf dem ehemaligen militärischen
Übungsgelände bei Deimern, Stadt Soltau, mit einer Konzentration von 24 Lagerplätzen aus der
Zeit von 11.000 bis 10.000 v. Chr. gemacht werden. Über 9000 Einzelfunde von Steinwerkzeugen
lassen auf eine bedeutende Wanderroute von Rentieren schließen, welche zu Beginn der neuen
Warmzeit die Hauptbeutetiere der späteiszeitlicher Jäger in diesem Gebiet waren.
Nur wenige, um 2300 v. Chr. nachgewiesene Besiedlungsspuren, wie Werkzeuge, durchbohrte
Steinäxte, geschliffene Flintbeile sowie Keramik belegen anschaulich den entscheidenden Entwick-
lungsschritt der damaligen Menschen von der aneignenden zur produzierenden Wirtschaftsweise in
der späteren Epoche der Jungsteinzeit (ca. 4500-1500 v. Chr.). Die eindrucksvollsten und wohl
wichtigsten Zeugnisse einer ersten sesshaften Ansiedlung im Bereich des Landkreises sind die sog.
„Siebensteinhäuser“ bei Ostenholz (Gemeindefreier Bezirk Osterheide), die bereits 1832 unter Denk-
malschutz gestellt wurden. Sie bestehen aus fünf bis in die Spätsteinzeit mehrfach benutzten Groß-
stein- oder Megalithgräbern, deren eiszeitliche Findlinge mit großem handwerklichen Können ange-
ordnet und auf einer Anhöhe nach einem geometrischen Konzept aufgebaut worden sind. Fraglich
ist bis heute, ob an dieser Stelle wirklich jemals sieben Gräber vorhanden waren. Im Gegensatz zu
den meisten anderen Grabfunden, deren Abdeckungen bereits im 19.Jh entfernt und zum Straßen-
und Brückenbau oder für Gebäudefundamente verwendet worden waren (Krelingen, Altenboitzen -
beide Walsrode), blieben die mächtigen Decksteine dieser ursprünglich von Erdhügeln bedeckten
Ganggräber erhalten.
Weitaus häufiger als die Großsteingräber sind die eher unscheinbareren, vielfach zerstörten Einzel-
grabhügel der späten Stein- und älteren Bronzezeit (u.a. in Bockhorn, Hamwide, Hollige, Stellichte,
Vethem). Anhand weiterer Einzelfunde konnte eine durchgehende Besiedlung des mittleren und
nördlichen Siedlungsraums in dieser Zeit (bei Walsrode, Soltau und Fallingbostel, Bispingen und
Neuenkirchen) nachgewiesen werden.
Im südlich anschließenden Aller-Leineraum waren die Großgräber wohl aufgrund des Mangels an
eiszeitlichen Findlingen spärlicher vertreten. Aber auch hier deuten Funde seit der Jungsteinzeit auf
durchgehend bewohnte Siedlungsplätze hin. Ein langes Siedlungsband früh sesshafter Menschen,
die wohl aufgrund von Veränderungen des Flussverlaufes zum häufigen Wechsel ihres Wohnplatzes
gezwungen waren, konnte, aufgrund von jungsteinzeitlichen Funden und von Urnenfriedhöfen der
späten Bronzezeit bis hin zu eisenzeitlichen Funden, vor allem nahe der Aller zwischen den Gemein-
den Grethem und Gilten/Schwarmstedt nachgewiesen werden. Sie lassen erst seit der jüngeren
Bronzezeit im Übergang zur Vorrömischen Eisenzeit (ca. 500 v. Chr.) die Annahme einer kontinuier-
lichen Besiedelung auch in den übrigen Kreisgebieten zu.
Das Eisen wurde im Aller-Leineraum in Form von Raseneisenstein vorgefunden und in sog. Rennö-
fen weiterverarbeitet. Die eisenhaltige Gesteinsschicht hatte sich nach dem Verschwinden des
Waldes aufgrund von Bodenerosion in einer Tiefe von ungefähr einem Meter gebildet. Diese relativ
undurchlässige Schicht war aufgrund des Bodenwasserstaus für die flachen feuchten Heideniede-
rungen verantwortlich, in denen sich im Extremfall auch Moore bildeten. In der Gemeinde Buchholz
südlich von Schwarmstedt wurde Raseneisenstein noch im 19.Jh. abgebaut. Vielfach benutzte man
ihn auch als (wiederverwendetes) Baumaterial und man findet die rotbraunen Raseneisensteinqua-
der heute in vielen Fundamenten und Wänden historischer Gebäude, wie an der Grabkapelle in
Eickeloh, dem romanischen Wehrturm in Kirchwahlingen, den Wandteilen der Kirche St. Laurentius
in Schwarmstedt sowie dem Schloss Ahlden und dem Gutshaus in Eilte/Ahlden.
Die Wohnplätze der Zeit bis zur Völkerwanderung (500 v. Chr. bis 375 n. Chr.) sind im Landkreis
bislang nur wenig erforscht. Einzelne Spuren, z.B. römische Ton- und Bronzegefäße, finden sich im
südlichen Aller-Leineraum, wo die jeweiligen Standorte wohl naturbedingt häufig wechselten (auch
im o.g. Siedlungsband bei Grethem/Gilten), aber auch einzelne im nördlichen Bereich von Bispin-
gen. Die wenigen Bodenfunde im Norden des Kreises zur Zeit der Völkerwanderung lassen, im
Zusammenhang mit einem starken Rückgang der Heideflächen und dem damit verbundenen
Vordringen des Waldes, eine geringe Besiedelung des Raumes vermuten. Erst durch urkundliche
Überlieferungen seit der Zeitenwende beginnen die vielfältigen Spuren der vorgeschichtlichen Zeit
konkretere Formen anzunehmen und mit Zeugnissen von Wüstungen und (inzwischen größtenteils
zerstörten) Burgen begann sich der siedlungsgeschichtliche Verlauf des Mittelalters zu erhellen. Es
fehlen jedoch mit Ausnahme von wenigen Grabungszeugnissen im südlichen Kreisgebiet aus spät-
sächsischer Zeit (7.-9.Jh. v. Chr., u.a. im Bereich der Hünenburg Borg bei Bomlitz, der Bunkenburg
in Ahlden sowie in Eickeloh/Ahlden) im Kreisgebiet weitgehend konkrete archäologische Siedlungs-
nachweise bis ins hohe Mittelalter.
15