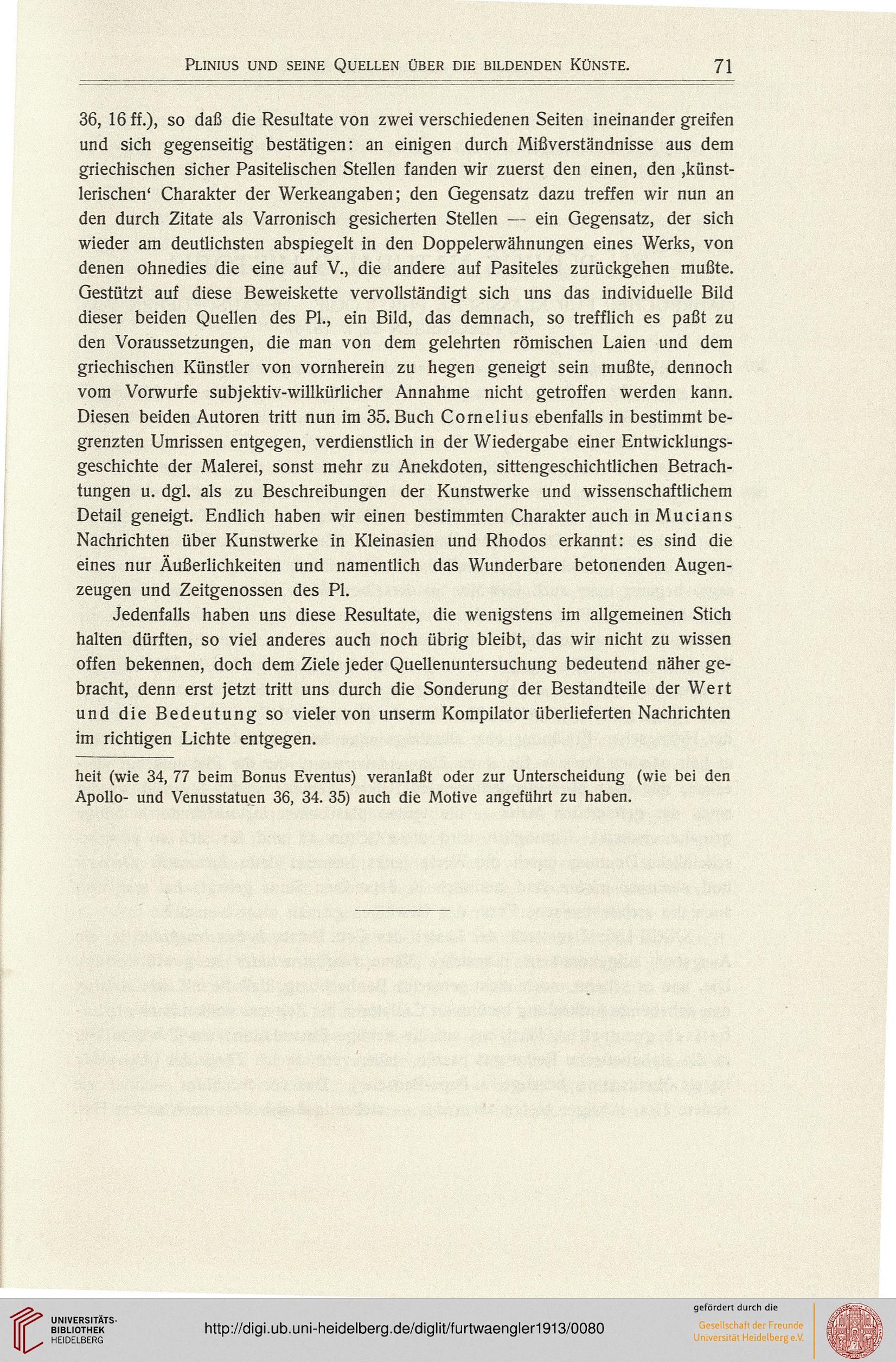Plinius und seine Quellen über die bildenden KOnste. 71
36, 16 ff.), so daß die Resultate von zwei verschiedenen Seiten ineinandergreifen
und sich gegenseitig bestätigen: an einigen durch Mißverständnisse aus dem
griechischen sicher Pasitelischen Stellen fanden wir zuerst den einen, den künst-
lerischen' Charakter der Werkeangaben; den Gegensatz dazu treffen wir nun an
den durch Zitate als Varronisch gesicherten Stellen — ein Gegensatz, der sich
wieder am deutlichsten abspiegelt in den Doppelerwähnungen eines Werks, von
denen ohnedies die eine auf V., die andere auf Pasiteles zurückgehen mußte.
Gestützt auf diese Beweiskette vervollständigt sich uns das individuelle Bild
dieser beiden Quellen des PL, ein Bild, das demnach, so trefflich es paßt zu
den Voraussetzungen, die man von dem gelehrten römischen Laien und dem
griechischen Künstler von vornherein zu hegen geneigt sein mußte, dennoch
vom Vorwurfe subjektiv-willkürlicher Annahme nicht getroffen werden kann.
Diesen beiden Autoren tritt nun im 35. Buch Cornelius ebenfalls in bestimmt be-
grenzten Umrissen entgegen, verdienstlich in der Wiedergabe einer Entwicklungs-
geschichte der Malerei, sonst mehr zu Anekdoten, sittengeschichtlichen Betrach-
tungen u. dgl. als zu Beschreibungen der Kunstwerke und wissenschaftlichem
Detail geneigt. Endlich haben wir einen bestimmten Charakter auch in Mucians
Nachrichten über Kunstwerke in Kleinasien und Rhodos erkannt: es sind die
eines nur Äußerlichkeiten und namentlich das Wunderbare betonenden Augen-
zeugen und Zeitgenossen des PI.
Jedenfalls haben uns diese Resultate, die wenigstens im allgemeinen Stich
halten dürften, so viel anderes auch noch übrig bleibt, das wir nicht zu wissen
offen bekennen, doch dem Ziele jeder Quellenuntersuchung bedeutend näher ge-
bracht, denn erst jetzt tritt uns durch die Sonderung der Bestandteile der Wert
und die Bedeutung so vieler von unserm Kompilator überlieferten Nachrichten
im richtigen Lichte entgegen.
heit (wie 34, 77 beim Bonus Eventus) veranlaßt oder zur Unterscheidung (wie bei den
Apollo- und Venusstatuen 36, 34. 35) auch die Motive angeführt zu haben.
36, 16 ff.), so daß die Resultate von zwei verschiedenen Seiten ineinandergreifen
und sich gegenseitig bestätigen: an einigen durch Mißverständnisse aus dem
griechischen sicher Pasitelischen Stellen fanden wir zuerst den einen, den künst-
lerischen' Charakter der Werkeangaben; den Gegensatz dazu treffen wir nun an
den durch Zitate als Varronisch gesicherten Stellen — ein Gegensatz, der sich
wieder am deutlichsten abspiegelt in den Doppelerwähnungen eines Werks, von
denen ohnedies die eine auf V., die andere auf Pasiteles zurückgehen mußte.
Gestützt auf diese Beweiskette vervollständigt sich uns das individuelle Bild
dieser beiden Quellen des PL, ein Bild, das demnach, so trefflich es paßt zu
den Voraussetzungen, die man von dem gelehrten römischen Laien und dem
griechischen Künstler von vornherein zu hegen geneigt sein mußte, dennoch
vom Vorwurfe subjektiv-willkürlicher Annahme nicht getroffen werden kann.
Diesen beiden Autoren tritt nun im 35. Buch Cornelius ebenfalls in bestimmt be-
grenzten Umrissen entgegen, verdienstlich in der Wiedergabe einer Entwicklungs-
geschichte der Malerei, sonst mehr zu Anekdoten, sittengeschichtlichen Betrach-
tungen u. dgl. als zu Beschreibungen der Kunstwerke und wissenschaftlichem
Detail geneigt. Endlich haben wir einen bestimmten Charakter auch in Mucians
Nachrichten über Kunstwerke in Kleinasien und Rhodos erkannt: es sind die
eines nur Äußerlichkeiten und namentlich das Wunderbare betonenden Augen-
zeugen und Zeitgenossen des PI.
Jedenfalls haben uns diese Resultate, die wenigstens im allgemeinen Stich
halten dürften, so viel anderes auch noch übrig bleibt, das wir nicht zu wissen
offen bekennen, doch dem Ziele jeder Quellenuntersuchung bedeutend näher ge-
bracht, denn erst jetzt tritt uns durch die Sonderung der Bestandteile der Wert
und die Bedeutung so vieler von unserm Kompilator überlieferten Nachrichten
im richtigen Lichte entgegen.
heit (wie 34, 77 beim Bonus Eventus) veranlaßt oder zur Unterscheidung (wie bei den
Apollo- und Venusstatuen 36, 34. 35) auch die Motive angeführt zu haben.